Stachel Im Fleisch Der Mutterpartei : Strategien Der
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Stockholmer Programm 5-Punkte-Papier 2009-11-13
Gemeinsame Position zum Stockholmer Programm Renate Künast, Jürgen Trittin, Volker Beck, Ingrid Hönlinger, Memet Kilic, Tom Koenigs, Jerzy Montag, Konstantin von Notz, Manuel Sarrazin, Hans-Christian Ströbele, Wolfgang Wieland, Josef Winkler (Bundestagsfraktion) Claudia Roth, Cem Özdemir, Malte Spitz (Bundesvorstand) Jan Philipp Albrecht, Barbara Lochbihler, Franziska Keller (Europafraktion) Till Steffen (Justizsenator Hamburg) Für starke Grundrechte in Europa Das Stockholmer Programm für die Innen- und Rechtspolitik der Europäischen Union soll Anfang Dezember verabschiedet werden. Es erhebt den Anspruch, einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts im Dienste der BürgerInnen zu schaffen. Es soll ein Europa verwirklichen, das BürgerInnen, Flüchtlingen und MigrantInnen solidarisch Schutz bietet und als Garant der Grundrechte und Grundfreiheiten agiert. Allerdings werden die einzelnen Maßnahmenvorschläge des Programms seinen erklärten Zielen häufig nicht gerecht, sondern verkehrt sie sogar in ihr Gegenteil. Anstelle einer Stärkung der Grundrechte droht ein Mehr an Überwachung. Anstelle europaweit geltender Mindeststandards für Beschuldigte werden nur die Ermittlungsbefugnisse erweitert. Anstatt Solidarität gegenüber Flüchtlingen zu zeigen, wird die Abschottung Europas eher verstärkt. Wir Grüne wollen die europäische Integration in der Innen-, Rechts- und Flüchtlingspolitik vertiefen, aber nicht zu Lasten der Bürgerrechte, sondern durch Stärkung der Freiheit und wirksamen Ausbau der Grundrechte. Daher fordern wir: 1. Europäische Innenpolitik muss rechtsstaatliche Innenpolitik sein Eine wirksame europäische Kooperation bei der Bekämpfung von Terrorismus und Kriminalität ist richtig. Wir wehren uns aber gegen ein Übermaß an Institutionen und Eingriffsbefugnissen und ein Zuwenig an Kontrolle der Sicherheitsapparate. Die Erweiterung europäischer Kompetenzen braucht wirksamen Grundrechtsschutz , Transparenz und demokratische Kontrolle . Europäisierung darf nicht für die Aushöhlung des Rechtsstaats und des Grundrechtsschutzes missbraucht werden. 2. -
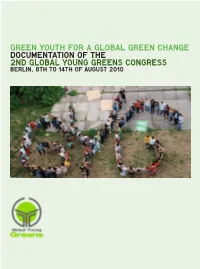
GREEN YOUTH for a GLOBAL GREEN CHANGE Documentation
GREEN YOUTH FOR A GLOBAL GREEN CHANGE Documentation of the 2nd Global Young Greens Congress Berlin, 8th to 14th of August 2010 Dear readers! 3 A short history of the Global Young Greens 4 HISTORY 2nd Congress 8 programmE 9 Regional Meetings 10 Workshops 12 the perspectives of small content scale farming and the agricultural issues 16 Green New Deal – A Concept for a Global Economic Change? 17 Impressions 18 General Assembly of GYG Congress Berlin 2010 20 Summary of our Structure Reform 21 GYG in Action 22 Passed Proposals 23 Statements 25 Participants 26 Introduction of the new Steering Committee 28 Plans 32 THANK-YOU‘S 30 IMPRINT 31 2 global young greens—Congress 2010 Dear readers! We proudly present to you the documentation of the 2nd Global Young Greens Congress held in Berlin from 8th to 14th of August 2010! More than 100 participants from over 50 countries spent five days of discussing as well as exchanging opinions and experiences from their homecountries in order to get closer together and fight with “Youth Power for a Global Green Change“. Workshops, fishbowl discussions and a world café were organised as parts of the congress. The debated topics were endless – reaching from economics and gender issues to social justice, peace and conflicts and - of course - climate change. After three days of debating, two days of General Assem- bly followed. In this, new structures were adopted as well as several topical proposals to form a wider political platform. With this documentation, we are trying to show what the congress was about and what was behind. -

Papers Situation Gruenen
PAPERS JOCHEN WEICHOLD ZUR SITUATION DER GRÜNEN IM HERBST 2014 ROSA LUXEMBURG STIFTUNG JOCHEN WEICHOLD ZUR SITUATION DER GRÜNEN IM HERBST 2014 REIHE PAPERS ROSA LUXEMBURG STIFTUNG Zum Autor: Dr. JOCHEN WEICHOLD ist freier Politikwissenschaftler. IMPRESSUM PAPERS wird herausgegeben von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und erscheint unregelmäßig V. i. S . d. P.: Martin Beck Franz-Mehring-Platz 1 • 10243 Berlin • www.rosalux.de ISSN 2194-0916 • Redaktionsschluss: November 2014 Gedruckt auf Circleoffset Premium White, 100 % Recycling 2 Inhalt Einleitung 5 Wahlergebnisse der Grünen bei Europa- und bei Bundestagswahlen 7 Ursachen für die Niederlage der Grünen bei der Bundestagswahl 2013 11 Wählerwanderungen von und zu den Grünen bei Europa- und bei Bundestagswahlen 16 Wahlergebnisse der Grünen bei Landtags- und bei Kommunalwahlen 18 Zur Sozialstruktur der Wähler der Grünen 24 Mitgliederentwicklung der Grünen 32 Zur Sozialstruktur der Mitglieder der Grünen 34 Politische Positionen der Partei Bündnis 90/Die Grünen 36 Haltung der Grünen zu aktuellen Fragen 46 Innerparteiliche Differenzierungsprozesse bei den Grünen 48 Ausblick: Schwarz-Grün auf Bundesebene? 54 Anhang 58 Zusammensetzung des Bundesvorstandes der Grünen (seit Oktober 2013) 58 Zusammensetzung des Parteirates der Grünen (seit Oktober 2013) 58 Abgeordnete der Grünen im Deutschen Bundestag im Ergebnis der Bundestagswahl 2013 59 Abgeordnete der Grünen im Europäischen Parlament im Ergebnis der Europawahl 2014 61 Wählerwanderungen von bzw. zu den Grünen bei der Landtagswahl in Sachsen 2014 im Vergleich zur Landtagswahl 2009 62 3 Wählerwanderungen von bzw. zu den Grünen bei der Landtagswahl in Brandenburg 2014 im Vergleich zur Landtagswahl 2009 62 Wählerwanderungen von bzw. zu den Grünen bei der Landtagswahl in Thüringen 2014 im Vergleich zur Landtagswahl 2009 63 Zur Sozialstruktur der Grün-Wähler bei den Landtagswahlen in Branden- burg, Sachsen und Thüringen 2014 63 Anmerkungen 65 4 Einleitung Die Partei Bündnis 90/Die Grünen (Grüne) stellt zwar mit 63 Abgeordneten die kleinste Fraktion im Deutschen Bundestag. -

Parteien in NRW
Stefan Marschall (Hg.) Parteien in NRW Stefan Marschall (Hg.) Parteien in NRW Liebe Leserin! Lieber Leser! Die Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen fördert die politisch bildende Literatur, indem sie entsprechende Buchprojekte konzeptionell und redaktionell begleitet sowie finanziell unterstützt. Auch dieses Buch ist mit maßgeblicher Beteiligung der Landeszentrale entstanden. Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen 1. Auflage Juni 2013 Satz und Gestaltung: Klartext Medienwerkstatt GmbH, Essen (www.k-mw.de) Umschlaggestaltung: Volker Pecher, Essen ISBN ePDF 978-3-8375-1116-1 ISBN Print 978-3-8375-0771-3 Alle Rechte vorbehalten © Klartext Verlag, Essen 2013 www.klartext-verlag.de Inhalt Parteien in Nordrhein-Westfalen – Einleitung . 7 Stefan Marschall I. Querschnittsperspektiven Historische Dimensionen des Parteiensystems in Nordrhein-Westfalen . 17 Christoph Nonn Das NRW-Parteiensystem im Wandel – Ein schleichender Prozess? . 37 Christoph Strünck Parteienrechtliche Rahmenbedingungen in NRW – Von den Freiheiten der Landesverbände . 57 Heike Merten Die Parteiorganisationen in Nordrhein-Westfalen . 71 Marcel Lewandowsky Parteien und Verbände in Nordrhein-Westfalen . 91 Jürgen Mittag Parteien und Medien in Nordrhein-Westfalen – Das Beziehungsgeflecht von Politik und Medien aus journalistischer und parteipolitischer Sicht . 107 Melanie Diermann Parteien und Internet in Nordrhein-Westfalen . 127 Christoph Bieber Direkte Demokratie und Parteien in Nordrhein-Westfalen – Ein Nullsummenspiel? . 145 Andreas Kost -

Es Griene Blädsche
Es griene Blädsche Nr. 287 Januar 2016 e-Mail: [email protected] Internet: http://www.gruene-dadi.de Gemeinsame Einladung des Ortsverbandes Kommunalwahl 2016 B90/Die GRÜNEN Roßdorf und KV Darmstadt‐Dieburg Am 4.11.2015 haben wir eine ein‐ drucksvolle Liste mit 54 Kandi‐ dat*innen aufgestellt. Die Ortsverbände sind ebenfalls gut aufgestellt und haben ihre Listenvorschläge eingereicht. Jetzt ist es an uns, unsere Wahl‐ programme und Kandidat*innen vorzustellen und die Wähler und Wählerinnen davon zu überzeu‐ gen GRÜN zu wählen. Am Mittwoch, den 13. Januar 2016 stellt der Kreisverband sein Wahlprogramm 2016—2021 vor. Wir freuen uns auf die Diskussion mit euch. Wir haben das Ziel, unser gutes Wahlergebnis von 2011 zu wie‐ derholen. Dafür brauchen wir die aktive Unterstützung aller Mitglie‐ der und Symphatisant*innen. Euer Kreisvorstand Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe Anschrift: Alter Bahnhof, Holzgasse 7, 64380 Roßdorf ist am Montag, den 05. März 2001 Bericht über die 39. Bundesdelegiertenkonferenz 20. bis 22. November 2015 in Halle Wieder einmal ziehen die Medien aus Anlass „standing ovations“, da er mit seiner rhetori‐ der letzten BDK über die GRÜNEN her, allen vor‐ schen Glanzleistung den Delegierten durchweg an die taz. Ihr Korrespondent Ulrich Schulte aus der Seele gesprochen hat. glaubt auf Grund der Debatten, eine schizophre‐ Im Mittelpunkt stand ein Antrag des Bundesvor‐ ne Partei vor sich zu haben, die insbesondere in stands zur Einwanderungspolitik („So schaffen der Flüchtlingspolitik sich nicht entscheiden kön‐ wir das! Der grüne Plan für eine menschliche ne und eine klare Linie vermissen lasse. Und so Flüchtlingspolitik und eine moderne Einwande‐ wird in der Öffentlichkeit wieder einmal das, was rungsgesellschaft“). -

Bündnis 90/Die Grünen 1993 Bis 2014
Bündnis 90/Die Grünen 1993 bis 2014 1. bis 37. ordentliche Bundesversammlung, fünf außerordentliche Bundesversammlungen 1. Ordentliche Bundesversammlung Bündnis 90/Die Grünen 14. - 16. Mai 1993 Leipzig Beschlüsse: Inkraftsetzung des Assoziationsvertrages zwischen Bündnis 90 und Die Grünen nach erfolgreicher Urabstimmung in beiden Parteien „Leipziger Erklärung“: Solidarität und BürgerInnenbeteiligung Vorstandswahlen: SprecherInnen: Marianne Birthler (neu) Ludger Volmer (wiedergewählt) Politische Geschäftsführerin: Heide Rühle (wiedergewählt) Schatzmeister: Henry Selzer (wiedergewählt) BeisitzerInnen: Angelika Beer (wiedergewählt) Christiane Ziller (neu) Eva Mensching (neu) Renate Backhaus (wiedergewählt) Helmut Lippelt (wiedergewählt) Friedrich Heilmann (wiedergewählt) Eberhard Wagner (neu) Resolutionen u.a. zu: Gegen den Kohl-Engholm-Pakt - den Solidarpakt von unten organisieren. Innenpolitische Debatte I. Verfassung nicht ohne das Volk! II. Gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus, für das Menschenrecht auf Asyl und gleiche Rechte für alle. III. Für eine bürgerrechtsorientierte Kriminalpolitik. Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen - ein Menschrecht Essen aus dem Genlabor? Wir sagen NEIN! Bundeswehreinsatz in Somalia 1 Kontakt: Christoph Becker-Schaum T 030. 285 34 265,[email protected] Außerordentliche Bundesversammlung Bündnis 90/Die Grünen 09. Oktober 1993 Bonn Nach einer Sondersitzung des Länderrates am 17. Juni debattiert die außerordentliche Bundesversammlung über den Einsatz militärischer Mittel -

Realismus & Substanz
REALISMUS & SUBSTANZ SEPTEMBER 2006 INTERVENTION II GRÜN WOHIN? Interventionen zur Zukunft grüner Politik Diagnose und Orientierung: Grüne Paradoxien Nebeneinanderstellen oder Anordnen: Zwischen den Orten Gerechtigkeit und Selbstbestimmung: Anstiftung zur Bildungsrevolution 3 Fragen – 23 Antworten: Call for Papers Peter Siller, Ramona Pop, Tarek Al-Wazir, Klaus Müller, Grietje Bettin, Kai Gehring, Anna Lührmann, Manuela Rottmann, Sarah Sorge, Konstantin von Notz, Kerstin Andreae, Bastian Bergerhoff, Sebastian Bukow, Andreas Bühler, Olaf Bursian, Olaf Cunitz, Reiner Daams, Oliver Dalichow, Frieder Dittmar, Marek Dutschke, Christoph Egle, Anke Erdmann, David Fiedler, Jan Fries, Jan Fuhse, Ulrike Gauderer, Anna Godzik, Sabine Groß, Johannes Grün, Katja Günter, Robert Habeck, David Handwerker, Michael Hebenstreit, Nicole Hohmann, Daniel Holefleisch, Felix Holefleisch, Malte Hübner, Katja Husen, Dieter Janecek, Arndt Klocke, Rolf Lange, Aram Lintzel, Bene Lux, Volker Meisinger-Persch, Christian Neuner-Duttenhofer, Ralph Obermauer, Boris Palmer, Tim Rusche, Michael Schäfer, Michael Scharf- schwerdt, Stephan Schilling, Gregor Simon, Malte Spitz, Mathias Wagner, Wulfila Walter, Christian Weiss, Nike Wessel, Stefanie Wolpert u.a. Herausgeber: Realismus & Substanz c/o Peter Siller Dunckerstr. 27 10439 Berlin Mail: [email protected] www.realismus-und-substanz.de Inhaltsübersicht Vorwort . 7 I. Grüne Paradoxien Diagnose und Orientierung auf unwegsamem Terrain . 13 II. Zwischen den Orten Vom Nebeneinanderstellen und Anordnen grüner Politik . 23 III. Anstiftung zur Bildungsrevolution Gerechtigkeit und Selbstbestimmung in der Wissensgesellschaft . 41 IV. R & S – Call for Papers „Grüne Paradoxien“ 3 Fragen – 23 Antworten . 89 Namensregister . 123 Inhalt Vorwort . 7 I. Grüne Paradoxien Diagnose und Orientierung auf unwegsamem Terrain 1. Das Soziale und das Ökologische. Parteinahme aus welcher Perspektive? . 13 2. Soziale Exklusion und prekäre Mittelschicht. -
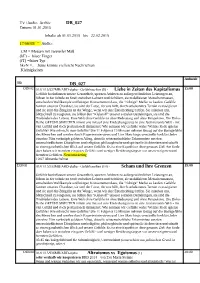
DB 027 DB 027 Scham Und Ihre Grenzen Altruismus Vs Egoismus
TV+Audio_Archiv DB_027 Datum: 01.01.2015 Inhalte ab 01.01.2015 bis 22.02.2015 17/06/08/ = Audio: z.M = Messen mit zweierlei Maß (bF) = böser Finger (fT) =fairer Typ hkvN =.. .hätte könnte vielleicht Nachrichten Kleinigkeiten Aufnzeit TR DB_027 DD002 01/01/15/527MB/ARD-alpha - Gefühlswelten (9) - Liebe in Zeiten des Kapitalismus 15:00 Gefühle beeinflussen unsere Gesundheit, spornen Athleten zu außergewöhnlichen Leistungen an, führen in der Schule zu Streit zwischen Lehrern und Schülern, sie mobilisieren Menschenmassen, entscheiden Wahlkämpfe und bringen Konsumenten dazu, die "richtige" Marke zu kaufen. Gefühle formen unseren Charakter, sie sind der Lotse, der uns hilft, durch unbekanntes Terrain zu navigieren und sie sind das Zünglein an der Waage, wenn wir eine Entscheidung treffen. Sie erlauben uns, blitzschnell zu reagieren, sie bilden den "Klebstoff" unserer sozialen Beziehungen, sie sind die Triebfedern des Lebens. Eine Welt ohne Gefühle ist ohne Bedeutung und ohne Perspektive. Die Doku- Reihe GEFÜHLSWELTEN nimmt uns mit auf eine Entdeckungsreise in eine faszinierende Welt - mit viel Gefühl und doch professionell distanziert: Wie nehmen wir Gefühle wahr? Welche Rolle spielen Gefühle? Wie erforscht man Gefühle? Die 11 Folgen à 15 Minuten nehmen Bezug auf die Basisgefühle des Menschen und werden durch Experteninterviews und Live Sketchings verständlich erklärt.Jeder einzelne Film verknüpft gelebten Alltag, aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse aus den unterschiedlichsten Disziplinen und religiöse, philosophische und spirituelle Sichtweisen -

Zukunftsforum Demokratie Abschlussbericht
Zukunftsforum Demokratie Bündnis 90 / Die Grünen Abschlussbericht Stand: 17.8.2011 Das Zukunftsforum Demokratie von Bündnis 90/Die Grünen wurde von der Bundesdelegiertenkonferenz in Rostock im Herbst 2009 beschlossen und nahm seine Arbeit im März 2010 auf. Es war das erste von fünf Zukunftsforen, die im Laufe der Jahre 2010 und 2011 zentrale Zukunftsfragen für eine nachhaltige Politik in den Mittelpunkt rückten und breit debattierten – neben Demokratie in den weiteren Zukunftsforen die Themen Zukunft der Kommunen und Europas, die auseinanderfallende Gesellschaft sowie Ökologie, Ökonomie und globale Gerechtigkeit. Die Zukunftsforen boten einen Raum, in dem grüne Köpfe der verschiedensten Ebenen und Gliederungen gemeinsam auch mit Experten von außerhalb der Partei jenseits der Alltagspolitik Lösungen für die großen Zukunftsherausforderungen diskutierten und entwickelten. Ihre Ergebnisse und Denkanstöße wurden auf einer Zukunftskonferenz im Juli 2011 in Berlin einer breiten Öffentlichkeit präsentiert und gemeinsam mit vielen Menschen aus der Partei, aus Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft diskutiert. Der vorliegende Abschlussbericht dokumentiert die Arbeitsergebnisse des Zukunftsforum Demokratie, das unter der Leitung von Claudia Roth und Sven Giegold von März 2010 bis August 2011 in insgesamt zehn Sitzungen gearbeitet hat. In den Bericht eingeflossen sind auch die Ergebnisse weiterer vom Zukunftsforum initiierter Veranstaltungen: einer ExpertInnenanhörung aus Zivilgesellschaft und Wissenschaft im Januar 2011, dem Kongress Demokratie 2.011 -
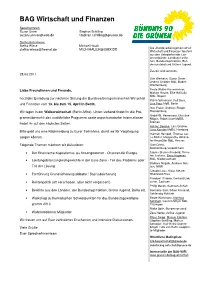
Einladung Und Programm (Pdf)
BAG Wirtschaft und Finanzen SprecherInnen: Suzan Ünver Stephan Schilling [email protected] [email protected] StellvertreterInnen: Stefka Wiese Michael Hauck [email protected] [email protected] Die „Bundesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Finanzen“ besteht aus den Delegierten der Lan- desverbände, Landtagsfraktio- nen, Bundestagsfraktion, Bun- desvorstand und Grüner Jugend. Zurzeit sind vertreten: 28.03.2011 Dirk Werhahn, Suzan Ünver; Andrea Lindlohr MdL, Baden- Württemberg Liebe Freundinnen und Freunde, Beate Walter-Rosenheimer, Michael Hauck; Eike Hallitzky MdL, Bayern herzliche Einladung zur nächsten Sitzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft Katrin Schumann, Rolf Bach , und Finanzen vom 13. bis zum 15. April in Berlin . Lisa Paus MdB, Berlin Ines Freier, Andreas Rieger, Wir tagen in der Weiberwirtschaft (Berlin-Mitte). Unten stehend findet Ihr die Pro- Brandenburg André W. Heinemann,Christine grammübersicht; das ausführliche Programm sowie organisatorische Informationen Möglin, Ralph Saxe MdBB, findet Ihr auf den nächsten Seiten. Bremen Helmut Deecke, Lars Brücher, Jens Kerstan MdBü, Hamburg Bitte gebt uns eine Rückmeldung zu Eurer Teilnahme, damit wir für Verpflegung Hannah Hempell, Thomas Los- sorgen können. se-Müller, Margaretha Hölldob- ler-Heumüller MdL, Hessen Folgende Themen möchten wir diskutieren: Uwe Driest, Mecklenburg-Vorpommern • Der Rheinische Kapitalismus als Krisengewinner - Chancen für Europa. Sabine Brunke-Reubold, Thors- ten Jochims, Enno Hagenah • Leistungsbilanzungleichgewichte in der Euro-Zone -

Protokoll Des Bündnistreffen 210809
Protokoll des Bündnis-Treffens am 21. August 2009 Ort: Haus der Demokratie und Menschenrechte, Robert-Havemann-Saal, Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin Zeit: 16.00 - 20.00 Uhr Anwesende: Vertreter von FoeBuD, Humanistische Union, AK Vorrat, AK Zensur, Bündnis 90/Die GRÜNEN, FDP-Bundespartei, Piratenpartei, Die Linke, Antifaschistische Revolutionäre Aktion Berlin (ARAB), Mehr Demokratie e.V., Bringt Licht ins Dunkel, Internationale Liga für Menschenrechte Moderation: Sven Lüders Protokoll: Viktoria Mühlbauer/ Nina Eschke Tagesordnung: 1. Begrüßung durch Sven Lüders 2. Vorstellungsrunde 3. Ansprache von Bündnispartner/-innen u. Unterstützern/-innen 4. Ressourcen für die Demo-Vorbereitung 5. Demo-Anmeldung/ Routenplanung 6. Demo-Orga: aktueller Stand 7. Demo-Ablauf/Bühnenprogramm 8. After-Demo-Programm 9. Gespräche beim Megaspree-Bündnis 8. Nächste Bündnistreffen Ansprache von Bündnispartnern/ Unterstützern - Eine Übersicht der Organisationen, die ihre Unterstützung der Demo bereits offiziell bestätigt bzw. die bereits angesprochen wurden, findet sich im Anhang. Aktueller Stand: ca. 130 Unterstützerorganisationen - Michael Efler berichtet, dass Mehr Demokratie e.V. unsere Demo unterstützt . - Von einigen Organisationen, die bereits angesprochen wurden, stehen immer noch Antworten aus (siehe Übersicht im Anhang). Die Bündnispartner/-innen werden gebeten diese noch einmal auf ihre Unterstützung anzusprechen. - Das Aktionsbüro hat alle EDRI-Mitgliedern kontaktiert und sie auf ihre Beteiligung am Internationalen Aktionstag angesprochen. Derzeit sind Aktionen zu FsA in London, Helsinki, Amsterdam, Sofia, Stockholm und Prag geplant. Alle Bündnispartner/-innen werden gebeten weitere Organisationen auf EU und internationaler Ebene anzusprechen. Der Aufruf auf englisch findet sich unter: http://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/304/1/lang,en/. Ressourcen für Demo-Vorbereitung - Sven Lüders (Humanistische Union) berichtet, dass bis jetzt 7100 Euro auf das Spendenkonto für die Demo eingegangen sind. -

Links Neu Grün Als Orientierungsfarbe Einer Erneuerten Linken
Grün als Orientierungsfarbe einer erneuerten Linken Positionspapier Realismus und Substanz Links Neu Grün als Orientierungsfarbe einer erneuerten Linken Positionspapier Realismus und Substanz 2. Perspektivkongress Realismus & Substanz am 1. Mai 2004, Spener Haus, Frankfurt am Main Autorinnen und Autoren: Peter Siller, Tarek Al-Wazir, Klaus Müller, Ramona Pop, Grietje Bettin, Mathias Wagner, Boris Palmer, Omid Nouripour, Katja Husen, Niombo Lomba, Stefan Tidow, Ralph Obermauer, Fe- lix Holefleisch, Olaf Cunitz, Heiko Thomas, Anna Lührmann, Kerstin Andreae, Michael Schä- fer, Robert Heinrich, Sibylle Knapp, Ulrike Gauderer, Malte Spitz, Jan Fries, Stefanie Wolpert, Till Steffen, Dieter Janecek, Kai Gehring, Oliver Dalichow, Aram Lintzel, Michael Hack, Mi- chael Scharfschwerdt, Theresia Bauer, Wulfila Walter, Michael Ortmanns, Michael Kellner, Bastian Bergerhoff, Sebastian Bukow, Sarah Sorge, Bene Lux, Manuela Rottmann u.a. Herausgeber: Realismus & Substanz c/o Peter Siller Dunckerstr. 25 10435 Berlin E-Mail: [email protected] www.realismus-und-substanz.de Satz und Layout: Olaf Cunitz Druck: Ebenhoch Buch- und Offsetdruck GmbH, Niedernhausen Frankfurt am Main 2004 Links Neu Realismus & Substanz 4 Realismus & Substanz Links Neu Vorwort Jenseits von blindem Pragmatismus und politi- und globalen Wandel der letzten Jahrzehnte. schen Traditionalismus gibt es die Notwendig- Globalisierung, Demographischer Wandel, In- keit, aber auch ein neues Bedürfnis nach dividualisierung, Digitalisierung, Migration und grundsätzlichen politischen Debatten. Eine an- Klimawandel sind nur einige der Stichpunkte, spruchsvolle und attraktive Politik muss die die die tiefgreifende Transformation beschrei- Frage nach ihren Konzepten und ihrer normati- ben. ven Orientierung beantworten. Dazu wollen die Im Zentrum unseres Vorschlags steht ein Ge- Autorinnen und UnterzeichnerInnen des vorlie- rechtigkeitsbegriff, der die gesellschaftlichen genden Papiers einen Beitrag leisten.