Realismus & Substanz
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Stockholmer Programm 5-Punkte-Papier 2009-11-13
Gemeinsame Position zum Stockholmer Programm Renate Künast, Jürgen Trittin, Volker Beck, Ingrid Hönlinger, Memet Kilic, Tom Koenigs, Jerzy Montag, Konstantin von Notz, Manuel Sarrazin, Hans-Christian Ströbele, Wolfgang Wieland, Josef Winkler (Bundestagsfraktion) Claudia Roth, Cem Özdemir, Malte Spitz (Bundesvorstand) Jan Philipp Albrecht, Barbara Lochbihler, Franziska Keller (Europafraktion) Till Steffen (Justizsenator Hamburg) Für starke Grundrechte in Europa Das Stockholmer Programm für die Innen- und Rechtspolitik der Europäischen Union soll Anfang Dezember verabschiedet werden. Es erhebt den Anspruch, einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts im Dienste der BürgerInnen zu schaffen. Es soll ein Europa verwirklichen, das BürgerInnen, Flüchtlingen und MigrantInnen solidarisch Schutz bietet und als Garant der Grundrechte und Grundfreiheiten agiert. Allerdings werden die einzelnen Maßnahmenvorschläge des Programms seinen erklärten Zielen häufig nicht gerecht, sondern verkehrt sie sogar in ihr Gegenteil. Anstelle einer Stärkung der Grundrechte droht ein Mehr an Überwachung. Anstelle europaweit geltender Mindeststandards für Beschuldigte werden nur die Ermittlungsbefugnisse erweitert. Anstatt Solidarität gegenüber Flüchtlingen zu zeigen, wird die Abschottung Europas eher verstärkt. Wir Grüne wollen die europäische Integration in der Innen-, Rechts- und Flüchtlingspolitik vertiefen, aber nicht zu Lasten der Bürgerrechte, sondern durch Stärkung der Freiheit und wirksamen Ausbau der Grundrechte. Daher fordern wir: 1. Europäische Innenpolitik muss rechtsstaatliche Innenpolitik sein Eine wirksame europäische Kooperation bei der Bekämpfung von Terrorismus und Kriminalität ist richtig. Wir wehren uns aber gegen ein Übermaß an Institutionen und Eingriffsbefugnissen und ein Zuwenig an Kontrolle der Sicherheitsapparate. Die Erweiterung europäischer Kompetenzen braucht wirksamen Grundrechtsschutz , Transparenz und demokratische Kontrolle . Europäisierung darf nicht für die Aushöhlung des Rechtsstaats und des Grundrechtsschutzes missbraucht werden. 2. -

Drucksache 19/15089 19
Deutscher Bundestag Drucksache 19/15089 19. Wahlperiode 13.11.2019 Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Manuela Rottmann, Kordula Schulz-Asche, Maria Klein- Schmeink, Dr. Kirsten Kappert-Gonther, Dr. Bettina Hoffmann, Katja Dörner, Dr. Anna Christmann, Kai Gehring, Erhard Grundl, Ulle Schauws, Margit Stumpp, Beate Walter-Rosenheimer und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Borreliose und FSME – Evaluierung und besserer Schutz für Risikogruppen Im Zusammenhang mit sich häufenden Hitzeperioden in Deutschland warnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor einem erhöhten Infektionsrisiko bei Zeckenbissen (www.br.de/nachrichten/wissen/2019-wird-ein-zeckensom mer-bayern-fast-komplett-risikogebiet,RJ52aVA) sowie vor neuen Zeckenar- ten, die sich aufgrund der veränderten klimatischen Bedingungen in Deutsch- land ansiedeln. Immer mehr Menschen erkranken infolge eines Zeckenbisses an der sogenannten Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). So wurde für das Hitzerekord-Jahr 2018 mit 538 gemeldeten Fällen der höchste Wert seit Einfüh- rung der Meldepflicht im Jahr 2001 erfasst (vgl. www.labor-enders.de/ 224.98.html). Aufgrund mangelnder Routine in der Diagnostik und teilweise diffuser Symptomatik ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Angehöri- ge von berufsbedingten Risikogruppen wie Försterinnen und Förster oder Schä- ferinnen und Schäfer sind einer besonderen Gefahr ausgesetzt, gegen die es derzeit keine zuverlässige Absicherung gibt. So lehnte das Landessozialgericht Hessen die Anerkennung von Borreliose als Berufskrankheit zuletzt ab – unter anderem mit der Begründung, dass der Vollbeweis einer klinisch manifesten Lyme-Borreliose-Erkrankung nicht erbracht werden konnte (vgl. https://open jur.de/u/307942.html). Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist es bisher nicht geglückt, einen eindeutigen Vollbeweis für eine Borreliose und den Zu- sammenhang mit diversen Folgeerkrankungen zu erbringen. -

SCHWERPUNKT DEMOKRATIE CORONA-KRISE Saubere Sachen: Editorial | 3
HASS DULDEN DAS MAGAZIN DER GRÜNEN 0 1 /2 DE 02 E . 0 GRUEN WIR NICHT SCHWERPUNKT DEMOKRATIECORONA-KRISE Saubere Sachen: Editorial | 3 Textilien aus dem Greenpeace Magazin MERKSATZ Warenhaus – fair und nachhaltig produziert „Corona entzaubert die Populisten. […] Umso bewusster sollten sich Demokraten auf die nach strengsten Greenpeace-Kriterien. Zeit nach dieser Zäsur vorbereiten.“ Roger de Weck, Seite 23 Kooperation statt Am Jahresanfang legten wir als Schwerpunkt dieser Ausgabe die „Demokratie“ fest. Doch dann verändert das Corona-Virus mit plötzlicher Konkurrenz Wucht die Welt. Wir erleben eine Ausnahmesituation von ungeahntem Im Gesundheitswesen, im Supermarkt, in der Ausmaß. Auf den letzten Metern haben wir das Heft umgeplant, um euch Logistik: Die Corona-Krise führt uns vor Augen, zu informieren, was die Pandemie für uns als Partei und für unsere welche Menschen unsere Gesellschaft am Demokratie bedeutet. Laufen halten, die wir sonst viel zu wenig im Wir sind als Partei in einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung. Fokus haben. Sie brauchen unsere Unterstüt- Auf der Landes- und Kommunalebene handeln unsere Mitglieder zung. Gebt aufeinander acht! Bleibt gesund! in Regierungen. Als Oppositionspartei nehmen wir unsere Rolle nicht parteitaktisch agierend wahr. Wir stehen nicht an der Seitenlinie und gruene.de/corona kritisieren, wir übernehmen politische Verantwortung. Wir haben alle gesellschaftlichen Gruppen im Blick – von der Alleinerziehenden bis zum Arbeitslosen –, damit niemand übersehen wird. Und wir wissen: So wie das Virus keine Grenzen kennt, darf die Solidarität nicht an Grenzen Halt machen. Europa darf sich nicht spalten lassen, Europa muss vereint handeln. Mehr denn je steht die Demokratie auf dem Prüfstand. In einer histori- schen Sitzung hat der Bundestag mit raschen Entscheidungen und dem größten Rettungspaket seit Gründung der BRD ein Zeichen gesetzt. -

Drucksache 19/27881
Deutscher Bundestag Drucksache 19/27881 19. Wahlperiode 24.03.2021 Antrag der Abgeordneten Erhard Grundl, Margit Stumpp, Dr. Kirsten Kappert- Gonther, Tabea Rößner, Dr. Anna Christmann, Dr. Janosch Dahmen, Kai Gehring, Maria Klein-Schmeink, Ulle Schauws, Charlotte Schneidewind- Hartnagel, Kordula Schulz-Asche, Beate Walter-Rosenheimer, Luise Amtsberg, Canan Bayram, Britta Haßelmann, Sven-Christian Kindler, Sven Lehmann, Claudia Müller, Beate Müller-Gemmeke, Dr. Konstantin von Notz, Lisa Paus, Filiz Polat, Claudia Roth (Augsburg), Dr. Manuela Rottmann, Corinna Rüffer, Stefan Schmidt, Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn, Wolfgang Wetzel und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Die Kultur- und Medienbranche krisenfest machen – Soloselbständige besser sozial absichern und vergüten Der Bundestag wolle beschließen: I. Der Deutsche Bundestag wolle beschließen: Die Corona-Krise zeigt wie ein Kontrastmittel, unter welch prekären Bedingungen viele Kultur- und Medienschaffende arbeiten. Die Folgen der Krise für den Kultur- und Medienbetrieb sind dramatisch: Vom einen auf den anderen Tag gerieten viele Einrichtungen und insbesondere freischaffende Kreative in existenzielle Nöte. „Corona hat alles verändert und Corona hat noch vieles sichtbarer gemacht. Dass die Seuche innerhalb von wenigen Tagen die ökonomischen Bedingungen der Künstlerin- nen und Künstler und der kleinen kulturwirtschaftlichen Unternehmen zum Zusam- menstürzen bringen konnte, zeigt, wie dünn das Eis der ökonomischen Absicherung der Frauen und Männer, die im Kulturmarkt arbeiten, ist“, heißt es in der aktuellen Studie des Deutschen Kulturrats „Frauen und Männer im Kulturmarkt. Bericht zur wirtschaftlichen und sozialen Lage“. Diese beunruhigende Situation betrifft vor allem die vielen Freiberufler*innen, die in der Branche tätig sind. Doch nicht nur das öko- nomische Eis ist dünn. Auch die soziale Absicherung ist unzureichend und war es auch schon vor der Pandemie. -
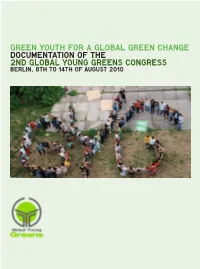
GREEN YOUTH for a GLOBAL GREEN CHANGE Documentation
GREEN YOUTH FOR A GLOBAL GREEN CHANGE Documentation of the 2nd Global Young Greens Congress Berlin, 8th to 14th of August 2010 Dear readers! 3 A short history of the Global Young Greens 4 HISTORY 2nd Congress 8 programmE 9 Regional Meetings 10 Workshops 12 the perspectives of small content scale farming and the agricultural issues 16 Green New Deal – A Concept for a Global Economic Change? 17 Impressions 18 General Assembly of GYG Congress Berlin 2010 20 Summary of our Structure Reform 21 GYG in Action 22 Passed Proposals 23 Statements 25 Participants 26 Introduction of the new Steering Committee 28 Plans 32 THANK-YOU‘S 30 IMPRINT 31 2 global young greens—Congress 2010 Dear readers! We proudly present to you the documentation of the 2nd Global Young Greens Congress held in Berlin from 8th to 14th of August 2010! More than 100 participants from over 50 countries spent five days of discussing as well as exchanging opinions and experiences from their homecountries in order to get closer together and fight with “Youth Power for a Global Green Change“. Workshops, fishbowl discussions and a world café were organised as parts of the congress. The debated topics were endless – reaching from economics and gender issues to social justice, peace and conflicts and - of course - climate change. After three days of debating, two days of General Assem- bly followed. In this, new structures were adopted as well as several topical proposals to form a wider political platform. With this documentation, we are trying to show what the congress was about and what was behind. -

All Together Now!
Foto: Mauritius Foto: All together DIE BUNDESTAGSFRAKTION IN DER 19. WAHLPERIODE now! UNS GEHT'S UMS GANZE INHALT . _____ S. 4 Die Fraktionsvorsitzenden . _____ S. 8 Der Fraktionsvorstand . _____ S. 10 So arbeitet der Vorstand . _____ S. 12 All together now – die grüne Bundestagsfraktion . _____ S. 14 So arbeiten die Abgeordneten . _____ S. 16 Organigramm der Fraktion . _____ S. 18 Arbeitskreis 1 . _____ S. 26 Arbeitskreis 2 . _____ S. 34 Arbeitskreis 3 . _____ S. 40 Arbeitskreis 4 . _____ S. 48 Arbeitskreis 5 . _____ S. 53 Kontakt . _____ S. 54 Index der MdB 2 3 Nach der längsten Regierungsbildung in Mit ihrer Wahlentscheidung haben die Bürgerinnen und Bürger der Geschichte der Bundesrepublik folgt einen unübersehbaren Hinweis gegeben, dass es in unserem DIE FRAKTIONSVORSITZENDEN in dieser 19. Wahlperiode zum ersten Land wieder ums Grundsätzliche geht. Diese Auseinanderset- Mal unmittelbar auf eine Große Koali- zung über die Grundwerte und Grundordnung unseres Zusam- tion gleich die nächste. Was eigentlich menlebens sowie über die Rolle der parlamentarischen Demo- DR. ANTON HOFREITER KATRIN GÖRING-ECKARDT die Ausnahme sein sollte, wird zur kratie für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft nehmen wir Regel. Es ist schon absehbar, dass dieser entschieden an. Regierung Mut, Weitblick und Tatkraft Wir gehen mit einem klaren Kompass in diese Wahlperiode. fehlen werden. Und zum allerersten Mal Dem Klein-Klein, wie es von der Großen Koalition des gegenseiti- sitzt im Bundestag eine rechtspopulisti- gen Misstrauens zu erwarten ist, setzen wir genau umrissene sche, teils rechtsextreme Fraktion. Schwerpunkte entgegen: Zur Bewältigung der großen Zukunfts- Unsere Aufgabe als Opposition sehen aufgaben wollen wir vernetzt und jenseits starrer Ressortzustän- Fraktionsvorsitzender Fraktionsvorsitzende wir natürlich darin, notwendige Kritik digkeiten in sechs übergreifenden Arbeitsfeldern innovative und Dipl. -

Papers Situation Gruenen
PAPERS JOCHEN WEICHOLD ZUR SITUATION DER GRÜNEN IM HERBST 2014 ROSA LUXEMBURG STIFTUNG JOCHEN WEICHOLD ZUR SITUATION DER GRÜNEN IM HERBST 2014 REIHE PAPERS ROSA LUXEMBURG STIFTUNG Zum Autor: Dr. JOCHEN WEICHOLD ist freier Politikwissenschaftler. IMPRESSUM PAPERS wird herausgegeben von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und erscheint unregelmäßig V. i. S . d. P.: Martin Beck Franz-Mehring-Platz 1 • 10243 Berlin • www.rosalux.de ISSN 2194-0916 • Redaktionsschluss: November 2014 Gedruckt auf Circleoffset Premium White, 100 % Recycling 2 Inhalt Einleitung 5 Wahlergebnisse der Grünen bei Europa- und bei Bundestagswahlen 7 Ursachen für die Niederlage der Grünen bei der Bundestagswahl 2013 11 Wählerwanderungen von und zu den Grünen bei Europa- und bei Bundestagswahlen 16 Wahlergebnisse der Grünen bei Landtags- und bei Kommunalwahlen 18 Zur Sozialstruktur der Wähler der Grünen 24 Mitgliederentwicklung der Grünen 32 Zur Sozialstruktur der Mitglieder der Grünen 34 Politische Positionen der Partei Bündnis 90/Die Grünen 36 Haltung der Grünen zu aktuellen Fragen 46 Innerparteiliche Differenzierungsprozesse bei den Grünen 48 Ausblick: Schwarz-Grün auf Bundesebene? 54 Anhang 58 Zusammensetzung des Bundesvorstandes der Grünen (seit Oktober 2013) 58 Zusammensetzung des Parteirates der Grünen (seit Oktober 2013) 58 Abgeordnete der Grünen im Deutschen Bundestag im Ergebnis der Bundestagswahl 2013 59 Abgeordnete der Grünen im Europäischen Parlament im Ergebnis der Europawahl 2014 61 Wählerwanderungen von bzw. zu den Grünen bei der Landtagswahl in Sachsen 2014 im Vergleich zur Landtagswahl 2009 62 3 Wählerwanderungen von bzw. zu den Grünen bei der Landtagswahl in Brandenburg 2014 im Vergleich zur Landtagswahl 2009 62 Wählerwanderungen von bzw. zu den Grünen bei der Landtagswahl in Thüringen 2014 im Vergleich zur Landtagswahl 2009 63 Zur Sozialstruktur der Grün-Wähler bei den Landtagswahlen in Branden- burg, Sachsen und Thüringen 2014 63 Anmerkungen 65 4 Einleitung Die Partei Bündnis 90/Die Grünen (Grüne) stellt zwar mit 63 Abgeordneten die kleinste Fraktion im Deutschen Bundestag. -

1. Kurzprotokoll Landesparteitag: Ablauf Und Wichtige Redebeiträge
1. Kurzprotokoll Landesparteitag: Ablauf und wichtige Redebeiträge +++ Grüner Landesparteitag – wir sind auch digital erfolgreich! Die Grünen in Schleswig-Holstein haben am Wochenende vom 31.10./01.11. ihren ersten digitalen Parteitag abgehalten. Dieser Parteitag stand in jeder Hinsicht unter dem Zeichen von Corona: so musste die Wahl der Kandidatenliste für den Bundestag auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden, da hierzu eine Präsenzpflicht erforderlich ist. Es gab aber neben Mitglieder-Anträgen viele engagierte Redebeiträge per Zuschaltung - u.a. auch von den Bundestagsabgeordneten der Grünen aus Schleswig-Holstein Ingrid Nestle, Luise Amtsberg und Konstantin v. Notz sowie dem Bundesvorsitzenden Robert Habeck -, der auch bundespolitisch für die Grünen den Bogen zur aktuellen Lage durch die Pandemie spannte. +++ Corona auf dem LPT wichtiges Thema in der Landespolitik Die stellvertretende Ministerpräsidentin in Schleswig-Holstein Monika Heinold holte am ersten Tag die Delegierten aus den Kreisverbänden in Schleswig-Holstein sehr überzeugend zur aktuellen Einschätzung der Grünen im Landtag zu Corona ab. Die Grünen unterstützen das übergeordnete Ziel, die Zahlen zu reduzieren und werden entsprechende Verordnungen in der Landesregierung daher mittragen, auch wenn die grüne Fraktion vielleicht nicht jede Einzelmaßnahme selbst initiiert hätte. Die Unterstützung der von Corona hart betroffenen Menschen ist seit Beginn der Krise in Schleswig- Holstein ein Anliegen der Grünen und bleibt dies auch weiterhin. Dies wird bekräftigt von der Landtagsabgeordneten und Sprecherin der Landtagsfraktion Eka von Kalben. Sie berichtet darüber, dass Familien vor besonderen Herausforderungen in der Pandemie stehen und findet es richtig, dass Schulen und Kitas weiterhin geöffnet sind. Schulschließungen schaffen weitaus mehr Probleme, als wenn diese geöffnet bleiben, das hat der erste Lockdown gezeigt. -

Die Grünen: Farbenlehre Eines Politischen Paradoxes
Angelo Bolaffi / Otto Kallscheuer Die Grünen: Farbenlehre eines politischen Paradoxes. Zwischen neuen Bewegungen und Veränderung der Politik:~ Einleitendes zur Fragestellung Die grüne Bewegung ist in der Bundesrepublik bereits zu einem stabilen Faktor des politi schen Systems geworden: also zu einer Art Paradox. Sie hat in ein als 'hyperstabil' gelten des Parteiensystem einen beständigen Faktor der Unruhe und der Destabilisierung politi scher Gleichgewichte eingeführt. Hat sie damit einen Wunsch konkret werden lassen, den die 'neue Linke' in der BRD seit ihrem Bestehen ebenso intensiv wie erfolglos hegte? Oder ist sie in einer Bundesrepublik, die von einigen schon als auf dem Weg zur 'Unregierbar keit' angesehen wird, ein parteipolitischer Rettungsanker: möglicher Kandidat für »die Funktion spätkapitalistischen Krisenmanagements« (Tarozzi 1982, S.140) und damit, wie der SPIEGEL titelte, ein »Regierungspartner von morgen«? (Mettke 1982). Die Grünen selbst verwahren sich gegen solche Unterstellungen. Petra Karin Kelly, Mitglied des ersten grünen Bundesvorstandes und vielleicht bekannteste charismatische Politikerin der Grü• nen: »Wir sind die Antipartei-Partei.« (in: Mettke 1982, S.31) Dieser grüne Unwille, sich mit der Rolle einer Partei zu identifizieren, hat systematische politische Gründe. Denn bereits die Frage der Konstituierung einer neuen Partei aus dem Spektrum neuer Protestbewegungen war und ist Gegenstand von Kontroversen, die mit dieser Natur dieser Bewegungen selbst zusammenhängen. In der Arbeiterbewegung war die Konstituierung -

PDF-Download
BUNDESVERFASSUNGSGERICHT Verkündet - 2 BvQ 22/19 - am 15. April 2019 Fischböck IM NAMEN DES VOLKES als Urkundsbeamtin In dem Verfahren der Geschäftsstelle über den Antrag, im Wege der einstweiligen Anordnung § 6a Absatz 1 Nummer 2 und 3 des Europawahlgesetzes – auch in Verbindung mit § 6a Absatz 2 Nummer 1 des Europawahlgesetzes – für die neunte Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland (vgl. BGBl I 2018 Seite 1646) für nicht anwendbar zu erklären, Antragsteller: Mitglieder des Deutschen Bundestages 1.Doris Achelwilm, 2.Grigorios Aggelidis, 3.Gökay Akbulut, 4.Renata Alt, 5.Luise Amtsberg, 6.Kerstin Andreae, 7.Christine Aschenberg-Dugnus, 8.Lisa Badum, 1/16 9.Annalena Baerbock, 10.Simone Barrientos, 11.Dr. Dietmar Bartsch, 12.Nicole Bauer, 13.Margarete Bause, 14.Dr. Danyal Bayaz, 15.Canan Bayram, 16.Jens Beeck, 17.Nicola Beer, 18.Matthias W. Birkwald, 19.Heidrun Bluhm, 20.Dr. Jens Brandenburg, 21.Mario Brandenburg, 22.Michael Brandt, 23.Dr. Franziska Brantner, 24.Agnieszka Brugger, 2/16 25.Christine Buchholz, 26.Birke Bull-Bischoff, 27.Dr. Marco Buschmann, 28.Karlheinz Busen, 29.Jörg Cezanne, 30.Dr. Anna Christmann, 31.Carl-Julius Cronenberg, 32.Sevim Dagdelen, 33.Britta Katharina Dassler, 34.Dr. Diether Dehm, 35.Ekin Deligöz, 36.Fabio De Masi, 37.Bijan Djir-Sarai, 38.Katja Dörner, 39.Anke Domscheit-Berg, 40.Katharina Dröge, 3/16 41.Christian Dürr, 42.Hartmut Ebbing, 43.Harald Ebner, 44.Klaus Ernst, 45.Dr. Marcus Faber, 46.Susanne Ferschl, 47.Daniel Föst, 48.Brigitte Freihold, 49.Otto Fricke, 50.Sylvia Gabelmann, 51.Matthias Gastel, 52.Kai Gehring, 53.Stefan Gelbhaar, 54.Katrin Göring-Eckardt, 55.Nicole Gohlke, 56.Erhard Grundl, 4/16 57.Dr. -

COP Side Events
BELOW 2°C TOGETHER WE’LL MAKE IT! 2°COP 21 PARIS | 5 - 11 December 2015 Side events at the German Pavilion Hall 2B | No 51 Version: 10.12.2015 10:00 Uhr The information in this brochure is subject to change. Please refer to the latest version online: http://www.bmub.bund.de/cop-events Programme Climate Action in Practice Saturday, 5 December ............................................................................................2 Shaping the Energy Transition Monday, 7 December .............................................................................................4 Building Resilience Tuesday, 8 December .............................................................................................7 The Low Emission Path Wednesday, 9 December .................................................................................... 10 Local & Regional Climate Action Thursday, 10 December ...................................................................................... 13 Managing Risks Friday, 11 December ............................................................................................ 16 | 1 Saturday, 5 December, 10:00-11:30 Climate, Soil, Biomass – Championing Sustainable Production of Raw Materials Christian Schmidt, Federal Minister of Food and Agriculture, Germany Jean-Christophe Roubin, Ministry of Agriculture, France Prof Dr Klaus Töpfer, former Executive Director of UNEP Martina Fleckenstein, Director of EU Policy, Agriculture & Sustainable Biomass of WWF Alison Cairns, Global Advocacy Director for Sustainable -

2011 06 05 Thesen Verteilungsgerechtigkeit Final
Zukunftsforum: “Antworten auf die auseinanderfallende Gesellschaft” Ulrike Bürgel, David Gill, Katharina Fegebank, Ralf Fücks, Thomas Gehring, Sibylle Knapp, Robert Habeck, Mark Holzberger, Sibyll Klotz, Silke Krebs, Markus Kurth, Sven Lehmann, Max Löffler, Bärbl Mielich, Cem Özdemir (Co-Chair), Ramona Pop, Brigitte Pothmer, Astrid Rothe-Beinlich, Irmingard Schewe-Gerigk, Gerhard Schick, Peter Siller (Co-Chair), Nihat Sorgec, Wolfgang Strengmann-Kuhn, Mathias Wagner Thesen zum Workshop: Was heißt grüne Verteilungsgerechtigkeit? Individuen, Institutionen und Erweiterte Gerechtigkeit Wir Grüne nehmen die Aufgabe an, mit Blick auf die soziale Frage eine eigene Antwort zu geben und sichtbar zu machen. Hier entscheidet sich, ob sich grüne Politik einer der drängendsten Herausforderungen für unsere Gesellschaft annimmt und das Versprechen einer gerechten „Politik für alle“ einlöst. Die Diagnose einer „auseinanderfallenden Gesellschaft“ ist mit Blick auf die Bundesrepublik nicht übertrieben: Die Schere bei den Zugangsmöglichkeiten zu den entscheidenden öffentlichen Gütern geht ebenso immer weiter auseinander wie die bei den Einkommen und Vermögen. Auf der Suche nach politischen Antworten auf die auseinanderfallende Gesellschaft kommt den Grünen eine Schlüsselrolle zu. Denn eine Politik der Gerechtigkeit braucht nicht nur Solidarität und Empathie, sie braucht zudem eine ausreichend konkretisierte und differenzierte Leitidee von Gerechtigkeit und einen klaren und offenen Blick für die Ursachen von Ungerechtigkeit. Bündnis 90/Die Grünen haben das Potential und die Kraft eine neue – ideenreiche und realitätstaugliche – Politik der Gerechtigkeit zu formulieren. Viele vermeintlich „postmaterielle“ Themen der Gründungszeit erweisen sich heute nicht nur als ökonomisch bedeutsam, sondern als harte, soziale Themen. Wir müssen nicht jedes fachpolitische Detail zur Grundsatzfrage erhöhen, aber eine allgemeine „Unschärfe“ in diesem Bereich würde unserem Anspruch einer Politik für alle nicht gerecht werden und würde uns unserer Entwicklungschancen berauben.