Papers Situation Gruenen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Stockholmer Programm 5-Punkte-Papier 2009-11-13
Gemeinsame Position zum Stockholmer Programm Renate Künast, Jürgen Trittin, Volker Beck, Ingrid Hönlinger, Memet Kilic, Tom Koenigs, Jerzy Montag, Konstantin von Notz, Manuel Sarrazin, Hans-Christian Ströbele, Wolfgang Wieland, Josef Winkler (Bundestagsfraktion) Claudia Roth, Cem Özdemir, Malte Spitz (Bundesvorstand) Jan Philipp Albrecht, Barbara Lochbihler, Franziska Keller (Europafraktion) Till Steffen (Justizsenator Hamburg) Für starke Grundrechte in Europa Das Stockholmer Programm für die Innen- und Rechtspolitik der Europäischen Union soll Anfang Dezember verabschiedet werden. Es erhebt den Anspruch, einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts im Dienste der BürgerInnen zu schaffen. Es soll ein Europa verwirklichen, das BürgerInnen, Flüchtlingen und MigrantInnen solidarisch Schutz bietet und als Garant der Grundrechte und Grundfreiheiten agiert. Allerdings werden die einzelnen Maßnahmenvorschläge des Programms seinen erklärten Zielen häufig nicht gerecht, sondern verkehrt sie sogar in ihr Gegenteil. Anstelle einer Stärkung der Grundrechte droht ein Mehr an Überwachung. Anstelle europaweit geltender Mindeststandards für Beschuldigte werden nur die Ermittlungsbefugnisse erweitert. Anstatt Solidarität gegenüber Flüchtlingen zu zeigen, wird die Abschottung Europas eher verstärkt. Wir Grüne wollen die europäische Integration in der Innen-, Rechts- und Flüchtlingspolitik vertiefen, aber nicht zu Lasten der Bürgerrechte, sondern durch Stärkung der Freiheit und wirksamen Ausbau der Grundrechte. Daher fordern wir: 1. Europäische Innenpolitik muss rechtsstaatliche Innenpolitik sein Eine wirksame europäische Kooperation bei der Bekämpfung von Terrorismus und Kriminalität ist richtig. Wir wehren uns aber gegen ein Übermaß an Institutionen und Eingriffsbefugnissen und ein Zuwenig an Kontrolle der Sicherheitsapparate. Die Erweiterung europäischer Kompetenzen braucht wirksamen Grundrechtsschutz , Transparenz und demokratische Kontrolle . Europäisierung darf nicht für die Aushöhlung des Rechtsstaats und des Grundrechtsschutzes missbraucht werden. 2. -

1533. Sendung
SEHEN STATT HÖREN ...12. November 2011 1533. Sendung In dieser Sendung: Martin Zierold – erster gehörloser Politiker in Deutschland Reportage aus Berlin-Mitte Gehörloser Abgeordneter Präsentation Anke Klingemann: Hallo, herzlich willkommen bei Sehen statt Hören! Heute steigen wir voll ein in die Politik. Im Mo- ment sind ja viele Bücher von Politikern auf dem Markt, von denen auch einige Bestseller sind. Das Buch, das ich hier vor mir habe, wurde von einer Politikerin geschrieben, die allerdings noch nicht so bekannt ist wie die anderen: Es ist Helene Jarmer, Abgeordnete des Österreichischen Parla- ments und eine der wenigen gehörlosen Politiker in Europa! (Buch groß: „Schreien nützt nichts“) Ein lesenswertes Buch, in dem Frau Jarmer auch ihren Weg beschreibt, wie sie in die Politik ge- kommen ist. In dieser Sendung steht aber nicht sie im Mittelpunkt, sondern ein junger deutscher Politiker. Er hat noch kein Buch geschrieben. Aber er ist der erste Gehörlose, der bisher bei uns in ein politisches Amt gewählt wurde! Alles Weitere erfahren wir jetzt von Thomas Zander aus Ber- lin… Martin Zierold geht mit Dolmetscher zur Martin bei Abstimmung BVV im Rathaus Berlin-Mitte: (Stimme im OFF:) Eindeutig die Mehrheit. Hallo. – Hallo! Schön, dich zu sehen. Geht’s Thorsten Reschke / CDU- dir gut? Fraktionsvorsitzender BVV-Mitte: Ich hab Ja, danke. – Und, aufgeregt? ihn bisher jetzt noch nicht kennenlernen kön- Das bin ich. – Das ist normal. nen, freue mich aber sehr, halte das für einen Zur BVV müssen wir in den 1. Stock, dann großen Vorteil. Es ist jetzt tatsächlich für alle, nach rechts und immer gerade aus. bei jeder Sitzung, wo Herr Zierold mit dabei – Okay, dann lass uns reingehen. -
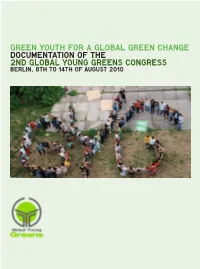
GREEN YOUTH for a GLOBAL GREEN CHANGE Documentation
GREEN YOUTH FOR A GLOBAL GREEN CHANGE Documentation of the 2nd Global Young Greens Congress Berlin, 8th to 14th of August 2010 Dear readers! 3 A short history of the Global Young Greens 4 HISTORY 2nd Congress 8 programmE 9 Regional Meetings 10 Workshops 12 the perspectives of small content scale farming and the agricultural issues 16 Green New Deal – A Concept for a Global Economic Change? 17 Impressions 18 General Assembly of GYG Congress Berlin 2010 20 Summary of our Structure Reform 21 GYG in Action 22 Passed Proposals 23 Statements 25 Participants 26 Introduction of the new Steering Committee 28 Plans 32 THANK-YOU‘S 30 IMPRINT 31 2 global young greens—Congress 2010 Dear readers! We proudly present to you the documentation of the 2nd Global Young Greens Congress held in Berlin from 8th to 14th of August 2010! More than 100 participants from over 50 countries spent five days of discussing as well as exchanging opinions and experiences from their homecountries in order to get closer together and fight with “Youth Power for a Global Green Change“. Workshops, fishbowl discussions and a world café were organised as parts of the congress. The debated topics were endless – reaching from economics and gender issues to social justice, peace and conflicts and - of course - climate change. After three days of debating, two days of General Assem- bly followed. In this, new structures were adopted as well as several topical proposals to form a wider political platform. With this documentation, we are trying to show what the congress was about and what was behind. -

Nachdenkliches Zum Neuen Jahr
Ausgabe 11 - April 2015 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreisverband Heilbronn Nachdenkliches zum neuen Jahr www.gruene-heilbronn.de Neujahresempfang der GRÜNEN in Heilbronn mit Umweltminister Franz Untersteller von Hildegard Eitel E-Mail: [email protected] Kaiserstraße 17 Unter dem Motto „Nach der Wahl ist vor der Wahl“ nahm Susanne Bay auch zu umstrittenen 74072 Heilbronn Themen sowohl in Heilbronn wie auch auf Lan- Tel: 07131-162416 desebene Stellung. Zum Beispiel ging sie genau- er auf den Radweg in der Oberen Neckarstraße Fax: 07131-162435 ein, streifte aber auch die Schulsituation, die Energiewende oder das TTIP-Freihandelsab- Bürozeiten: Di 14 - 17 Uhr kommen. Fr 9 - 12 Uhr Kreisvorstand Alfred Pehrs leitete über zum Hauptvortrag des baden-württembergischen Umweltministers Franz Untersteller. Dieser be- In dieser Ausgabe: tonte, keine Wahlkampfrede halten zu wollen, sondern einen grundsätzlichen Ausblick auf die Seite 1 Umweltminister Franz Untersteller am 27. Februar im „Ratskeller“ Umweltpolitik der kommenden Jahre und Jahr- Nachdenkliches zum Neuen Foto: ape zehnte zu versuchen. Nach über dreißig Jahren Jahr Am 27. 01. 2015 ab 19.00 trafen sich die GRÜ- Umweltpolitik müsse man schon analysieren, Seite 2 NEN des Kreisverbandes Heilbronn im Ratskel- ob die bisherigen Ansätze noch richtig seien. Als dito ler in Heilbronn zu ihrem nun schon traditionel- Beispiel nannte er das Duale System mit dem Bilder vom Neujahrsempfang len Neujahrsempfang. Susanne Bay vom OV Gelben Sack. So wichtig dieses zum Anstoß für Seite 3 Heilbronn konnte ca. 70 Besucher begrüßen, Müllverwertung angesichts damaliger Verpa- darunter den baden-württembergischen Um- ckungsberge und Engpässe auf den Deponien Was tun … weltminister Franz Untersteller, den GRÜNEN- gewesen sei, so zeigten die neuesten Entwick- Bericht von der KMV vom 9. -

16. Bundesversammlung Der Bundesrepublik Deutschland Berlin, 12
16. Bundesversammlung der Bundesrepublik Deutschland Berlin, 12. Februar 2017 Gemeinsame Sitzung des Deutschen Bundestages und des Bundesrates anlässlich der Eidesleistung des Bundespräsidenten Berlin, 22. März 2017 Inhalt 4 16. Bundesversammlung der Bundesrepublik Deutschland 6 Rede des Präsidenten des Deutschen Bundestages, Prof. Dr. Norbert Lammert 16 Konstituierung der 16. Bundesversammlung 28 Bekanntgabe des Wahlergebnisses 34 Rede von Dr. Frank-Walter Steinmeier 40 Gemeinsame Sitzung des Deutschen Bundestages und des Bundesrates anlässlich der Eidesleistung des Bundespräsidenten Dr. Frank-Walter Steinmeier 42 Programm 44 Begrüßung durch den Präsidenten des Deutschen Bundestages, Prof. Dr. Norbert Lammert 48 Ansprache der Präsidentin des Bundesrates, Malu Dreyer 54 Ansprache des Bundespräsidenten a. D., Joachim Gauck 62 Eidesleistung des Bundespräsidenten Dr. Frank-Walter Steinmeier 64 Ansprache des Bundespräsidenten Dr. Frank-Walter Steinmeier 16. Bundesversammlung der Bundesrepublik Deutschland Berlin, 12. Februar 2017 Nehmen Sie bitte Platz. Sehr geehrter Herr Bundespräsident! Exzellenzen! Meine Damen und Herren! Ich begrüße Sie alle, die Mitglieder und Gäste, herzlich zur 16. Bundesversammlung im Reichstagsgebäude in Berlin, dem Sitz des Deutschen Bundestages. Ich freue mich über die Anwesenheit unseres früheren Bundesprä- sidenten Christian Wulff und des langjährigen österreichischen Bundespräsidenten Heinz Fischer. Seien Sie uns herzlich willkommen! Beifall Meine Damen und Herren, der 12. Februar ist in der Demokratiegeschichte unseres Landes kein auffälliger, aber eben auch kein beliebiger Tag. Heute vor genau 150 Jahren, am 12. Februar 1867, wurde ein Reichstag gewählt, nach einem in Deutschland nördlich der Mainlinie damals in jeder Hinsicht revolu- tionären, nämlich dem allgemeinen, gleichen Rede des Präsidenten des Deutschen Bundestages, Prof. Dr. Norbert Lammert 6 und direkten Wahlrecht. Der Urnengang zum konstituierenden Reichstag des Norddeut- schen Bundes stützte sich auf Vorarbeiten der bekannte. -

Erst Konferieren, Dann Reformieren Aus Dem Inhalt
61855 3/2021 europa-union deutschland Aktuelles aus P olitik und Verbandsleben Erst konferieren, und unter dem Titel „Unser föderales Eu- ropa – souverän und demokratisch“ die dann reformieren Vorstellungen und Erwartungen der Eu- ropäischen Föderalisten an die Zukunfts- ind Sie gerade auf dem Weg in den Ur- konferenz formuliert. (Mehr dazu unter: Slaub oder auf der Rückreise? Im zwei- https://www.federalists.eu/media/news) ten Coronajahr sind viele mit dem Auto unterwegs und merken wieder einmal Damit die Zukunftskonferenz erfolgreich schmerzlich: Der Sommer ist die Zeit der sein kann, müssen Bürgerinnen und Bürger Baustellen. Das gilt auch politisch – 2021 und die organisierte Zivilgesellschaft aktiv haben wir in Deutschland gleich zwei mitmachen. „Ihre Ideen und Forderungen davon. Beide sind groß und werden uns sind es, die am Ende des Prozesses ... in den noch eine Weile beschäftigen. Gemeint EU-Verträgen verbindlich festgeschrieben sind die Bundestagswahl im September werden müssen“, fordert der Vorstand der und die Konferenz zur Zukunft Europas, EUD-Parlamentariergruppe im Europaparla- die seit 9. Mai läuft. ment. Also, mischen wir uns ein! Mit Veran- staltungen, Eingaben auf der europaweiten Beide hängen eng zusammen, obwohl Online-Plattform der Konferenz (auf Deutsch die Konferenz offenbar in den Wahlpro- hier: www.futureu.europa.eu/?locale=de) grammen der Parteien keine herausragen- und Social Media Aktionen unter dem Motto de Rolle spielt (mehr dazu auf Seite 4-5). „Zukunft braucht Europa“ werden die Positi- Die interfraktionelle Parlamentariergruppe onen der Europa-Union in das Konferenzge- der Europa-Union Deutschland im Deut- schehen eingespeist und in die Öffentlichkeit schen Bundestag – immerhin bestehend getragen. Auch Sie können sich direkt in die aus 179 Abgeordneten! – positionierte Debatte einbringen. -

Commentary by Miriam Saage-Maaβ Vice Legal Director & Coordinator of Business & Human Rights Program European Center for Constitutional and Human Rights July 2012
How serious is the international community of states about human rights standards for business? commentary by Miriam Saage-Maaβ Vice Legal Director & coordinator of Business & Human Rights program European Center for Constitutional and Human Rights July 2012 Recent developments have shown one more time that the struggle for human rights is not only about the creation of international standards so that the rule of law may prevail. The struggle for human rights is also a struggle between different economic and political interests, and it is a question of power which interests prevail. 2011 was an important year for the development of standards in the field of business and human rights. In May 2011 the OECD member states approved a revised version of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, introducing a new human rights chapter. Only a month later the United Nations Human Rights Council (UNHRC) endorsed by consensus the UN Guiding Principles on Business and Human Rights.1 These two international documents are both designed to provide a global standard for preventing and addressing the risk of business-related human rights violations. In particular, the UN Guiding Principles focus on the “State Duty to Protect” and the “Corporate Responsibility to Respect” in addition to the “Access to Remedy” principle. This principle seeks to ensure that when people are harmed by business activity, there is both adequate accountability and effective redress, both judicial and non-judicial. The Guiding Principles clearly call on states to ensure -

Plenarprotokoll 16/220
Plenarprotokoll 16/220 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 220. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 7. Mai 2009 Inhalt: Glückwünsche zum Geburtstag der Abgeord- ter und der Fraktion DIE LINKE: neten Walter Kolbow, Dr. Hermann Scheer, Bundesverantwortung für den Steu- Dr. h. c. Gernot Erler, Dr. h. c. Hans ervollzug wahrnehmen Michelbach und Rüdiger Veit . 23969 A – zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Barbara Höll, Dr. Axel Troost, nung . 23969 B Dr. Gregor Gysi, Oskar Lafontaine und der Fraktion DIE LINKE: Steuermiss- Absetzung des Tagesordnungspunktes 38 f . 23971 A brauch wirksam bekämpfen – Vor- handene Steuerquellen erschließen Tagesordnungspunkt 15: – zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. a) Erste Beratung des von den Fraktionen der Barbara Höll, Wolfgang Nešković, CDU/CSU und der SPD eingebrachten Ulla Lötzer, weiterer Abgeordneter Entwurfs eines Gesetzes zur Bekämp- und der Fraktion DIE LINKE: Steuer- fung der Steuerhinterziehung (Steuer- hinterziehung bekämpfen – Steuer- hinterziehungsbekämpfungsgesetz) oasen austrocknen (Drucksache 16/12852) . 23971 A – zu dem Antrag der Abgeordneten b) Beschlussempfehlung und Bericht des Fi- Christine Scheel, Kerstin Andreae, nanzausschusses Birgitt Bender, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE – zu dem Antrag der Fraktionen der GRÜNEN: Keine Hintertür für Steu- CDU/CSU und der SPD: Steuerhin- erhinterzieher terziehung bekämpfen (Drucksachen 16/11389, 16/11734, 16/9836, – zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. 16/9479, 16/9166, 16/9168, 16/9421, Volker Wissing, Dr. Hermann Otto 16/12826) . 23971 B Solms, Carl-Ludwig Thiele, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der Lothar Binding (Heidelberg) (SPD) . 23971 D FDP: Steuervollzug effektiver ma- Dr. Hermann Otto Solms (FDP) . 23973 A chen Eduard Oswald (CDU/CSU) . -

COP Side Events
BELOW 2°C TOGETHER WE’LL MAKE IT! 2°COP 21 PARIS | 5 - 11 December 2015 Side events at the German Pavilion Hall 2B | No 51 Version: 10.12.2015 10:00 Uhr The information in this brochure is subject to change. Please refer to the latest version online: http://www.bmub.bund.de/cop-events Programme Climate Action in Practice Saturday, 5 December ............................................................................................2 Shaping the Energy Transition Monday, 7 December .............................................................................................4 Building Resilience Tuesday, 8 December .............................................................................................7 The Low Emission Path Wednesday, 9 December .................................................................................... 10 Local & Regional Climate Action Thursday, 10 December ...................................................................................... 13 Managing Risks Friday, 11 December ............................................................................................ 16 | 1 Saturday, 5 December, 10:00-11:30 Climate, Soil, Biomass – Championing Sustainable Production of Raw Materials Christian Schmidt, Federal Minister of Food and Agriculture, Germany Jean-Christophe Roubin, Ministry of Agriculture, France Prof Dr Klaus Töpfer, former Executive Director of UNEP Martina Fleckenstein, Director of EU Policy, Agriculture & Sustainable Biomass of WWF Alison Cairns, Global Advocacy Director for Sustainable -

„Jenseits Unseres Milieus“ SPIEGEL-Gespräch Katrin Göring-Eckardt, 50, Und Cem Özdemir, 51, Möchten Die Grünen Zu Einer Neuen Volkspartei Formen
Spitzenduo Özdemir, Göring-Eckardt L E G E I P S R E D / L E Z N E D O C S E J „Jenseits unseres Milieus“ SPIEGEL-Gespräch Katrin Göring-Eckardt, 50, und Cem Özdemir, 51, möchten die Grünen zu einer neuen Volkspartei formen. Sie wollen weniger moralisieren und sich auch um die Industrie kümmern. SPIEGEL: Frau Göring-Eckardt, Herr Özde - und Leuten in der Berliner Blase, uns Grüne schiedene Wurzeln: die Ökobewegung, die mir, mit Ihrem Sieg bei der Urwahl führen in bestimmte Schubladen stecken zu wollen. Frauenbewegung, die Pazifisten, die Bür - jetzt zwei Realos die Grünen in die Bun - Da draußen interessiert es kein Schwein, ob gerrechtler … destagswahl. Wie wollen Sie den Eindruck ein Grüner ein Linker ist oder ein Realo. SPIEGEL: … die sich fast alle als linke Be - verhindern, die Grünen seien nun eine Art Die Leute wollen viel lieber wissen, welche wegungen verstanden haben. CDU mit Krötenschutzprogramm? Angebote sie von uns bekommen. Göring-Eckardt: Nicht alle. Ich komme aus Göring-Eckardt: Sehr originell! Man kann SPIEGEL: Wir dachten, die Grünen seien im der Bürgerbewegung in der DDR, und das am Ergebnis der Urwahl gut sehen, dass Kern eine linke Partei. hat nichts mit links oder nicht links zu tun. die Partei längst nicht mehr in alten Scha - Göring-Eckardt: Wenn Sie uns als Partei mit Die Grünen sind etwas Eigenes. blonen von links oder nicht links denkt. einer klaren Gerechtigkeitsagenda ver - Özdemir: Als ich 2003 ein Jahr in den USA Das ist sehr erfreulich. orten, liegen Sie richtig. Dafür stehe ich. war, habe ich dort immer gesagt, die Grü - Özdemir: Also, erst einmal gibt es nichts Aber ich sage, wir passen nicht in Schub - nen seien eine „progressive party“. -

Kettenduldungen Abschaffen
Deutscher Bundestag Drucksache 16/687 16. Wahlperiode 16. 02. 2006 Antrag der Abgeordneten Josef Philip Winkler, Volker Beck (Köln), Britta Haßelmann, Monika Lazar, Jerzy Montag, Claudia Roth (Augsburg), Irmingard Schewe-Gerigk, Hans-Christian Ströbele, Silke Stokar von Neuforn, Wolfgang Wieland und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kettenduldungen abschaffen Der Bundestag wolle beschließen: I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: Die Anwendung des § 25 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) durch die Länder steht nicht in Einklang mit dem Ziel des Gesetzgebers, die Kettenduldungen ab- zuschaffen. II. Der Bundestag fordert die Bundesregierung daher auf, folgende Maßnahmen zu treffen: 1. Die Bundesregierung sorgt gegenüber den Bundesländern bis Ende März 2006 für eine Klarstellung in den vorläufigen Anwendungshinweisen des Bundesministeriums des Innern, die dem Ziel des Gesetzgebers entspricht. Hierin sind insbesondere die Zumutbarkeit einer Ausreise sowie die beson- dere Situation in Deutschland aufgewachsener Kinder und Jugendlicher zu berücksichtigen. 2. Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundestag zeitnah einen Gesetz- entwurf zur Änderung von § 25 Abs. 5 AufenthG vor, der der Intention des Gesetzgebers gerecht wird, wenn auf dem vorgenannten Weg keine Ände- rung der Praxis der Bundesländer zu erreichen ist. Berlin, den 15. Februar 2006 Renate Künast, Fritz Kuhn und Fraktion Begründung Der ehemalige Bundesminister des Innern, Otto Schily, hatte in der Debatte zur Verabschiedung des Zuwanderungsgesetzes vor dem Deutschen Bundestag er- -

GERMAN GREENS in COALITION GOVERNMENTS a Political Analysis
GERMAN GREENS IN COALITION GOVERNMENTS A Political Analysis by Arne Jungjohann 1 GERMAN GREENS IN COALITION GOVERNMENTS A Political Analysis A Political Analysis A Political German Greens in Coalition Governments German Greens in Coalition Governments A Political Analysis By Arne Jungjohann Published by the Heinrich-Böll-Stiftung European Union English version published with the support of the Green European Foundation About the author CONTENTS Arne Jungjohann is an energy analyst and political scientist. He advises foundations, think tanks, and civil society in communication and strategy building for climate and energy policy. Previously, he worked for Minister President Winfried Kretschmann of Baden-Württemberg, the Heinrich Böll Foundation in Washington DC, in the German Bundestag, and in the family owned business. As its editor he launched the most influential English Twitter account on the German Energiewende (@ EnergiewendeGER). He co-authored ‘Energy Democracy: Germany’s Energiewende to Renewables’ Foreword 7 (Palgrave Macmillan 2016). Arne is a member of the Green Academy, a network with leading thinkers Foreword by the author 9 from science, politics and civil society which is facilitated by the Heinrich-Böll-Stiftung. He is the founder of the local chapter of the German Green Party in Washington DC and lives in Stuttgart. He studied at Philipps University Marburg and at the Free University of Berlin. 1 Introduction 11 1.1 State of the research and sources used 12 1.2 Lead Questions and Composition of the Study 14 2 Coalition Constellations 15 3 The Coalition Arena at State Level 19 3.1 Departmental Responsibilities of the Greens 19 3.2 Coalition Management in the G-states 26 3.2.1 The Bundesrat Clause 27 3.2.2 Coalition Personnel 28 3.2.3 Coalition Committees 30 You are free to share – copy and redistribute the material in any medium or format and adapt – remix, transform, and build upon the material.