1226 Boltigen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Wandern & Erlebnisse
TROTTI-BIKEN AM STOCKHORN BUNGEE JUMPING AM STOCKHORN TALMUSEUM AGENSTEINHAUS WEISSENBURG BAD HÄNGEBRÜCKE LEITERNWEIDE HÖHLENPFAD Das neue Kombi-Angebot Bahnfahrt und Trotti-Bike-Miete bietet Ein Sprung aus der Seilbahnkabine in 134 m Höhe über dem Ein Höhepunkt der Zimmermannskunst in Erlenbach Die über 400-jährige Geschichte eines einzigartigen Ortes Nervenkitzel auf 111 m Länge, 111 m über der Schlucht Höhlen in Oberwil: Zwärgliloch, Schnurenloch und Mamilchloch eine tolle Abwechslung mit Schwung ins Tal zu gelangen. Hinterstockensee ist ein spezieller Nervenkitzel. Interessante Ausstellungen geben einen Einblick ins Leben einer Beim Besuch des ehemaligen Weissenburg Bads tauchen Sie in Schon die Wanderung zur Hängebrücke ist wunderschön. Auf der So heissen drei Höhlen, die von kleinen und grossen Höhlenfor- Ab der Alp Vorderstocken können Trotti-Bikes gemietet werden. Wer das Abenteuer liebt, wird diesen extremen Adrenalinkick in Familie in früheren Zeiten. Das Haus wurde 1766 von Hans Messerli die mystische Welt eines naturbelassenen Alpentals ein. Sie 111 m langen Hängebrücke dürfte dann das Bauch kribbeln nicht schern entdeckt werden können. Hier wurden einst die ältesten Es stehen Helme (in zwei Grössen) zur Verfügung. Gönnen Sie sich spektakulärer Umgebung geniessen. erbaut, dem bedeutendsten Zimmermannmeister im Simmental er leben einen Ort, an dem mehr als 400 Jahre eine hochstehende lange auf sich warten lassen. 111 m tiefer schlängelt sich der von Menschenhand gefertigten Steinwerkzeuge des Kantons Bern WANDERN & ERLEBNISSE diesen Fahrspass! Die Jumps finden abends vor dem Sonnenuntergang statt. des 18. Jahrhunderts. Es blieb bis heute weitgehend im damaligen Badekultur gelebt wurde. Beim Besuch der Ruinen können Sie Buuschebach durch die Schlucht. Nach der Hängebrücke geht es gefunden. -

Fribourg Region the Leisure Activities and Discoveries Guide Welcoming Delicious Unexpected 2019
FRIBOURG REGION THE LEISURE ACTIVITIES AND DISCOVERIES GUIDE WELCOMING DELICIOUS UNEXPECTED 2019 THE UNEXPECTED THE NOCTURNAL ADVENTURES OF BEAVERS EXPERIENCE i'VE EXPERIENCED: AN EXTRAORDINARY ADVENTURE PASSION KEEPING WALKERS ON THE RIGHT TRACK... ALONG 1800 KM OF PATHWAYS! www.fribourgregion.ch 2 FRIBOURG REGION IT'S DZ¡N ! Discover unique activities and inspiring encounters with local MEADOWS: people. Create memories NATURE’S as a group or individual, TREASURES for children and adults alike. www.dzin.ch PAGE 4 CONTENTS Meadows: nature’s treasures ........................ 4 Hiking in Fribourg Region, Aline Hayoz-Andrey accompanies amateur botanists the joy factor! ................................................ 20 I've experienced: an extraordinary Life is a beautiful walk ...................................22 adventure ....................................................... 8 The Trans Swiss Trail, a shared long-distance project Jean-Claude Pesse perpetuates an ancestral tradition Keeping walkers on the right track... “The philosophical sweeper” .......................10 along 1800 km of pathways! ...................... 26 Interview with Michel Simonet on the streets of Fribourg The diligent professionals who maintain the waymarks The nocturnal adventures Valuable advice from Bruno Jelk ................ 28 of beavers ....................................................... 14 A leading expert on safety in the mountains Nature and people get along together in the Grande Cariçaie A visit to Romont that’s full of surprises ....................................................32 -
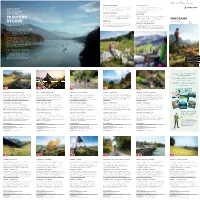
FACE TEXTES.Indd
LA GRUYÈRE SCHWARZSEE ROMONT LES PACCOTS FRIBOURG ESTAVAYER-LE-LAC MURTEN/MORAT RANDONNÉES EN FAMILLE GITES ET BUVETTES Fribourg Région regorge d’aventures et de divertissements originaux Les chalets d’alpages ornent les Préalpes fribourgeoises et se pour petits et grands. Frissonner de plaisir en tyrolienne ou respirer caractérisent par une activité agricole bien vivante. Certains proposent BIENVENUE profondément la tête dans les nuages, tout est possible, la nature est d’assister à la fabrication du Gruyère AOP, d’autres o rent le gîte, à portée de main. www.fribourgregion.ch/famille un grand nombre permettent de goûter aux spécialités du terroir. WILLKOMMEN www.fribourgregion.ch/gites FAMILIENWANDERUNGEN BERGHÜTTEN WELCOME In der Region Freiburg warten viele spannende Abenteuer und originelle Aktivitäten auf Klein und Gross. Adrenalingeladene Action auf einer In den Alp-Chalets der Freiburger Voralpen werden landwirtschaftliche Seilrutsche oder einfach mal tief durchatmen und neue Kraft schöpfen Traditionen gelebt. Einige bieten Besuchern die Möglichkeit, FRIBOURG – in der Natur ist alles möglich. www.fribourgregion.ch/familie bei der Herstellung von Le Gruyère AOP mitzuhelfen, andere haben Gästezimmer und in vielen kann man regionale Spezialitäten PANORAMA REGION FAMILY WALKS verkosten. www.fribourgregion.ch/alphuetten CARTE / KARTE / MAP Fribourg Region is full of adventures and unusual entertainments ALPINE HUTS AND RESTAURANTS for young and old alike. Anything is possible, from the thrill of a zip line En randonnée à pied, en VTT ou à vélo dans les to taking a deep breath with your head in the clouds, all with nature Alpine chalets are dotted all over the Fribourg Pre-Alps and refl ect paysages de Fribourg Région, l’instant présent at your fi ngertips. -

Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis Zum Geleit 8 Vorwort der Autoren 10 Übersichtskarte des Kantons Freiburg 12 Zum Gebrauch des Führers 14 Sicherer unterwegs im Sommer 18 Informationen Sommer 24 Die Wanderskala des SAC 26 SAC-Schwierigkeitsskalen 28 Gipfel nach Schwierigkeiten 30 Literatur 34 Erste Hilfe 36 Umweltfreundlich unterwegs 38 Geologie 42 Le Moleson 52 1.1 Le Molöson 56 1.2 Teysachaux - Le Molfeson 60 1.3 Niremont - Les Alpettes 64 1.4 Les Deux Dents - La Vudalla 68 1.5 DentdeLys 72 1.6 Vanil Blanc - Grand Sex - Dent de Lys 76 1.7 Folliu Borna - Vanil des Artses - Cape au Moine - Corb£ 80 1.8 Dent de Hautadon - Grande Chaux de Naye 86 1.9 DentdeCorjon 90 Höhlenforscher auf dem Gipfel 94 Vanil Noir 96 2.1 DentdeBroc 100 2.2 Dent de Broc - Dent du Chamois - Dent du Bourgo 104 2.3 Les Merlas - Le Van -Tsermon - Le Curtillet 108 5 http://d-nb.info/1044260629 Inhaltsverzeichnis 2.4 Vanil Noir 112 2.5 Vanil Noir - Vanil de l'Ecri - Pointe de Paray 116 2.6 Les Millets 122 2.7 L'Aiguille - Chaux de Culand - Pointe du Chevrier 126 2.8 Pointe de Cray - Pra de Cray - Vanil Carre - Gros Perrö 130 2.9 Dent de Brenleire - Dent de Folliöran 136 2.10 Dent de Brenleire - Vanil Noir - Tour de Dorena - Dent des Bimis 142 2.11 Gros Haut Cr§t Sud - Vanil de la Monse 146 Zur Höhenmessung der Freiburger Gipfel 150 Gastlosen 156 3.1 Hochmatt - Cheval Blanc 160 3.2 Oberrügg - Brendelspitz - Brendel 164 3.3 Gratflue - Gastlosenspitze - Marchzähne - Eggturm 168 3.4 Rüdigenspitze - Wandflue - Zuckerspitz 174 3.5 Dent de Ruth - Dent de Savigny - Vanil de la Gobette 180 -
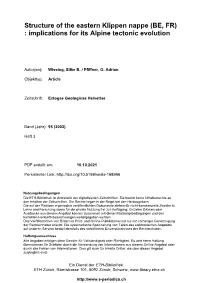
Structure of the Eastern Klippen Nappe (BE, FR) : Implications for Its Alpine Tectonic Evolution
Structure of the eastern Klippen nappe (BE, FR) : implications for its Alpine tectonic evolution Autor(en): Wissing, Silke B. / Pfiffner, O. Adrian Objekttyp: Article Zeitschrift: Eclogae Geologicae Helvetiae Band (Jahr): 95 (2002) Heft 3 PDF erstellt am: 10.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-168966 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch 0012-9402/02/030381-18 Eclogae geol. Helv. 95 (2002) 381-398 Birkhäuser Verlag, Basel, 2002 Structure of the eastern Klippen nappe (BE, FR): Implications for its Alpine tectonic evolution Silke B.Wissing1 & O.Adrian Pfiffner Key words: Préalpes. Klippen nappe. -

Entwicklung Und Effizienz Des Herdenschutzes in Den Nordwestlichen Voralpen 2009 – 2012
Entwicklung und Effizienz des Herdenschutzes in den nordwestlichen Voralpen 2009-2012 ENTWICKLUNG UND EFFIZIENZ DES HERDENSCHUTZES IN DEN NORDWESTLICHEN VORALPEN 2009 – 2012 Bericht zuhanden Herdenschutzhunde Schweiz HSH-CH Entwicklung und Effizienz des Herdenschutzes in den nordwestlichen Voralpen 2009-2012 INHALTSVERZEICHNIS Zusammenfassung .................................................. 1 1 Einleitung ............................................................ 2 2 Methoden ............................................................ 4 3 Resultate ............................................................ 9 4 Diskussion ......................................................... 19 Literatur .............................................................. 22 IMPRESSUM Titel Entwicklung und Effizienz des Herdenschutzes in den nordwestlichen Voralpen 2009 – 2012. Auftraggeber Herdenschutzhunde Schweiz HSH-CH Verantwortlich Felix Hahn Auftragnehmer FaunAlpin GmbH, Böcklinstr. 13, 3006 Bern www.faunalpin.ch Autoren Christian Willisch, Dr. sc. nat. (FaunAlpin) Francois Meyer, Master en biologie (HSH-CH) Ueli Pfister, Dr. sc. nat. (HSH-CH) Layout & Redaktion FaunAlpin GmbH, Bern Titelbild: Maremmano Abruzzese, im Hintergrund eine Herde Schafe (Foto R. Lüthi, AGRIDEA) Bezugsquelle FaunAlpin GmbH, Böcklinstr. 13, 3006 Bern Copyright © April 2013, FaunAlpin DANK Die Studie wurde im Auftrag des Vereins Herdenschutzhunde Schweiz HSH-CH durchgeführt. Finanziert wurde die Arbeit vom Bundesamt für Umwelt BAFU. Gedankt sei daher den beiden Verantwortlichen -

Fribourg Region Press Kit
LA GRUYÈRE | LES PACCOTS | SCHWARZSEE | FRIBOURG/FREIBURG | ROMONT | ESTAVAYER-LE-LAC | MURTEN/MORAT 2019 FRIBOURG REGION PRESS KIT www.fribourgregion.ch CONTENTS 3 Traditions 8 Culinary Delights 13 Culture and History 18 Nature Lovers 23 Active Outdoors 29 Autumn 32 Winter 36 dzin.ch 38 Spiritual Spaces – 2 – TRADITIONS PRESERVING FRIBOURG’S HERITAGE In Fribourg Region, living traditions are still primarily naturally on the centuries-old transhumant culture with rooted in the daily life of the inhabitants. Their value its colourful Alpine ascents and descents, varied crafts for social cohesion is recognised and awareness and workmanship. Catholic traditions with numerous of cultural heritage is part of the school curriculum. processions and the ubiquitous choral singing, as Customs are also appreciated by visitors from all over well as historic anniversaries with patriotic and military the world, who often witness scenes that seem to connotations, are very popular. More information is originate from a bygone age. An inventory of the living available at www.lebendige-traditionen.ch traditions of Fribourg Region was made under the www.fribourgregion.ch auspices of the Musée gruérien in Bulle and divided into four main groups. For visitors, the emphasis is FRIBOURG CULTURE, A LIVING TRADITION Poya painting: In the Fribourg patois, the syllables “po-ya” signify the May singing: On May 1st or the day Alpine ascent in early summer, when the cows and goats are driven to before, the children of Fribourg higher Alpine pastures. However, it is now understood to mean the visual go from house to house, singing representation of this important and symbiotic event. -

10 Minutes with David Zurcher Julien Absalon – a Rider Re-Born The
Who we are Riders History 10 Minutes Julien Absalon – The BMC with David Zurcher a Rider Re-born Altitude Series Ride BMC2017 | EN Ride BMC Table of Contents 4 8 Who we are Riders 10 Minutes Enduro Riders – with David Zurcher the Same...yet Different 18 26 What’s New Innovation The Roadmachine: Riding Beyond the Peloton The Art of Aero 38 52 Riders History Julien Absalon – The BMC Altitude Series a Rider Re-born 64 74 MY17 Technology Bike Overview The Differentiator MY17 Collection 5 Who we are 10 Minutes with David Zurcher It’s day two of the ‘Schwiiz Tour’, a three-day ride organized by BMC for its employees, and David Zurcher just rode up the breath-taking but grueling Jaun Pass. All part of a typical day in the life of the Chief Executive Officer of BMC? No. But nevertheless, David Zurcher is not your typical CEO... 6 7 Who we are Who we are We are at the top of a pretty steep Alpine pass in this available to every rider. When you ride a BMC the French-speaking Vaud region of Switzerland, and bike, we want you to think “wow, this is amazing... David Zurcher is at his happiest...on a bike. A pas- how it handles, accelerates, climbs, corners” we stop sionate cyclist, his roots lie in motocross and moun- at nothing to achieve this ride feeling. Iteration after tain biking, which is what led him to the bike indus- iteration and the stringent testing procedures of pro- try almost two decades ago. -

Interactions Between Tectonics and Surface Processes in the Alpine Foreland: Insights from Analogue Model and Analysis of Recent Faulting
GeoFocus volume 17 Cécile BONNET Interactions between tectonics and surface processes in the Alpine foreland: Insights from analogue model and analysis of recent faulting Dent de Bimis fault (Vanil Noir area) Crystalline Penninic Molasse Prealpes massifs nappes klippen Jura basin Département de Géosciences, Géologie et Paléontologie, Université de Fribourg (Suisse) DÉPARTEMENT DE GÉOSCIENCES – GÉOLOGIE ET PALÉONTOLOGIE UNIVERSITÉ DE FRIBOURG (SUISSE) Interactions between tectonics and surface processes in the Alpine foreland: Insights from analogue model and analysis of recent faulting THÈSE présentée à la Faculté des Sciences de l’Université de Fribourg (Suisse) pour l’obtention du grade de Doctor rerum naturalium Cécile BONNET de Villecerf, France Thèse N° 1551 Multiprint, Fribourg, 2007 Acceptée par la Faculté des Sciences de l’Université de Fribourg (Suisse) sur la proposition de: Dr. Jon MOSAR Université de Fribourg (Suisse) Directeur Dr. Jacques MALAVIEILLE Université de Montpellier (France) Co-directeur Prof. Maurice BRUNEL Université de Montpellier (France) Expert Prof. André STRASSER Université de Fribourg (Suisse) Président du Jury Fribourg, le 02 février 2007 A la mémoire de Martin Burkhard Contents - 1 CONTENTS ABSTRACT ____________________________________ 3 3 - SURFACE PROCESSES VERSUS KINEMATICS OF RÉSUMÉ _____________________________________ 5 THRUST BELTS: RATES OF EROSION, SEDIMENTA- ZUSAMMENFASSUNG _____________________________ 7 TION, AND EXHUMATION - INSIGHTS FROM ANA- REMERCIEMENTS _______________________________ 9 -

Fribourg Region the Leisure Activities and Discoveries Guide Welcoming Delicious Unexpected 2018
FRIBOURG REGION THE LEISURE ACTIVITIES AND DISCOVERIES GUIDE WELCOMING DELICIOUS UNEXPECTED 2018 FULFILMENT WALKING MAKES YOU SMILE ! IT HAS BEEN SCIENTIFICALLY PROVEN ADRENALINE MOUNTAIN BIKING, A STATE OF MIND! SLOW FOOD IN SEARCH OF AUTHENTIC FLAVOUR www.fribourgregion.ch 2 FRIBOURG REGION CONTENTS THE STREET WITH A CLICK, YOUR WHERE FRIBOURG ADVENTURE BEGINS! REINVENTS ITSELF PAGE 20 PAGE 16 An original blend : Walking makes cyclist and wine grower 4 you smile! 22 A keen sportsman at the Domaine Scenery as important as the du Vieux Moulin effort involved In search of Three little turns authentic flavour 8 and then take flight 24 The traditional delights of the Four de Your mind and body have never l'Adde bakery in Cerniat felt so light Mountain biking, The secret blast of a state of mind ! 10 the Alpine horn 26 Pedal your way to nature Samuel Descloux reveals the mysteries of the Alpine horn Mustards of the abbey 13 Island charm at the lakeside 28 A place of peace and innovation Drop anchor at Estavayer-le-Lac, The street where as though at sea Fribourg reinvents itself 16 A roof made entirely The trendy district for designers of wood 32 and foodies Léon Doutaz keeps a traditional craft alive What is Dzin? 20 Online 35 A truly unique experience FRIBOURG REGION 3 IN SEARCH OF AUTHENTIC ISLAND CHARM FLAVOUR AT THE LAKESIDE PAGE 8 PAGE 28 EDITORIAL Publisher THE LOCALS FRIBOURG REGION OF FRIBOURG INVITE Layout YOU TO JOIN THEM So Graphic Studio, Bulle Editorial Mélanie Rouiller, Susi Schildknecht The region of Fribourg is teaming with experiences to enjoy in good company. -

GRAND TOUR of SWITZERLAND - the CLASSIC - SELF DRIVE (11610) 浗st Gallen
VIEW PACKAGE PEACE OF MIND BOOKING PLAN GRAND TOUR OF SWITZERLAND - THE CLASSIC - SELF DRIVE (11610) 浗St Gallen Revel in Switzerland’s breathtaking scenery of snow-capped mountains, alpine lakes and lush countryside during this thrilling, 12-day self-drive tour from Zurich to Lucerne. Duration Switzerland 11 nights 㳖 CULTURAL 䤾 SELF-DRIVE Destinations 䚀 INDEPENDENT HOLIDAY PACKAGES Switzerland Travel Departs Highlights Zurich Explore Montreux, Interlaken, Lucerne Principality of Liechtenstein Travel Ends and Bern Zurich Discover Heidi’s Village Explore the village of Zermatt Experiences Cultural, Self-Drive Take a tour of Switzerland with a self-driving holiday. This thrilling, 12-day tour will take you to some of the most beautiful regions past the majestic mountains, beautiful lakes, historic towns and villages. Travel Style Independent Holiday Packages Your journey starts from Zurich, drive through the medieval town of Winterthur past the Rhine Falls. Continue along the banks of Lake Constance until you reach the charming city of St. Gallen, famed for its historic abbey and library. From St. Gallen, continue to the rolling hills of the Appenzell region. Make a short stop in Liechtenstein, one of Europe’s smallest countries before heading back to Switzerland. Continue to the ski resort town of Davos then drive through the Graubünden region until you reach the Ticino region. From Lugano, head to Täsch then to the famous resort town of Zermatt. Continue to the French-speaking region of Switzerland until you reach the lovely town of Montreux located in Lake Geneva. Drive through the vineyards of Lavaux towards Gruyères. Enter the Bernese Oberland region until you reach Interlaken. -

Fribourg Region the Leisure Activities and Discoveries Guide Welcoming Delicious Unexpected
FRIBOURG REGION THE LEISURE ACTIVITIES AND DISCOVERIES GUIDE WELCOMING DELICIOUS UNEXPECTED Fine food FINGERS IN THE CHOCOLATE GÉRALDINE MARAS, THE BEST WOMAN CHOCOLATE-MAKER IN THE WORLD Experience PASSIONATE ABOUT GOATS Sensory THE WHOLE WORLD IN A GARDEN www.fribourgregion.ch 2 FRIBOURG REGION CONTENTS “IF I WAS A WINE, I WOULD BE A FREIBURGER” PAGE 15 Cherry jam and Aperitif and Gruyère d’Alpage 4 sculpture 20 In the cool of the Marc Bucher’s family Murith’s chalet creative aperitifs Sharing his love The Chalet du Soldat 24 for the mountains 8 A view over the Gastlosen, Raoul Colliard in his Alpine a climbers’ paradise restaurant, La Saletta The tightrope walker Passionate who loves to be free 26 about goats 10 Hugo Minnig defies the Ursula Raemy’s laws of gravity 120 adorable goats The whole world The dawn in a garden 28 fisherman 12 Go barefoot with Fréderic Perritaz A boat trip with on a sensory journey Claude Delley Online 31 “If I was a wine I would be a Freiburger” 15 Fabrice Simonet, oenologist for the Petit Château family business Fingers in the chocolate 18 Géraldine Maras, the best woman chocolate-maker in the world FRIBOURG REGION 3 THE TIGHTROPE WALKER WHO LOVES TO BE FREE PAGE 26 APERITIF AND 12 La désalpe SCULPTURE en Gruyère PAGE 20 Editorial Publisher PEAKS OF FRIBOURG REGION Layout ADVENTURE AND Agence Symbol, Châtel-St-Denis Editorial A SIESTA BENEATH Mélanie Rouiller, Susi Schildknecht THE TREES Pictures Pascal Gertschen, Mélanie Rouiller, Nicolas Geinoz, Eric Fookes, Aurélie Felli, Free4style, Anthony Demierre, Marc-André Marmillod, In a world where everything keeps getting faster, Claude-Olivier Marti, Elise Heuberger, rediscover the joy of the moment, with your feet Nicolas Repond, Agence Symbol, Switzerland Tourism, Tourist Offices in a stream or your head in the clouds at the top of FRIBOURG REGION, of a mountain.