Bundesparteitag Bochum 2003 17.–19
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Financial Report 2012 of NRW.BANK
United Nations Global Compact Communication on Progress Financial Report 2012 Financial Report 2012 of NRW.BANK Contents 2 Corporate Responsibility 32 Report on Public Corporate Governance 51 Report of the Supervisory Board 52 Management Report 86 Balance Sheet 90 Profit and Loss Account 92 Notes 118 Cash Flow Statement 120 Equity Capital 121 Reproduction of the Auditor’s Report 122 Responsibility Statement 123 Members of the Advisory Board for Housing Promotion 126 Members of the Advisory Board 130 Organisation Chart 132 NRW.BANK at a Glance Financial Report 2012 1 Corporate Responsibility Corporate Responsibility In fulfilling its role as the development bank for the state of North Rhine-Westphalia, NRW.BANK activities, starting from its strategic and business acknowledges its corporate responsibility. The Bank policy decisions to the shaping of its range of understands the concept of corporate responsibility as products and services down to the implementation a transparent, responsible and living process involving of specific financings, its capital market activities its customers, its employees and society at large. In and its offering of consulting services. this context, the Bank believes that the economical, 2. One of the essential cornerstones of the ecological and social dimensions of sustainability are sustainability strategy pursued by NRW.BANK inseparably linked. is transparent and responsible treatment of its owner, customers, employees and its stake- Since 2008, the “Principles of Corporate Responsibility holders at large. NRW.BANK lives up to this at NRW.BANK” have defined the framework for commitment based on its Public Corporate NRW.BANK’s approach to sustainability. Besides basic Governance Code. -

Worlds Apart: Bosnian Lessons for Global Security
Worlds Apart Swanee Hunt Worlds Apart Bosnian Lessons for GLoBaL security Duke university Press Durham anD LonDon 2011 © 2011 Duke University Press All rights reserved Printed in the United States of America on acid- free paper ♾ Designed by C. H. Westmoreland Typeset in Charis by Tseng Information Systems, Inc. Library of Congress Cataloging- in- Publication Data appear on the last printed page of this book. To my partners c harLes ansBacher: “Of course you can.” and VaLerie GiLLen: “Of course we can.” and Mirsad JaceVic: “Of course you must.” Contents Author’s Note xi Map of Yugoslavia xii Prologue xiii Acknowledgments xix Context xxi Part i: War Section 1: Officialdom 3 1. insiDe: “Esteemed Mr. Carrington” 3 2. outsiDe: A Convenient Euphemism 4 3. insiDe: Angels and Animals 8 4. outsiDe: Carter and Conscience 10 5. insiDe: “If I Left, Everyone Would Flee” 12 6. outsiDe: None of Our Business 15 7. insiDe: Silajdžić 17 8. outsiDe: Unintended Consequences 18 9. insiDe: The Bread Factory 19 10. outsiDe: Elegant Tables 21 Section 2: Victims or Agents? 24 11. insiDe: The Unspeakable 24 12. outsiDe: The Politics of Rape 26 13. insiDe: An Unlikely Soldier 28 14. outsiDe: Happy Fourth of July 30 15. insiDe: Women on the Side 33 16. outsiDe: Contact Sport 35 Section 3: Deadly Stereotypes 37 17. insiDe: An Artificial War 37 18. outsiDe: Clashes 38 19. insiDe: Crossing the Fault Line 39 20. outsiDe: “The Truth about Goražde” 41 21. insiDe: Loyal 43 22. outsiDe: Pentagon Sympathies 46 23. insiDe: Family Friends 48 24. outsiDe: Extremists 50 Section 4: Fissures and Connections 55 25. -

Politikszene 19.4
politik & Ausgabe Nr. 88 kommunikation politikszene 19.4. – 25.4.2006 Schmidt-Deguelle schließt sich WMP an Klaus-Peter Schmidt-Deguelle (55) arbeitet ab sofort als freier Berater („associated partner“) für die WMP Eurocom AG. Der Journalist und Staatssekretär a.D. war langjähriger Berater von Ex-Finanzmi- nister Hans Eichel, dem er schon in Hessen als Regierungssprecher diente. Später beriet Schmidt-Deguelle auch den ehemaligen Arbeitsminister Walter Riester. Er war außerdem Chefredakteur von VOX und Leiter der „ARD-Aktuell“-Redaktion des Hessischen Rundfunks. K.-P. Schmidt-Deguelle Bundestagsverwaltung organisiert sich neu Hans-Joachim Stelzl wird ab Mai neuer Direktor beim Deutschen Bundestag. Er folgt auf Wofgang Zeh, der sich in den Ruhestand verabschiedet. Stelzl leitete zuletzt die Abteilung „Zentrale Dienste“ in der Bundestagsverwaltung. In dieser Position folgt ihm Erdmute Rebhan nach, die bislang die Abteilung „Wissenschaftliche Dienste“ verantwortete. Friedhelm Maier, bisher Leiter der „Parlamentarischen Dienste“, übernimmt die Abteilung von Rebhan. Nachfolger Maiers wird der bisherige Unterabteilungsleiter „Parlamentsdienste“ Hermann-Josef Schreiner. Ganz neu eingerichtet wird die Abteilung „Information“. Designierter Leiter: Hans Leptien, derzeit Unterabteilungsleiter „Wissenschaftliche Hans-Joachim Stelzl Dokumentation“ und ehemaliger Leiter des Pressezentrums von Ex-Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth. NEWS +++ Manfred Jäger ist neuer innenpolitischer Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion in Hamburg. Er folgt auf Christoph Ahlhaus, der als Staatsrat in die Innen- behörde gewechselt ist (politikszene 86 berichtete). In Verfassungsfragen spricht künftig Kai Voet van Vormizeele für die CDU-Fraktion. Neuer Vorsitzender des Verfassungsausschusses ist A. W. Heinrich Langhein. +++ Wulf Gallert sitzt künftig der Fraktion der Linkspartei.PDS im Landtag Sachsen-Anhalt vor. Gallerts Stellvertreter sind Birke Bull und Angelika Klein. -

German-Russian Natural Gas Relations in the Context of a Common European Energy Policy
Graduate School of Social Sciences (GSSS) German-Russian natural gas relations in the context of a common European energy policy Thesis to obtain the academic title of Master of Science (MS) in the program Political Science (International Relations) Academic year 2018/2019 Date of submission: June 21st 2019 Author: Caspar M. Henke (12299804) Supervisor: Dr. Mehdi P. Amineh Second Reader: Dr. Henk W. Houweling Research Project: The Political Economy of Energy Abstract This thesis analyses the interwoven commercial and political fabric of German-Russian natural gas relations. A theoretical lens that combines liberalist interdependence theory and the critical theoretical concepts of the state-society complex and social networks against the background of selected energy security dimensions will be employed. It will be argued that in order to assess the prospects for a common European Union energy policy, it is crucial to understand the importance of social forces and external relations shaping the energy policy of EU member states vis-á-vis the Russian Federation. It will be highlighted how the different perceptions of Russian natural gas as a political tool and a commercial commodity have resulted in different actors taking the lead in the natural gas strategies of the European Commission, the Central and Eastern European member states, and Germany. Portraying the Russian state-society complex of natural gas, it will be concluded that the German commercial-led approach is not compatible with a European Union energy policy that responds to the geopolitical threats of Russian gas perceived by other member states. Key words: Natural Gas, Russia, Germany, European Union, State-society complex 2 AcKnowledgements I would like to express my sincere gratitude to my thesis supervisor Dr. -

October 24–26, 2021 2
SCIENCE · INNOVATION · POLICIES WORLD HEALTH SUMMIT BERLIN, GERMANY & DIGITAL OCTOBER 24–26, 2021 2 “No-one is safe from COVID-19; “All countries have signed up to Universal no-one is safe until we are all Health Coverage by 2030. But we cannot safe from it. Even those who wait ten years. We need health systems conquer the virus within their that work, before we face an outbreak own borders remain prisoners of something more contagious than within these borders until it is COVID-19; more deadly; or both.” conquered everywhere.” ANTÓNIO GUTERRES Secretary-General, United Nations FRANK-WALTER STEINMEIER Federal President, Germany “We firmly believe that the “All pulling together—this must rights of women and girls be the hallmark of the European are not negotiable.” Health Union. I believe this can NATALIA KANEM be a test case for true global Executive Director, United Nations Population Fund (UNFPA) health compact. The need for leadership is clear and I believe the European Union must as- sume this responsibility.” “The lesson is clear: a strong health URSULA VON DER LEYEN system is a resilient health system. Health President, European Commission systems and preparedness are not only “Governments of countries an investment in the future, they are the that are doing well during foundation of our response today.” the pandemic have not TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS Director-General, World Health Organization (WHO) only shown political leader- ship, but also have listened “If we don’t address the concerns and to scientists and followed fears we will not do ourselves a favor. their recommendations.” In the end, it is about how technology SOUMYA SWAMINATHAN Chief Scientist, World Health can be advanced as well as how Organization (WHO) we can make healthcare more human.” BERND MONTAG President and CEO, Siemens Healthineers AG, Germany “The pandemic has brought to light the “Academic collabo ration is importance of digital technologies and in place and is really a how it can radically bridging partnership. -

Inhalt 1 Bundesminister Dr.-Ing. Hans-Christoph Seebohm 2
Inhalt 2.4.5 Das Verkehrsfinanzgesetz ..................... 71 2.4.5.1 Die Besteuerung als Mittel der Vorbemerkung ......................................................... 11 Verkehrspolitik........................................ 71 Der Anstoß zum Schreiben...................................... 11 2.4.5.2 Neuordnung der Abgaben des Der Wiederbeginn nach 1945.................................. 11 Verkehrs ................................................. 72 Das erste Jahrzehnt BMV........................................ 13 2.4.5.3 Lizenzierung des Werkfernverkehrs....... 74 2.4.5.4 Durchsetzung des Verkehrsfinanz- gesetzes ................................................. 74 1 Bundesminister 2.4.6 Die Reform der Pkw-Besteuerung ......... 81 Dr.-Ing. Hans-Christoph Seebohm 2.4.6.1 Reinfall auf Journalisten......................... 84 2.5 Unruhige Zeiten...................................... 86 1.1 Der Dienstantritt..................................... 20 2.6 Leiter der Unterabteilung Planung 1.2 Die Konkurrenten Adenauer und und Forschung ....................................... 87 Seebohm................................................ 20 2.6.1 Erste Kurskorrekturen ............................ 88 1.3 Erste Schritte ......................................... 21 2.6.2 Abschied von Georg Leber .................... 88 1.3.1 Eingewöhnung ....................................... 22 2.7 Der einzig Dreifach-Minister................... 89 1.3.2 Manöver-Einsatz in der Eifel.................. 22 2.7.1 Der Wissenschaftliche Beirat ................ -

Appendix: List of Interviews
Appendix: List of Interviews The unification of Germany 1) APELT Andreas, Berlin, 23 October 2007. 2) BERGMANN-POHL Sabine, Berlin, 13 December 2007. 3) BIEDENKOPF Kurt, Berlin, 5 December 2007. 4) BIRTHLER Marianne, Berlin, 18 December 2007. 5) CHROBOG Jürgen, Berlin, 13 November 2007. 6) EGGERT Heinz, Dresden, 14 December 2007. 7) EPPELMANN Rainer, Berlin, 21 November 2007. 8) GAUCK Joachim, Berlin, 20 December 2007. 9) GLÄSSNER Gert-Joachim, Berlin, 7 November 2007. 10) HELBIG Monika, Berlin, 5 November 2007. 11) HOFMANN Gunter, Berlin, 30 July 2007. 12) KERWIEN Antonie, Berlin, 31 October 2007. 13) KLINGST Martin, Cambridge, Massachusetts, 7 December 2006. 14) KLOSE Hans-Ulrich, Berlin, 31 October 2007. 15) KRAA Detlev, Berlin, 31 October 2007. 16) KRALINSKI Thomas, Potsdam, 16 October 2007. 17) LENGSFELD Vera, Berlin, 3 December 2007. 18) LIPPERT Barbara, Berlin, 25 July 2007. 19) MAIZIÈRE Lothar de, Berlin, 4 December 2007. 20) MAIZIÈRE Thomas de, Berlin, 20 November 2007. 21) MECKEL Markus, Berlin, 29 November 2007. 22) MERTES Michael, Boston, Massachusetts, 17 November 2006. 23) MEYER Hans Joachim, Berlin, 13 December 2007. 24) MISSELWITZ Hans, Berlin, 6 November 2007. 25) MODROW Hans, Berlin, 28 November 2007. 26) MÜLLER Hans-Peter, Berlin, 13 November 2007. 27) NOOKE Günther, Berlin, 27 November 2007. 28) PAU Petra, Berlin, 13 December 2007. 29) PLATZECK Matthias, Potsdam, 12 December 2007. 30) SABATHIL Gerhard, Berlin, 31 October 2007. 31) SARAZZIN Thilo, Berlin, 30 November 2007. 32) SCHABOWSKI Günther, Berlin, 3 December 2007. 33) SCHÄUBLE Wolfgang, Berlin, 19 December 2007. 34) SCHRÖDER Richard, Berlin, 4 December 2007. 35) SEGERT Dieter, Vienna, 18 June 2008. -

What Does GERMANY Think About Europe?
WHat doEs GERMaNY tHiNk aboUt europE? Edited by Ulrike Guérot and Jacqueline Hénard aboUt ECFR The European Council on Foreign Relations (ECFR) is the first pan-European think-tank. Launched in October 2007, its objective is to conduct research and promote informed debate across Europe on the development of coherent, effective and values-based European foreign policy. ECFR has developed a strategy with three distinctive elements that define its activities: •a pan-European Council. ECFR has brought together a distinguished Council of over one hundred Members - politicians, decision makers, thinkers and business people from the EU’s member states and candidate countries - which meets once a year as a full body. Through geographical and thematic task forces, members provide ECFR staff with advice and feedback on policy ideas and help with ECFR’s activities within their own countries. The Council is chaired by Martti Ahtisaari, Joschka Fischer and Mabel van Oranje. • a physical presence in the main EU member states. ECFR, uniquely among European think-tanks, has offices in Berlin, London, Madrid, Paris, Rome and Sofia. In the future ECFR plans to open offices in Warsaw and Brussels. Our offices are platforms for research, debate, advocacy and communications. • a distinctive research and policy development process. ECFR has brought together a team of distinguished researchers and practitioners from all over Europe to advance its objectives through innovative projects with a pan-European focus. ECFR’s activities include primary research, publication of policy reports, private meetings and public debates, ‘friends of ECFR’ gatherings in EU capitals and outreach to strategic media outlets. -

Kompetenzen Im Widerstreit Unternehmensberater Als Personalplaner Der Deutschen Bundespost 1983–1985 Von Alina Marktanner
Kompetenzen im Widerstreit Unternehmensberater als Personalplaner der Deutschen Bundespost 1983–1985 von Alina Marktanner Das Gewerkschaftsblatt „Die Deutsche Postgilde“ nahm im Februar 1984 den Ein- satz zweier Beratungsunternehmen bei der Deutschen Bundespost aufs Korn: „Belä- chelte man zunächst […] die Interimcoachs […], so empfindet man sie zunehmend als suspekt.“1 Hohe Defizite im Postwesen2, eine Marktsättigung im Fernmeldewesen sowie die schwindende Unantastbarkeit des Berufsbeamtentums3 hatten sich be- reits seit Mitte der vorhergehenden Dekade zu einer drückenden Problemlage ver- dichtet. Offenbar wollte der Minister für das Post- und Fernmeldewesen der ersten Kohl-Regierung, Christian Schwarz-Schilling, diese nicht allein bewältigen. Die „Coachs“, die er zur Rettung engagiert hatte, waren die Beratungsfirmen Knight Wendling und Mummert + Partner. Das Schweizer Unternehmen Knight Wendling hatte ein strategisches Unternehmenskonzept für die Deutsche Post auszuarbeiten, während die Hamburger Firma Mummert + Partner das Personalbemessungssystem auf Verbesserungsmöglichkeiten hin prüfen sollte. Der geballte Unmut der unteren Verwaltungsebenen gegen die Berater von, bissig apostrophiert, „Mumpitz und Wendelin“ mündete in einem Aufruf zum Boykott der Projekte: „Was liegt da näher, als mit probaten Spielmethoden den millionenschweren Neuerwerbungen Abseits- fallen zu bauen, sie abzublocken, ins Leere laufen zu lassen oder sich einfach totzu- stellen.“4 Die Beratungsaufträge der 1980er Jahre bei der Deutschen Bundespost stehen bei- 1 Mumpitz und Wendelin, in: Die Deutsche Postgilde 1984, 2. 2 Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen (Hrsg.), Deutsche Bundespost. Geschäftsbericht 1980. Bonn 1980, 86; Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen (Hrsg.), Deutsche Bundespost. Ge- schäftsbericht 1981. Bonn 1981. 3 Mit seinem „Aktionsprogramm zur Dienstrechtsreform“ von 1976 führte der damalige Bundesinnen- minister Werner Maihofer erstmals die Prinzipien der funktions- und leistungsgerechten Bezahlung in das öffentliche Dienstrecht ein. -

DHB Kapitel 4.2 Wahl Und Amtszeit Der Vizepräsidenten Des Deutschen 13.08.2021 Bundestages
DHB Kapitel 4.2 Wahl und Amtszeit der Vizepräsidenten des Deutschen 13.08.2021 Bundestages 4.2 Wahl und Amtszeit der Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages Stand: 13.8.2021 Grundlagen und Besonderheiten bei den Wahlen der Vizepräsidenten Die Stellvertreter des Präsidenten werden wie der Bundestagspräsident für die Dauer der Wahlperiode gewählt und können nicht abgewählt werden. Für die Wahl der Stellvertreter des Präsidenten sieht die Geschäftsordnung des Bundestages in § 2 Absatz 1 und 2 getrennte Wahlhandlungen mit verdeckten Stimmzetteln vor. In der 12. Wahlperiode (1990) sowie in der 17., 18. und 19. Wahlperiode (2009, 2013 und 2017) wurden die Stellvertreter mit verdeckten Stimmzetteln in einem Wahlgang (also mit einer Stimmkarte) gewählt1. In der 13. Wahlperiode (1994) wurde BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN drittstärkste Fraktion und beanspruchte einen Platz im Präsidium. Die SPD wollte andererseits auf einen ihrer bisherigen zwei Vizepräsidenten nicht verzichten. Zugleich war erkennbar, dass sich keine Mehrheit für eine Vergrößerung des Präsidiums von fünf auf sechs Mitglieder finden ließ, und die FDP war nicht bereit, als nunmehr kleinste Fraktion aus dem Präsidium auszuscheiden. Da eine interfraktionelle Einigung nicht zustande kam, musste die Wahl der Vizepräsidenten mit Hilfe einer Geschäftsordnungsänderung durchgeführt werden. Vor der eigentlichen Wahl kam es nach einer längeren Geschäftsordnungsdebatte zu folgendem Verfahren2: 1. Abstimmung über den Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Einräumung eines Grundmandats im Präsidium für jede Fraktion (Drucksache 13/8): Annahme. 2. Abstimmung über den Änderungsantrag der Fraktion der SPD: Erweiterung des Präsidiums auf sechs Mitglieder (Drucksache 13/7): Ablehnung. 3. Abstimmung über den Änderungsantrag der Gruppe der PDS: Einräumung eines Grundmandats im Präsidium für jede Fraktion und Gruppe (Drucksache 13/15 [neu]): Ablehnung. -
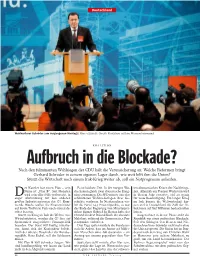
Aufbruch in Die Blockade?
Deutschland Wahlverlierer Schröder (am vergangenen Montag): Eine offizielle Große Koalition will im Moment niemand KOALITION Aufbruch in die Blockade? Nach den fulminanten Wahlsiegen der CDU hält die Verunsicherung an: Welche Reformen bringt Gerhard Schröder in seinem eigenen Lager durch, wie weit hilft ihm die Union? Stürzt die Wirtschaft nach einem Irak-Krieg weiter ab, soll ein Notprogramm anlaufen. er Kanzler hat einen Plan – sein Es ist höchste Zeit. In der vorigen Wo- ten ökonomischen Krisen der Nachkriegs- Name ist „Plan B“. Seit Monaten che kamen gleich zwei dramatische Ereig- zeit. Allenfalls ein Prozent Wachstum wird Dwird er in aller Stille vorbereitet, in nisse zusammen. Die SPD musste eine der in diesem Jahr erwartet, viel zu wenig enger Abstimmung mit den anderen schlimmsten Wahlniederlagen ihrer Ge- für neue Beschäftigung. Ein langer Krieg großen Industrienationen der G7. Kom- schichte verdauen. In Niedersachsen ver- im Irak könnte die Weltwirtschaft kip- mende Woche wollen die Finanzminister lor die Partei 14,5 Prozentpunkte, es war pen und in Deutschland die Zahl der Ar- auf ihrem Treffen in Paris noch einmal da- das Ende der Regierung von Ministerprä- beitslosen auf fünf Millionen hochschnellen rüber beraten. sident Sigmar Gabriel. In Hessen holte der lassen. Stürzt ein Krieg im Irak die Welt in eine Christdemokrat Roland Koch die absolute Ausgerechnet in dieser Phase steht die Wirtschaftskrise, werden die G7 ihre auf Mehrheit, während die Genossen 10,3 Pro- Republik vor einer politischen Blockade. Sparsamkeit ausgerichtete Finanzpolitik zentpunkte einbüßten. Seit den Schlägen von Hessen und Nie- beenden. Der Staat will kräftig investie- Drei Tage später meldete die Bundesan- dersachsen kann Schröder nicht mehr ohne ren, damit sich die Konjunktur belebt. -

Rausch Zuständig Für Verbraucher
politik & �����������������Ausgabe���������� Nr. 232� kommunikation politikszene 27.4. – 3.5.2009 �������������� Kommunikationsexperte Schweer zum BDI ����������������������������������������������Dieter Schweer (55) soll ab 15. Mai stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) werden. Er folgt auf Klaus Bräuning (55), der bereits im April vergan- ��������������������������������������������������������������genen Jahres in die Geschäftsführung des Verbands der��������������������� Automobilindustrie gewechselt ist.�������� In seiner ����������������������������������������������������������������������������������������neuen Funktion soll Schweer BDI-Hauptgeschäftsführer Werner Schnappauf (55) dabei unterstützen,�������� ����������������������������������������������������������������������������������������die internen Strukturen des Verbands zu modernisieren. Schweer ist seit 2006 geschäftsführender� ����������� �����������������������������������������������������������������������������������������������Gesellschafter der von ihm gegründeten Kommunikationsagentur Schweer Executive Communication ����������������������������������������������������������Solution. Von 1996 bis 2003 war er Kommunikationschef��������������������� des Energiekonzerns� RWE. Davor war er Dieter Schweer unter anderem bei der Hypo-Vereinsbank-Gruppe tätig. ���������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������Pronold