Kaiser Sigismund (1368-1437)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

U.S. State Department Office of the Executive Secretariat, Crisis Files
A Guide to the Microfilm Edition of U.S. State Department Office of the Executive Secretariat, Crisis Files Part 1: The Berlin Crisis, 1957–1963 A UPA Collection from Cover: Map of Berlin showing the four occupation zones of the victorious World War II powers. Image by Norma Wark and Mark Zimmerman. U.S. State Department Office of the Executive Secretariat, Crisis Files Part 1: The Berlin Crisis, 1957–1963 Guide by Rosemary Orthmann A UPA Collection from 7500 Old Georgetown Road ● Bethesda, MD 20814-6126 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data U.S. State Department, Office of the Executive Secretariat, Crisis files. Part 1, The Berlin Crisis, 1957–1963 [microform] : Lot Files: Office of the Executive Secretariat, Lot File 66D124 : Bureau of European Affairs, Office of German Affairs, Records relating to Berlin, 1957–1963, Lot Files 70D548, 78D222, 78D269, 78D271, 80D2 / ; editor, Robert E. Lester. microfilm reels ; 35 mm. Summary: Reproduces documents from Record Group 59, Records of the State Department, Office of the Executive Secretariat, in the custody of the National Archives, College Park, Md. Accompanied by a printed guide compiled by Rosemary Orthmann. ISBN 1-55655-988-7 1. Berlin (Germany)––Politics and government––1945–1990––Sources. 2. Berlin Wall, Berlin, Germany, 1961–1989––Sources. 3. Germany––Foreign relations––United States––Sources. 4. United States––Foreign relations––Germany––Sources. 5. United States. Dept. of State––Archives. I. Title: US State Department, Office of the Executive Secretariat, Crisis files. Part 1, The Berlin Crisis, 1957–1963. II. Title: Crisis files. Part 1, The Berlin Crisis, 1957–1963. -

Und Ostpolitik Der Ersten Großen Koalition in Der Bundesrepublik Deutschland (1966-1969)
Die Deutschland- und Ostpolitik der ersten Großen Koalition in der Bundesrepublik Deutschland (1966-1969) Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn vorgelegt von Martin Winkels aus Erkelenz Bonn 2009 2 Gedruckt mit der Genehmigung der Philosophischen Fakultät Der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Zusammensetzung der Prüfungskommission Vorsitzender: PD Dr. Volker Kronenberg Betreuer: Hon. Prof. Dr. Michael Schneider Gutacher: Prof. Dr. Tilman Mayer Weiteres prüfungsberechtigtes Mitglied: Hon. Prof. Dr. Gerd Langguth Tag der mündlichen Prüfung: 11.11.2009 Diese Dissertation ist auf dem Hochschulschriftenserver der ULB Bonn http://hss.ulb.uni-bonn.de/diss_online elektonisch publiziert 3 Danksagung: Ich danke Herrn Professor Dr. Michael Schneider für die ausgezeichnete Betreuung dieser Arbeit und für die sehr konstruktiven Ratschläge und Anregungen im Ent- stehungsprozess. Ebenso danke ich Herrn Professor Dr. Tilman Mayer sehr dafür, dass er als Gutachter zur Verfügung gestanden hat. Mein Dank gilt auch den beiden anderen Mitgliedern der Prüfungskommission, Herrn PD Dr. Volker Kronenberg und Herrn Prof. Dr. Gerd Langguth. 4 Inhaltsverzeichnis Einleitung 7 1. Der Beginn der Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland ab 1949 und 23 die deutsche Frage 1.1. Die Deutschland- und Ostpolitik der Bundesregierung Adenauer zwischen 25 Westintegration und Kaltem Krieg (1949-1963) 1.2. Die Deutschland- und Ostpolitik unter Kanzler Erhard: Politik der 31 Bewegung (1963-1966) 1.3. Die deutschland- und ostpolitischen Gegenentwürfe der SPD im Span- 40 nungsfeld des Baus der Berliner Mauer: “Wandel durch Annäherung“ 2. Die Bildung der Großen Koalition: Ein Bündnis auf Zeit 50 2.1. Die unterschiedlichen Politiker-Biographien in der Großen Koalition im 62 Hinblick auf das Dritte Reich 2.2. -

Kristina Meyer: Rezension Von: Matthias Müller, Die SPD Und Die Vertriebenenverbände 1949-1977. Eintracht, Entfremdung, Zwietr
Matthias Müller, Die SPD und die Vertriebenenverbände 1949–1977. Eintracht, Entfremdung, Zwietracht, Lit Verlag, Münster/Hamburg etc. 2012, VIII + 603 S., kart., 59,90 €. Dass nicht die CDU/CSU, sondern die SPD bis zu den späten 1960er-Jahren als »natürliche Verbündete« der Vertriebenen und ihrer Interessenverbände galt, ist seit der heftig umkämpften Verabschiedung der Ostverträge 1972, spätestens aber seit den Debatten um die geschichtspolitischen Offensiven des Bundes der Vertriebenen (BdV) und ihrer langjährigen christdemokratischen Vorsitzenden Erika Stein- bach weitgehend in Vergessenheit geraten. Wie und warum sich das Verhältnis der SPD zu den Ver- triebenenverbänden zwischen 1945 und 1977 von der »Eintracht« über die »Entfremdung« hin zur »Zwietracht« entwickelte, dies untersucht Matthias Müller in seiner an der Universität Gießen bei Hans-Jürgen Schröder entstandenen und bereits 2012 veröffentlichten Dissertation. Im Fokus steht das sich zunehmend verschlechternde »Beziehungsgefüge« zwischen der SPD und den Vertriebenenverbänden: In dem Maße, in dem sich die SPD-Führung im Laufe der 1960er-Jahre von der Illusion einer Wiedervereinigung und Rückgewinnung der verlorenen Ostgebiete verabschiedete und im Zuge der Entspannungspolitik eine Anerkennung der Oder-Neiße-Linie zum Programm machte, rückten die Vertriebenenverbände, allen voran der BdV, von der Sozialdemokratie ab. Zum »Kristallisationspunkt« und »Prüfstein« dieses Verhältnisses geriet aus Sicht der Vertriebenen, so Müller, die von Kurt Schuma- cher 1946 geprägte Formel, -

UID Jg. 23 1969 Nr. 20, Union in Deutschland
Informationsdienst der Christlich Demokratischen Union Deutschlands Nr. 20/69 22. Mai Z 8398 C • 1969 23. Jahrgang • • Wahlkampf durch die Hintertür HUTE Bundeskanzler Kiesinger und die Union werden ihren ge- kündigen aber meiner Auffassung samten Einfluß aufbieten, um ungeachtet des bevorstehenden nach keine neuen Schritte für das Seite praktische Verhalten der SPD in Wahlkampfes bis zuletzt sachliche Arbeit zu leisten. Deshalb den nächsten Monaten an." wirkt es einigermaßen befremdlich, daß die Spitzenpolitiker Dr. Kohl neuer Auch wenn die SPD es nicht auf Ministerpräsident der SPD, unter ihnen Parteivorsitzender Brandt, plötzlich er- einen Bruch mit der Union ankom- klären, die SPD sei „ein Garant" dafür, daß die Große Koali- men lassen will, hat sie trotzdem Die Frauen sind tion ihr Programm konsequent durchführen werde. Zu gleicher schon seit Monaten gezielt mit dem gleichberechtigt Wahlkampf begonnen. In großfor- Zeit versäumt die SPD keine Gelegenheit, ihren Regierungs- matigen Anzeigen wird die Bevölke- Schmidt contra partner anzugreifen. rung darüber belehrt, daß nicht nur Leber alle Regierungsarbeit, sondern alles Heil der Welt der SPD zu verdan- In einem Zeitungsinterview ver- periode, wie es Brandt auf der ken ist. trat der Generalsekretär der CDU, SPD-Vorstandssitzung in Mainz am Bundesminister a. D. Dr. Heck, an- vergangenen Freitag gefordert hat, Wenn schon ein prominenter gesichts der widersprüchlichen Hal- steht nichts im Wege." Sozialdemokrat sich zur Koalition tung der Sozialdemokraten die Mei- Zu der Erklärung Brandts, die bekennt, klingt das gequält und nung, daß die CDU jede Anstren- SPD werde die Regierungspolitik zeigt die SPD in der Pose eines gung unternehmen werde, um die auch dann vertreten, „wenn sie das Märtyrers, der alles erträgt, um Arbeit der Koalition erfolgreich zu Die Bundesrepublik müsse bis zu den Bundestagswahlen allein dem Gesamtwohl zu dienen. -
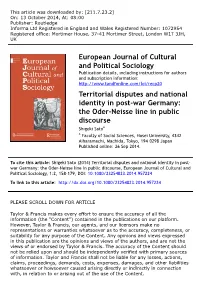
The Oder–Neisse Line in Public Discourse
This article was downloaded by: [211.7.23.2] On: 13 October 2014, At: 08:00 Publisher: Routledge Informa Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954 Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London W1T 3JH, UK European Journal of Cultural and Political Sociology Publication details, including instructions for authors and subscription information: http://www.tandfonline.com/loi/recp20 Territorial disputes and national identity in post-war Germany: the Oder–Neisse line in public discourse Shigeki Satoa a Faculty of Social Sciences, Hosei University, 4342 Aiharamachi, Machida, Tokyo, 194–0298 Japan Published online: 26 Sep 2014. To cite this article: Shigeki Sato (2014) Territorial disputes and national identity in post- war Germany: the Oder–Neisse line in public discourse, European Journal of Cultural and Political Sociology, 1:2, 158-179, DOI: 10.1080/23254823.2014.957224 To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/23254823.2014.957224 PLEASE SCROLL DOWN FOR ARTICLE Taylor & Francis makes every effort to ensure the accuracy of all the information (the “Content”) contained in the publications on our platform. However, Taylor & Francis, our agents, and our licensors make no representations or warranties whatsoever as to the accuracy, completeness, or suitability for any purpose of the Content. Any opinions and views expressed in this publication are the opinions and views of the authors, and are not the views of or endorsed by Taylor & Francis. The accuracy of the Content should not be relied upon and should be independently verified with primary sources of information. Taylor and Francis shall not be liable for any losses, actions, claims, proceedings, demands, costs, expenses, damages, and other liabilities whatsoever or howsoever caused arising directly or indirectly in connection with, in relation to or arising out of the use of the Content. -

Reinhold Rehs - Präsident Des Bundes Der Vertriebenen
Organ der Landsmannschaft Ostpreußen e. V. Jahrgang 18 / Folge 11 Hamburg 13, Parkallee 86 / 18. März 1967 Reinhold Rehs - Präsident des Bundes der Vertriebenen r. Zum neuen Präsidenten des Bundes der Vertriebenen, als Nachfolger des im November 1966 tödlich verunglückten Dr. h. c. Wenzel Jaksch, ist am Sonntag vor einer Bundesversamm• lung des BdV mit großer Mehrheit der Sprecher unserer Landsmannschaft, Bundestagsabge• ordneter Reinhold Rehs, gewählt worden. Er erhielt 85 von 109 Stimmen, nur 5 Dele• gierte stimmten gegen ihn, 18 enthielten sich der Stimme. Zum weiteren Vizepräsidenten des BdV wurde der CDU-Abgeordnete Dr. Hans Edgar Jahn, ein Pommer, gewählt. Neben ihm sind Rudolf Wollner, Helmut Gossing und Erich Schellhaus Vizepräsidenten des Bundes. In einem Interview betonte Präsident Rehs, daß Formen und Stil der Verbandsarbeit der heu• tigen innen- und außenpolitischen Lage angepaßt werden sollten, ohne daß eine Substanzver• änderung in der Vertretung unserer Rechte erfolge. kp. Die Lücke, die der jähe Tod von Wen• persönlich bekannt, als Erster Stadtvertreter zel Jaksch im November 1966 gerissen hat, Königsbergs, der preußischen Residenz- ist wieder geschlossen. Die Wahl von Rein• und Krönungsstadt, ebenso wie aus seinem Wir• hold Rehs zum Präsidenten des Bundes der ken in der deutschen Volksvertretung und vie• Vertriebenen erfüllt wohl alle unsere Lands• len anderen politischen Gremien, als Sprecher leute mit Genugtuung und Stolz. Wir sind uns und als Mitglied des Bundesvorstandes in vie• bewußt, welche Fülle der Verantwortung er als len Jahren. Sein persönlicher Einsatz leitender Mann des Einheitsverbandes und als bei der Vorbereitung der Gesetze und Novellen Sprecher der Landsmannschaft für den Lastenausgleich und im Kampf um das Ostpreußen damit zu tragen hat. -

Bd. 4) ISBN 3–8012–0304 –2
willy brandt Berliner Ausgabe willy brandt Berliner Ausgabe Herausgegeben von helga grebing, gregor schöllgen und heinrich august winkler Im Auftrag der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung band 1: Hitler ist nicht Deutschland. Jugend in Lübeck – Exil in Norwegen 1928 – 1940 band 2: Zwei Vaterländer. Deutsch-Norweger im schwedischen Exil – Rückkehr nach Deutschland 1940 – 1947 band 3: Berlin bleibt frei. Politik in und für Berlin 1947 – 1966 band 4: Auf dem Weg nach vorn. Willy Brandt und die SPD 1947 – 1972 band 5: Die Partei der Freiheit. Willy Brandt und die SPD 1972 – 1992 band 6: Ein Volk der guten Nachbarn. Außen- und Deutschlandpolitik 1966 – 1974 band 7: Mehr Demokratie wagen. Innen- und Gesellschaftspolitik 1966 – 1974 band 8: Über Europa hinaus. Dritte Welt und Sozialistische Internationale band 9: Die Entspannung unzerstörbar machen. Internationale Beziehungen und deutsche Frage 1974 – 1982 band 10: Gemeinsame Sicherheit. Internationale Beziehungen und deutsche Frage 1982 – 1992 willy brandt Berliner Ausgabe band 4 Auf dem Weg nach vorn Willy Brandt und die SPD 1947 – 1972 Bearbeitet von daniela münkel Verlag J.H.W. Dietz Nachf. GmbH Die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung bedankt sich für die groß- zügige finanzielle Unterstützung der gesamten Berliner Ausgabe bei: Frau Ursula Katz, Northbrook, Illinois Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, Essen Otto Wolff von Amerongen-Stiftung, Köln Bankgesellschaft Berlin AG Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH, Hamburg Herlitz AG, Berlin Metro AG, Köln Schering AG, Berlin Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme Willy Brandt: Auf dem Weg nach vorn: Willy Brandt und die SPD; 1947–1972/ Willy Brandt. Bearb. von Daniela Münkel. -

Und Deutschlandpolitik in Der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Von
Stetigkeit und Veränderung in der Ost- und Deutschlandpolitik Die Diskussion über eine Neuorientierung des ost- und deutschlandpolitischen Kurses in der CDU/CSU von 1958 bis 1969 Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie des Fachbereiches Geschichts- und Kulturwissenschaft Fach Osteuropäische Geschichte der Justus-Liebig-Universität Gießen vorgelegt von Volker Wirtgen Robert-Schuman-Ring 69 65830 Kriftel Erstgutachter: Prof. Dr. Klaus Heller Zweitgutachter: Prof. Dr. Thomas Bohn „Wir müssen das Kommende bestehen. Das ist noch wichtiger und auch etwas anderes, als das Vergangene zu rechtfertigen.“ Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier, Deutscher Bundestag, 17. Oktober 1961 „Wir dürfen das Heute nicht mit dem Morgen bezahlen und nicht für Erleichter- ungen eines Augenblicks die Zukunft aufs Spiel setzen.“ Bundeskanzler Ludwig Erhard, Deutscher Bundestag, 15. Oktober 1964 2 Inhaltsverzeichnis I. Einleitung 1. Fragestellung ............................................................................................................. 8 2. Quellenlage ............................................................................................................... 16 3. Forschungsstand ........................................................................................................ 22 II. Historische Vorbedingungen 1. Die Entwicklung der Union bis 1958 1.1. Prägende Faktoren ............................................................................................. 26 1.2. Die Union in der 3. Wahlperiode des deutschen -

Bonn Verschenkt Ostdeutschland! Nationale Würdelosigkeit Kann Man Nicht Als Einen Außenpolitischen Erfolg Rühmen
£>as tfiraßmWati Organ der Landsmannschaft Ostpreußen e. V. Jahrgang 21 / Folge 48 2 Hamburg 13, Parkallee 84 / 28. November 1970 3 J 5524 C Bonn verschenkt Ostdeutschland! Nationale Würdelosigkeit kann man nicht als einen außenpolitischen Erfolg rühmen HAMBURG — Aus Anlaß der Veröffent• lichung des deutsch-polnischen Vertrages Brandts Bäume gab die Landsmannschaft Ostpreußen fol• gende Erklärung über Presse und Rundfunk: wachsen nicht Die Ostpreußen hatten bereits erkannt, daß die Vertretung ihres Landes und seiner in den Himmel... Menschen von der amtierenden Bundes• H. W. — Wie immer auch die nun angestreng• regierung verfassungswidrig und grundlos ten Verfahren ausgehen werden, in zunehmen• dem Maße verstärkt sich der Eindruck, daß der aufgekündigt wurde. Der Warschauer Ver• „Fall Geldner" als ein klassisches Schulmodell trag ist die empörende Bestätigung dieser der kommunistischen Provo-Agitation anzuse• Tatsache. hen ist. Allerdings, und das kann nach dem letzten Wahlsonntag gesagt werden, ist diese Oder und Neiße wurden für die Regie• „Bombe" ohne Wirkung geblieben. Dafür aber rung Staatsgrenze, damit Ostpreußen und hat sie mit Gewißheit dem bundesdeutschen Normalverbraucher einen Schock versetzt. Und ein Viertel Deutschlands zu Teilen Rußlands zwar hinsichtlich der hier zutage getretenen und Polens. Die betroffenen Menschen aber verwerflichen Taktik, die nicht einmal davor sind nicht mehr gleichberechtigte Staatsbür• zurückschreckte, das höchste parlamentarische ger. Ihre Vertreibung wird vielmehr ver• Amt — nämlich das des Bundestagspräsidenten — für ihre Zwecke zu mißbrauchen. traglich vollendet und im östlichen Deutsch• In Bayern jedoch — und ganz zweifelsohne land werden sie gnadenlos ihrem Schicksal war auf den Wahltermin gezielt — hat der Fall überlassen. Mit allen nüchternen Staats• Geldner nicht die Wirkung gehabt, die er nach bürgern muß jeder Ostpreuße das Wort dem Willen der Initiatoren hätte haben sollen. -
Expellee Politics and the Change in West German Ostpolitik
Expellee Politics and the Change in West German Ostpolitik The Adaption from a Favourable Hallstein Doctrine to Willy Brandt’s Rapprochement Policy Maikel Joosten 5748895 BA Thesis Dr. Christian Wicke Word count: 8.250 1 Table of Contents Introduction ................................................................................................................................ 1 Heimatvertriebenen: From Expulsion to the Bund der Vertriebenen (BdV) ............................. 2 Ostpolitik before Brandt: From Konrad Adenauer to the Great Coalition ................................ 7 Introduction to the Neue Ostpolitik and the Zeitgeist of the 1960s ......................................... 10 Political Points of the Heimatvertriebenen up to the Neue Ostpolitik ..................................... 11 Willy Brandt’s foreign policy: Outcomes of the Ostverträge ................................................. 16 Expellee leaders and their Efforts against the Eastern Treaties ............................................... 17 Reasons for its Failure ............................................................................................................. 21 Conclusion ............................................................................................................................... 22 Bibliography ............................................................................................................................ 23 2 Introduction In the late 1960s and early 1970s, the Cold War tensions between the East and the West -

Heimat in the Cold War: West Germany’S Multimedial Easts, 1949-1989
HEIMAT IN THE COLD WAR: WEST GERMANY’S MULTIMEDIAL EASTS, 1949-1989 A Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy by Yuliya H. Komska January 2009 © 2009 Yuliya H. Komska HEIMAT IN THE COLD WAR: WEST GERMANY’S MULTIMEDIAL EASTS, 1945-1989 Yuliya H. Komska, Ph. D. Cornell University 2009 As a result of two world wars, decolonization, and labor migration in the twentieth century the notion of belonging underwent a radical transformation. This dissertation examines how the German concept of Heimat, an arguably untranslatable term that connotes localized belonging, was politically and culturally affected by the Cold War. The dissertation focuses on the role of Sudeten Germans, ethnic Germans expelled from postwar Czechoslovakia, in forging a link between Heimat, border tropes, and the physical landscape of the Iron Curtain between West Germany and Czechoslovakia. It interrogates this linkage, which allowed the expellees to fashion Heimat into an intermedial site of Cold War aesthetics, a linchpin between the postwar era and the Cold War, and an idiom of international law. Chapter One reframes current public and academic discussions of ‘Germans as victims.’ It moves beyond a German-Jewish dyad to consider how Sudeten Germans engaged Palestine’s political, cultural, and religious meanings in order to re- imagine Palestine as a quintessential homeland. Chapter Two reconsiders the role of nostalgia in processes of sensory and, above all, visual contact with Heimat as documented in Sudeten German borderland photography, travel reports, and poetry published during the Cold War. -

1 29 23. Oktober 1962: Fraktionssitzung
SPD – 04. WP Fraktionssitzung: 23. 10. 1962 29 23. Oktober 1962: Fraktionssitzung AdsD, SPD-BT-Fraktion 4. WP, Ord. 13.3. 62 – 23.10. 62 (alt 1031, neu 6). Überschrift: »SPD-Fraktion im Bundestag. Protokoll der Fraktionssitzung vom Dienstag, den 23. Oktober 1962«. Anwesend: 166 Abgeordnete. Prot.: Eichmann. Zeit: 15.15 – 17.30 Uhr. Fritz Erler eröffnet die Sitzung um 15.15 Uhr und gibt vor Eintritt in die Tagesord- nung bekannt, daß der Tagesordnungspunkt 2, Vorlagen aus den Arbeitskreisen, um einen Antrag betr. Futtergetreidepreis, einen Antrag betr. Entwurf eines Gesetzes für eine einmalige statistische Steuererklärung auf der Grundlage einer Mehrwertsteuer mit Vorumsatzabzug sowie einen Antrag der Arbeitsgruppe Mittelschichten betr. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Gewerbeordnung erweitert werden soll. Die Fraktion ist damit einverstanden. Sodann entschuldigt er Erich Ollenhauer und Herbert Wehner, die am DGB-Kongreß in Hannover teilnehmen.1 Zu einigen wesentlichen Fragen der politischen Situation nimmt Fritz Erler wie folgt Stellung: Die Entscheidung des amerikanischen Präsidenten für eine Blockade von Waffenliefe- rungen nach Kuba zeige, daß die Weltmacht Amerika eine weitere Ausdehnung der sowjetischen Macht nicht tatenlos hinzunehmen bereit sei.2 Man müsse Verständnis für die Sorgen des amerikanischen Volkes und seines Präsidenten haben, so wie die Ameri- kaner Verständnis für unsere und die Lage Berlins aufbringen. Fritz Erler nannte die Entscheidung vor allem maßvoll, weil sie nicht den Handel, sondern nur Waffenliefe- rungen betreffe.3 Sie [d. h. die USA] werden in Südamerika ihr Ziel nur erreichen, wenn die Vereinigten Staaten dort mit ihrem ganzen Gewicht für den sozialen Fortschritt einträten.4 Fritz Erler wertete es als einen Fortschritt, daß der Bundesaußenminister nach seiner Rückkehr aus Amerika ein abgewogenes Wort zur deutschen Beteiligung am westli- chen Risiko in der Berlinfrage gesagt und gefordert habe, der Westen solle nicht nur reagieren, sondern die Sowjetunion zur Auseinandersetzung mit der westlichen Politik 5 zwingen.