Diplomarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Valle Della Salute · the Valley of Health
PUSTERTAL | VAL PUSTERIA Gesundheitstal VALLE DELLA SALUTE · THE VALLEY OF HEALTH VALLEY THE · DELLA SALUTE VALLE VIA LIBERA AD UNA RESPIRAZIONE MIGLIORE Il Centro Climatico Predoi WEG FREI Il Centro Climatico è ubicato a 1.100 m di profondità all’interno della montagna, in una delle gallerie della miniera di rame dismes- FÜR EINE BESSERE ATMUNG sa di Predoi nella quale si accede con il Klimastollen Prettau trenino dei minatori. La speleoterapia è la parola chiave del trat- Der Klimastollen liegt 1.100 m im Inneren des Berges, in einem stillgelegten Stollen tamento per il miglioramento di allergie o des ehemaligen Prettauer Kupferbergwerks. Speläotherapie, übersetzt Höhlentherapie, altri problemi alle vie respiratorie. All’in- ist das Schlüsselwort für eine lindernde Wirkung gegen allergische und andere terno del Centro Climatico delle miniere di Predoi, gli affetti da malattie asmatiche pos- Probleme des Atmungssystems. Dank der vorherrschenden lufthygienischen Bedingun- sono respirare più liberamente grazie alle gen ist die Atemluft im Klimastollen völlig frei von Verunreinigungen: Sie hilft den perfette condizioni igieniche dell’aria puris- Betroffenen, freier durchzuatmen. Die Luftfeuchtigkeit im Stollen liegt nahe bei 100 sima. L’umidità relativa dell’aria si avvicina Prozent. al 100%. Grazie ad una terapia mirata di Durch gezieltes Ein- und Ausatmen verspüren besonders Menschen mit chronischen inspirazione ed espirazione i pazienti prova- no un sensibile miglioramento. Entzündungen des Atmungssystems oder Asthma bronchiale ein deutlich gesteigertes Wohlbefinden. PURE AIR IN THE HEART OF THE MOUNTAIN The Predoi-Prettau Speleotherapy Mine Gallery The climatic mine gallery is located 1,000 m inside the mountain and can be reached by a little train. -

Sanduhr Sanduhr Das Buch Zum Europäischen Dorferneuerungspreis 2008
SandUhr www.sanduhr-taufers.eu SandUhr Das Buch zum Europäischen Dorferneuerungspreis 2008 Gemeinde Sand in Taufers Walther Lücker unter Mitarbeit von Dr. Doris Oberegelsbacher und Dr. Martin Huber Impressum SandUhr Das Buch zum Europäischen Dorferneuerungspreis 2008 1. Auflage, 2008 © Gemeinde Sand in Taufers, Sand in Taufers 2008 Text: Walther Lücker Redaktionsbüro Südtirol Mitarbeit: Dr. Doris Oberegelsbacher und Dr. Martin Huber Grafische Gestaltung: sanni+ Alexandra Ausserhofer Titelgestaltung: sanni+ Alexandra Ausserhofer Lektorat: Margit Laner Plaschke Fotos: Walther Lücker; Archiv Gemeinde Sand in Taufers; Archiv Redaktionsbüro Südtirol; Hartmann Seeber (6). Druck Umschlag: König und Lerch, München Druck: Athesia Druck, Bozen Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne schriftliche Einwilligung der Gemeinde Sand in Taufers in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder sonst ein anderes Verfahren) reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Printed and bound in Italy / Germany Inhalt Vorworte 9 Helmuth Innerbichler DR. Luis Durnwalder DR. Michl Laimer 1 Auszeichnung 12 Eine SMS, ein Preis und eine weite Reise 2 Interview 18 „Ein Wir-Gefühl sollte entstehen“ 3 Bewertung 24 Jury beeindruckt vom Ideenreichtum 4 Preis 28 Was ist das für ein Preis? 5 Preisträger 30 Sensationell hohes Niveau 6 Kommission 38 Druck auf den roten Knopf 7 Historie - Kirche - Soziales - Jugend 42 „Der Mensch steht im Mittelpunkt“ 8 Vereine 50 Reges Leben in den Vereinen -

FAHRPLAN ORARIO · TIMETABLE Winter 09.12.18 - Bruneck - Tauferer Ahrntal 15.06.19 Brunico - Valle Aurina Inverno
FAHRPLAN ORARIO · TIMETABLE Winter 09.12.18 - Bruneck - Tauferer Ahrntal 15.06.19 Brunico - Valle Aurina Inverno Kundenzentrum Centro Clienti • Customer Center Mo – Fr / Lun - Ven / Mon – Fri Konsortium der Linienkonzessionsinhaber 8.00 – 12.00 / 14.00 – 18.30 der Autonomen Provinz Bozen Südtirol Consorzio dei concessionari di linea della Sa/Sab/Sat 8.00 – 12.00 Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige Ahrntaler Str. 17 Via Valle Aurina • Sand in Taufers/Campo Tures Tel. 0474 676 555 • [email protected] • www.serbus.it Netzplan • Rete • Network 4-5 Schulkalender • Calendario scolastico •School Calendar 27 Fahrplan • Orario Montag bis Freitag / Lunedì-Venerdì / Monday to Friday Timetable Kasernð Sand in Taufers ð Bruneck Bruneck – Tauferer Ahrntal Casereð Campo Tures ð Brunico ..................................................6-9 Brunico – Valle Aurina Bruneckð Sand in Taufers ð Kasern Brunicoð Campo Tures ð Casere................................................14-16 09. 12.2018 – 15.06 .201 9 SchülerfahrtenLiniendienst/ Corse scolastiche d.linea/Sched.school services Änderungen vorbehalten • Salvo modificazioni Subject to modifications Kasernð Sand in Taufers ð Bruneck Casereð Campo Tures ð Brunico...............................................23-2 4 Bruneckð Sand in Taufers ð Kasern Brunicoð Campo Tures ð Casere...............................................25-26 Samstag / Sabato / Saturday Kasernð Sand in Taufers ð Bruneck Casereð Campo Tures ð Brunico...............................................28-30 Bruneckð Sand in Taufers ð Kasern -

Schwärmen Von Südtirol. Nur: Wohin Genau? Ins Tauferer Ahrntal, Findet
FREITAG Programmpunkt 1: das Büro vergessen. Mit Kräutern schwitzen, mit Schafen blöken und dann Ruhe geben mit einem dicken Stück Pizza im Mund. WOCHENENDE MIT KIND SCHAF SEI DANK! AUS SEINER WOLLE WERDEN WARME PANTOFFELN GEFERTIGT. 6 2 5 Südtirol 16.30 ERST MAL EINMUMMELN 17.30 APERITIF AM WASSERFALL 20.00 PIZZA. WAS SONST? Im Naturhotel Moosmair (1) in Ahornach dreht Die Eltern bestellen sich in der Wasserfallbar Augen auf: Wer entdeckt den angeknabberten sich alles um Kräuter, ob im Spa oder in der (4) beim Wirt Manni einen weißen Bitter mit Käse aus Holz zuerst? Eine kleine Pizza in der Alle schwärmen von Südtirol. Nur: Wohin genau? Ins Tauferer Ahrntal, Küche (www.moosmair.it, DZ ab 65 Euro p. P). Prosecco, die Kleinen toben sich im Wald vor Mausefalle (7) reicht meist, die Portionen sind Praktisch: ein Apartment in der Villa Calluna der Tür aus. In zehn Minuten ist man bei dem ziemlich groß. Oft voll besetzt, also besser findet die Nido-Autorin Verena Duregger. Wo sonst gibt es eine Wasserfall- (2) in Sand. Von Nummer 4 aus hat man den ersten der drei gewaltigen Wasserfälle (5), bis reservieren (+39/0474/686280). Raffinierter bar, einen Klettergarten für Kinder und ein Feuerwehrhelmmuseum? schönsten Blick auf die Burg Taufers (www. hierher kommt man auch mit dem Kinderwa- ist die Küche im Restaurant Zumturm (8). Un- villacalluna.com, ab 90 Euro). Ruhig und güns- gen. Über die Brücke spazieren und bei Helene bedingt die Tagliata vom Weiderind probieren. tig: die Pension Mitterbach (3) in Weißenbach Brusa schön warme Pantoffeln in ihrer Schaf- Den Absacker vor dem Zubettgehen gibt es im (pension-mitterbach.it, ab 26 Euro pro Kopf). -

South Tyrol the Other Side of Italy Tips on Places to Visit for Great Experiences
South Tyrol The other side of Italy Tips on places to visit for great experiences With extra panoramic map South Tyrol The other side of Italy Tips on places to visit for great experiences Above: The Dolomites – ski a UNESCO World Heritage site in Val Gardena. Cover image: Wine and culture – gentle hills surround the Lebenberg Castle near Merano. SOUTH TYROL - OVERVIEW 1 SEISER ALM South Tyrol Europe’s largest high-Alpine pasture. Ideal for hiking, running or cycling, ranging from easy to challenging. Highlights With great views of the Dolomites and 365 Alpine farms and mountain huts. GLORENZA/GLURNS BOLZANO/BOZEN Italy’s smallest city, an architectural gem South Tyrol's capital city. in the Val Venosta/Vinschgau valley The city is a symphony of bilingualism, cultural region. A visit is like travelling a tribute to culture and nature, SELLARONDA back to the 16th century. A perfect a place to enjoy the symbiosis of The circular tour of the Sella massif, stopover on the Via Claudia Augusta the Alpine and the Mediterranean in winter on skis, in summer by bike, cycling route. so much that you want to stay. all against the magnificent backdrop of the Dolomites with their precipitous rock faces - you’ll never tire of it. TRAUTTMANSDORFF CASTLE GARDENS WINE ROAD MESSNER MOUNTAIN MUSEUMS The botanical gardens of Trauttmans- A wine odyssey. Travel through A series of museums created dorff Castle offer a play of colours vineyards, stop off and enjoy the by extreme mountaineer Reinhold and scents that your senses will long excellent wines of South Tyrol. -
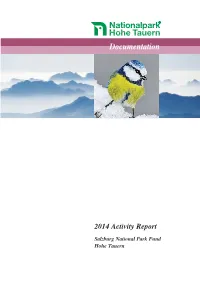
Documentation
Documentation 2014 Activity Report Salzburg National Park Fund Hohe Tauern Publication details Cover picture: The Eurasian blue tit (Parus caeruleus) inhabits deciduous and mixed woodlands characterised by a degree of coarse woody debris. It often prefers sparse stands with sunny exposures. In the more open Tauern valleys this species of tit can be found in the richly structured cultural landscape, providing it offers established deciduous stands of ash and sycamore maple, for example. Given the low proportion of deciduous and mixed woodlands in the Hohe Tauern National Park, sightings of this breeding bird are relatively infrequent. Its breeding range extends upwards to elevations of approx. 1100 m. In late summer and autumn roaming and migrating blue tits have occasionally been spotted in alder stands as high up as the tree line (photo: R. RIEDER). Media owner, editor, and publisher: Salzburg National Park Fund Hohe Tauern, Gerlos Straße 18, A-5730 Mittersill, Austria Editorial team and responsible for contents: Kristina BAUCH and Wolfgang URBAN Project management and co-ordination: Kristina BAUCH Translations: Stephen B. Grynwasser on behalf of AlpsLaRete Photos: Hohe Tauern National Park archives, unless otherwise specified; Page 8: Top photos, from left to right: C. BAUMGARTNER/NP Donauauen, Marek/NP Thayatal, F. RIEDER/NP Hohe Tauern Salzburg; Bottom photos, from left to right: C. FÜRNHOLZER/NP Gesäuse, E. WEIGAND/NP Kalkalpen, Neusiedler See – Seewinkel Archives; Page 20 and back cover: Photo G. GRESSMANN PAGE 23: PHOTO M. KNOLLSEISEN -

Bericht LAG TAT 31 12 2009
LAG Tauferer Ahrntal Schwerpunkt Leader. Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum 2007-2013 VO (EG) Nr. 1698/2005 Bericht zum 31.12.2009 über die Umsetzung des Leader Programms Tauferer Ahrntal I. Allgemeines zur Lokalen Aktionsgruppe Tauferer Ahrntal 1) Das Gebiet der LAG Tauferer Ahrntal Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 3684 vom 13.10.2008 ist der durch die Gemeinden Gais, Sand in Taufers, Mühlwald, Ahrntal und Prettau erstellte Lokale Aktionsplan für das Tauferer Ahrntal beschlossen worden. Das Gebiet hat eine Ausdehnung von 629 km² und umfasst 15.352 Einwohner (Stand Jahr 2001). Es handelt sich dabei um ein relativ peripheres, aber doch zusammenhängendes Gebiet. Seit einigen Jahren haben die peripheren Gemeinden einen leichten Abwanderungstrend zu verzeichnen, weshalb Stabilisierungsmaßnahmen – wie sie im Rahmen der Fördermaßnahme Leader vorgesehen sind – ergriffen werden müssen. 2) Die Lokale Aktionsgruppe Tauferer Ahrntal Die Lokale Aktionsgruppe Tauferer Ahrntal wurde mit Beschluss der Bezirksgemeinschaft Pustertal Nr. 180/BA vom 19.06.2008 eingesetzt. Sie besteht aus 9 Mitgliedern, wovon 4 als Vertreter von öffentlichen Institutionen (Gemeinden) entsandt wurden und 5 (aus dem privaten Bereich kommen. - 1 - LAG Tauferer Ahrntal Die Lokale Aktionsgruppe Tauferer Ahrntal ist im Jahr 2009 zu insgesamt 4 Sitzungen zusammengetroffen, in denen die Umsetzung der im Programm vorgesehenen Maßnahmen diskutiert und beschlossen wurden, insbesondere wurde: a. Die operative Planung und Entwicklung von Projekten vorgenommen, so wie sie im Lokalen Aktionsplan programmatisch vorgesehen sind. Damit hat die Lokale Aktionsgruppe Tauferer Ahrntal die operative Umsetzung des Programms Leader 2007-2013 eingeleitet; b. Eine Reihe von Projekten diskutiert, beschlossen und zur Ausführung delegiert, wie sie in der unten angeführten Liste (Seiten 4 – 6) übersichtlich dargestellt werden; c. -

Summer in the Kronplatz Region
01. APRIL 2020 Summer in the Kronplatz region Summer Legendary and Fabulously Beautiful – The UNESCO World Heritage Site of the South Tyrol-Südtirol Dolomites “Highly distinctive mountain landscapes that are of exceptional natural beauty with aesthetic appeal” are worthy of being declared a world heritage site. Anyone who views the “pale peaks” glowing in the last light of the evening above dark forests understands immediately why it was that in 2009, the South Tyrol-Südtirol Dolomites were inscribed in the list of world heritage sites because of their scenic uniqueness as well as because of their geological and geomorpological particularities. kronplatz.com/en/dolomites-unesco Three Nature Parks One important aspect is also the botanical variety of more than 2,400 plant species which are especially protected in the extensive nature parks and national parks. A total of three out of South Tyrol-Südtirol’s seven nature parks lie within the territory of the Kronplatz region: the Fanes-Senes- Braies/Fanes-Sennes-Prags and Puez/Odle-Geisler in the Dolomites and the Vedrette di Ries-Aurina/Rieserferner-Ahrn Nature Park in the area of the Central Alps. The Visitor Centers inform visitors about dealing with nature attentively and about the special features of each region. kronplatz.com/en/nature-parks Earth Pyramids One extraordinary natural phenomenon in South Tyrol-Südtirol is the earth pyramids. They can be marveled at, for example, in Plata-Platten near Perca-Percha and in Terento-Terenten. Those in Terento came into existence most likely as a result of a violent storm in which giant masses of rubble were washed away by the Rio Terento-Terner Bach stream. -

Zeltlagerplatz Taufers
Zeltlagerplatz Taufers Anfahrt und Lageplan: Von Bruneck Richtung Sand in Taufers abbiegen. Nach dem Dorf Mühlen in Taufers folgt der Ortsteil Taufers mit der großen Zeltlagerplatz Pfarrkirche. Bei der Kreuzung vor Taufers der Pfarrkirche nach links abbie- im Pustertal gen (zwischen Volks- und Mittelschule) und bis zum Ende der Straße fahren. Somit befinden Sie sich direkt vor dem Pfarrheim und Jugenddienst . Kontakt und Verwaltung: Jugenddienst Dekanat Taufers Pfarre 3 I-39032 Sand in Taufers (BZ) Telefon: +39 0474 678 119 Mobil: +39 349 37 16 544 E-mail: [email protected] www.jugenddienst.it/taufers Willkommen im schönen Die Meereshöhe liegt bei 860 m und die Die Warmwasserproduktion erfolgt anliegenden Dörfer Mühlen -, Sand -, und durch einen Elektroboiler. Tauferer Ahrntal: Kematen in Taufers sind rund 1 km ent- Der Platz ist mit PKW problemlos zu fernt und sind zu Fuß problemlos zu errei- Das Tauferer erreichen um Gebäck usw. ein- und chen. Ahrntal ist auszuladen. Parkmöglichkeiten sind vor Oberhalb der Pfarrkirche befindet sich das nördlichs- dem Pfarrheim genügend vorhanden. eine Lienenbushaltestelle, welche im te und auch Geschirr, Trockentücher, usw. müssen Halbstundentakt angefahren werden und eines der von den Besuchern selbst mitgebracht Sie bis nach Bruneck oder Kasern g r ö ß t e n werden. bringen. Auch gibt es einen Citybus, der Seitentäler im Stundentakt durch die 3 oben genann- Südtirols. Mit einer Fläche von 627 km² ten Dörfer fährt, aber auch bei der erstreckt sich das Tal über die Gemein- Was gibt’s bei uns noch?? Pfarrkirche eine Haltestelle hat. den Prettau, Ahrntal, Sand in Taufers, Gais und Mühlwald. Am Lagerplatz befindet sich eine Namengebend ist der Fluss Ahr. -

Folder-Download: Mobil Ohne Auto
In die Seitentäler MOBIL OHNE AUTO Zillergrund Zamsergrund Floitengrund Tauferer Ahrntal Krimmler Achental Schmirntal Am nordöstlichen Rand des Naturparks wartet eine interessante Kombina- Der Zamsergrund ist Ausgangspunkt für Touren entlang des Berliner Hö- Vom Bergsteigerdorf Ginzling aus wandert man im Schutze seines Haus- Das 40 km lange Tauferer Ahrntal wird umrahmt von 80 Dreitausendern Weit über die Grenzen hinweg bekannt sind die Krimmler Wasserfälle, Das Schmirntal, ein östliches Seitental des Wipptales, zählt zu den tion von Natur und Technik! Umgeben von weitgehend unberührter Land- henweges, zum Friesenberghaus, zur Olperer Hütte und zum Furtschagl- bergs - dem Dristner (2.767 m) - gemütlich taleinwärts und passiert Jau- der Zillertaler Alpen, der Durreck und Rieserferner Gruppe. Die einmalige die Hauptattraktion des Krimmler Achentales. Aber auch historische schönsten und unberührtesten Bergtälern Tirols und ist Ausgangspunkt für schaft schließt ein in 1.850m Höhe gelegener Staudamm das Zillergründl haus sowie für die Querung des Pfi tscher Joches nach Südtirol. Beeindru- senstationen wie die Tristenbachalm, Steinbockhütte oder Sulzenalm. Den Lage macht das Tauferer Ahrntal zum Herzstück des Naturparks Wege, wie der alte Handelsweg über den Tauernhauptkamm – zwischen viele Wanderungen, von der leichten Talwanderung auf dem ab und staut den Ziller zu einem 506m langen und 86,7 Mio. m³ fassen- ckend thront der Schlegeiskees mit hochalpinen Gipfeln wie dem Großen Talschluss bilden majestätisch der Floitenkees und Gipfel wie der Löffl er Rieserferner-Ahrn. In den neuen Naturpark-Häusern in Kasern und dem Ahrntal und dem Oberpinzgau – gewinnen wieder an Bedeutung. „Sonnseitenweg“ bis zur Klettertour auf den Olperer. Besonders den Stausee auf. Bis Bärenbad führt eine Mautstrecke, von dort kommen Möseler oder dem Hochfeiler über dem Schlegeisspeicher. -
Sand in Taufers PIANIFIC Comune Di Campo Tures
AZIONEPAESAGGISTICA LANDSCHAFTSPLANUNG Gemeinde Sand in Taufers PIANIFIC Comune di Campo Tures Landschaftsplan Piano paesaggistico Beschluss der Landesregierung Nr. 2769 vom 16.11.2009 Delibera della Giunta Provinciale n. 2769 del 16/11/2009 Planverfasser / Redattore del piano: Dr. KONRAD STOCKNER Tel.: 0471-417739 Amt für Landschaftsökologie / Ufficio Ecologia del paesaggio www.provinz.bz.it/natur AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE Seite / Pag. 1 Erläuternder Bericht 1. Ausgangslage und Zielsetzungen 2 2. Gebietsbeschreibung 3 3. Schutzmaßnahmen 5 Gebiete von landschaftlichem Interesse........................................................................5 Landschaftliche Bannzonen ..........................................................................................8 Biotop Kematner Ahrauen ...........................................................................................10 Naturdenkmäler...........................................................................................................12 Gärten und Parkanlagen .............................................................................................13 Landschaftliche Strukturelemente ...............................................................................14 Baumschutz und urbanes Grün...................................................................................15 Archäologische Schutzgebiete ....................................................................................15 Neuabgrenzung des Naturparks -
Ruhegebiet "Zillertaler Hauptkamm“
Naturinventar Ruhegebiet "Zillertaler Hauptkamm“ Bibliographie von Karl Pangerl im Auftrag des Oesterreichischen Alpenvereines Fachabteilung Raumplanung/Naturschutz Redaktionelle Bearbeitung: Peter Haßlacher Fachbeiträge des Oesterreichischen Alpenvereins Serie: Alpine Raumordnung Nr. 6 Innsbruck 1993 2 Die Erstellung der Bibliografie für das Naturinventar Ruhegebiet „Zillertaler Hauptkamm“ wurde von der Österreichischen Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz aus Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie gefördert. Die Drucklegung dieses Bandes wurde zur Gänze vom Amt der Tiroler Landesregierung – Abeilung Umweltschutz – finanziert. Die nachfolgende Bibliogrpahie kann auch auf Diskette (Word 5) beim Oesterreischischen Alpenver- ein, Fachabteilung Raumplanung/Naturschutz, Wilhelm-Geil-Straße 15, A-6020 Innsbruck angefordert werden. Anmerkung Diese PDF-Datei ist eine inhaltlich identische digitale Version der Bibliographie von Pangerl (1993). In Folge einer Nachbearbeitung, um das Suchen & Kopieren zu ermög- lichen, unterscheidet sich diese Version allerdings ab Seite 15 in den Seitenzahlen von der Originalfassung. Impressum: Titelbild: Herausgeber und Verleger: Oesterreichischer Alpenverein Blick auf das Bergsteigerdorf Verwaltungsausschuß Ginzling am Eingang in den Wilhelm-Greilstr. 15 Floitengrund (Zillertaler 6020 Innsbruck Alpen) Für den Inhalt verantwortlich: Fachabteilung Raumplanung / Naturschutz Oesterreichischer Alpenverein Wilhelm-Greilstr. 15 Foto: Athanas Gritzer 6020 Innsbruck Herstellung: Pinxit-DeskTopPublishing