BEGEGNUNG 1/2020: Schule
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
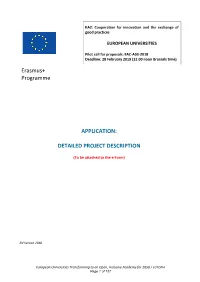
Erasmus+ Programme APPLICATION
KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices EUROPEAN UNIVERSITIES Pilot call for proposals: EAC-A03-2018 Deadline: 28 February 2019 (12.00 noon Brussels time) Erasmus+ Programme APPLICATION: DETAILED PROJECT DESCRIPTION (To be attached to the e-Form) EN Version 2018 European Universities Transforming to an Open, Inclusive Academy for 2050 / EUTOPIA Page 1 of 157 PART I. Relevance of the proposal (max.25 points) Please attach the mission statement of your alliance to the e-Form. The mission statement should: - be endorsed by the relevant decision-making bodies in each of the partner institutions - explain what your European University alliance will look like in 2025 - explain the unique and differentiated vision of your alliance, building on the section "What are European Universities" from the 2019 Erasmus+ Programme Guide1 I.1 Relevance of the proposal: Please describe what your European University alliance will look like in 3 years and explain how it will progress towards the long-term vision described in your mission statement (max.1000 words) The proposal will promote practical development of the universities into a distinctive, daring and driven European University alliance: EUTOPIA, that transforms 21st-century education, challenge-based research and place-shaping relevance. EUTOPIA will employ a long-term vision (whose horizon is 2050), a mid-term project and ambition (2025), and a short-term piloting plan (three years) to realize its ambitions. a. Long-term vision The vision is of a fully federated inter-university -

Deutscher Bundestag Unterrichtung
Deutscher Bundestag Drucksache 16/5016 16. Wahlperiode 12. 04. 2007 Unterrichtung durch die Bundesregierung Bericht der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) über die Exportinitiative Erneuerbare Energien für das Jahr 2005 Inhaltsverzeichnis Seite Einleitung . 4 1 Zusammenfassung und weiterer Handlungsbedarf . 4 1.1 Exportsituation . 4 1.2 Aktivitäten der Exportinitiative Erneuerbare Energien . 5 1.3 Bilanz der Exportinitiative Erneuerbare Energien . 6 1.4 Exporthemmnisse und Handlungsbedarf . 7 2 Exportsituation der deutschen EE-Industrie . 7 2.1 Windenergie . 8 2.2 Photovoltaik . 9 2.3 Solarthermie . 10 2.4 Solarthermische Stromerzeugung . 11 2.5 Bioenergie . 11 2.5.1 Biogas . 12 2.5.2 Biotreibstoffe . 13 2.5.3 Feste Biomasse . 13 2.6 Wasserkraft . 13 2.7 Geothermie . 14 3 Exporthemmnisse für deutsche EE-Unternehmen . 15 3.1 Hemmnisse im Inland . 15 3.2 Hemmnisse im Ausland . 18 Zugeleitet mit Schreiben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie vom 3. April 2007 gemäß Beschluss des Deutschen Bundestages vom 17. Februar 2005 (Bundestagsdrucksache 15/4868). Drucksache 16/5016 – 2 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode Seite 3.3 Finanzierung und Risikoabsicherung . 21 3.3.1 Finanzierung der Projektentwicklung . 22 3.3.2 Finanzierung des Projekts . 22 3.3.3 Zusammenfassung/Ausblick . 24 4 Aktivitäten der Exportinitiative Erneuerbare Energien . 24 4.1 Vernetzung . 24 4.1.1 Bericht an den Deutschen Bundestag . 24 4.1.2 Koordinierungskreis . 24 4.1.3 www.exportinitiative.de und Inlands-Newsletter . 25 4.1.4 Auslands-Newsletter und Online-Forum . 26 4.1.5 Unternehmensansprache . 26 4.2 Auslandsmarktinformationen . 26 4.3 Auslandsmarketing „renewables made in Germany“ . 27 4.3.1 Technologieausstellung . -

Informationen Für Absolventinnen Und Absolventen Deutscher Auslands- Und Partnerschulen 2 Partnerschulen Der Universität Heidelberg
INFORMATIONEN FÜR ABSOLVENTINNEN UND ABSOLVENTEN DEUTSCHER AUSLANDS- UND PARTNERSCHULEN 2 PARTNERSCHULEN DER UNIVERSITÄT HEIDELBERG Alexander von Humboldt Schule Montréal, Kanada Deutsche Schule Washington, D.C., USA Colegio Alemán de Guadalajara, Mexiko Colegio Alemán Alexander von Humboldt La Herradura, Mexiko Colegio Alemán Alexander von Humboldt Lomas Verdes, Mexiko Colegio Alemán Alexander von Humboldt Xochimilco, Mexiko Colegio Alemán, Cali, Kolumbien Deutsche Schule Medellín, Kolumbien Deutsche Schule Barranquilla, Kolumbien Colegio Humboldt Caracas, Venezuela Deutsche Schule Rio de Janeiro, Brasilien Deutsche Schule Helsinki, Finnland Deutsche Schule zu Porto, Portugal Deutsche Schule Madrid, Spanien Deutsche Schule San Alberto Magno, San Sebastián, Spanien Galabov-Gymnasium Sofia, Bulgarien Deutsche Schule Athen, Griechenland Deutsche Schule Thessaloniki, Griechenland Ellinogermaniki Agogi, Pallini, Griechenland Istanbul Lisesi, Türkei Deutsche Schule Istanbul, Türkei ALKEV Gymnasium, Istanbul, Türkei Deutsche Schule Rom, Italien Deutsche Schule Genua Deutsche Schule der Borromäerinnen Alexandria, Ägypten Deutsche Schule der Borromäerinnen Kairo, Ägypten Deutsche Schule Nairobi, Kenia Deutsche Botschaftsschule Addis Abeba, Äthiopien Deutsche Internationale Schule Kapstadt, Südafrika Deutsche Internationale Schule Beirut, Libanon (Stand: Dezember 2019) Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Absolventinnen und Absolventen, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern, Anfang des Jahres 2008 rief der Deutsche Akademische Austauschdienst -

Jahresbericht 2004
DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT IN ROM Jahresbericht 2004 Die Aufnahme neuer, zeitlich befristeter Projekte, sowie reiche Erträge historischer Grundlagenforschung haben das Forschungspro- fil des DHI Rom im Jahr 2004 gestärkt. Sechs Text- und Indicesbände wurden in der Reihe des Repertorium Germanicum vorgelegt. Die noch fehlende Teiledition von Bertalots Initia Humanistica Latina ist ebenso erschienen wie der abschließende Band des Codex Diplomati- cus Amiatinus sowie eine weitere Publikation in der Reihe der Nuntia- turberichte aus Deutschland. Im Rahmen eines Drittmittelprojektes konnten die Arbeiten an einer kritischen Edition der Summa Trium Librorum des Rolandus de Luca in Angriff genommen werden, eines Textes, der für die Entwicklung der europäischen Rechtskultur im Mittelalter von besonderem Interesse ist. Mit der Edition der Tagebü- cher 1938 bis 1940 von Luca Pietromarchi wurde ein Projekt begon- nen, das eine wichtige Quelle zum italienischen Faschismus sowie zur faschistischen Außenpolitik erschließt. Verstärkt wurden im Jahr 2004 in die wissenschaftliche Arbeit des DHI neue Medien und Techniken einbezogen. Sie dienen sowohl wissenschaftlichen Projekten als auch einer verbesserten Außendar- stellung der Institutsarbeit, der auch ein neues Institutslogo dienlich sein soll. Die Arbeit an Onlinepublikationen wurde ebenso intensiviert wie die Vorbereitung eines Relaunchs der Homepage des Instituts. Der Jahressitzung des wissenschaftlichen Beirates war in die- sem Jahr am 19. und 20. 2. eine Tagung unter dem Titel „Forschungs- -

Sabine Ehrmann-Herfort Und Michael Matheus (Hrsg.) Von Der Geheimhaltung Zur Internationalen Und Interdisziplinären Forschung
Sabine Ehrmann-Herfort und Michael Matheus (Hrsg.) Von der Geheimhaltung zur internationalen und interdisziplinären Forschung. Die Musikgeschichtliche Abteilung des Deutschen Historischen Instituts in Rom 1960– 2010 Schriftenreihe Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom Band 123 (2010) Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom DOI: 10.1515/9783110250800 Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat der Creative- Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine Bearbeitung (CC BY-NC-ND 4.0) unterliegt. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode BIBLIOTHEK DES DEUTSCHEN HISTORISCHEN INSTITUTS IN ROM BAND 123 Von der Geheimhaltung zur internationalen und interdisziplinären Forschung Die Musikgeschichtliche Abteilung des Deutschen Historischen Instituts in Rom 1960–2010 HERAUSGEGEBEN VON SABINE EHRMANN-HERFORT UND MICHAEL MATHEUS De Gruyter ISBN 978-3-11-025073-2 e-ISBN 978-3-11-025080-0 ISSN 0070-4156 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der -

DEUTSCHE AUSLANDSSCHULEN Chancen Weltweit – Lehrer Und Erzieher Gesucht
GEMEINSAM ZUKUNFT TRAGEN DEUTSCHE AUSLANDSSCHULEN Chancen weltweit – Lehrer und Erzieher gesucht. Mit Verzeichnis: WDA-Mitglieder Inhalt ZAHLEN UND FAKTEN 4 WELTWEITE WERTBEITRÄGE 5 AUSLANDSLEHRKRÄFTE IM PORTRÄT 7 WEGE INS AUSLAND 12 IHRE BEWERBUNG: DARAUF SOLLTEN SIE ACHTEN 14 WDA-MITGLIEDSCHAFT: IHRE VORTEILE 15 WDA-MITGLIEDERVERZEICHNIS 16 2 EIN EINZIGARTIGES GLOBALES NETZWERK Die Deutschen Auslandsschulen ermöglichen weltweit Bildung „Made in Germany“ − auf allen Kontinenten, in mehr als 70 Ländern. Als Orte der Begegnung bereiten die Schulen Kinder und Jugendliche verschiedener Kulturkreise auf eine gemein- same Zukunft vor. Sie bieten fundierte Wissensvermittlung, vom Kindergarten bis zum Abitur. Und sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der deutschen Sprache. Seit Generatio- nen, für Generationen. Die Abschlüsse der Deutschen Auslandsschulen gelten interna- tional als Qualitätsbegriff. Sie stehen für hochwertige Bildung, die zum Studium an deutschen und ausländischen Hochschulen befähigt – und damit weit über einen Sprachkurs hinausgeht. Sie machen die Deutschen Auslandsschulen zu Leuchttürmen der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik und zu verlässlichen Partnern für Schulbildung auf höchstem Niveau. Bund, Länder und die freien Schulträger nehmen diese Aufgaben gemeinschaftlich wahr. Diese öffentlich-private Partnerschaft sichert eine gleichbleibend hohe Qualität der Lehre. Der Welt- verband Deutscher Auslandsschulen, kurz WDA, vertritt die freien, gemeinnützigen Schulträger der Deutschen Auslands- schulen und -

DSD II-Schulen
Sekretariat der Kultusministerkonferenz Liste der ausländischen Sekundarschulen mit Möglichkeit zum Erwerb des DSD II Land Schulort Schule Aegypten Alexandria Future Language School Alexandria El Gouna El Gouna International School, El Gouna Kairo Deutsche Evangelische Oberschule Kairo Kairo Deutsche Schule Beverly Hills, Kairo Kairo Deutsche Schule Heliopolis, Europa-Schule Kairo Albanien Elbasan Fremdsprachenmittelschule "Mahmut dhe Ali Cungu", Elbasan Shkoder Fremdsprachenmittelschule Sheijnaze Juka, Shkoder Tirana Fremdsprachenmittelschule "Asim Vokshi", Tirana Argentinien Bariloche Deutsche Schule Bariloche Buenos Aires Deutsche Schule Villa Ballester Buenos Aires Gartenstadt-Schule El Palomar, Buenos Aires Buenos Aires Goethe-Schule Buenos Aires Buenos Aires Hölters-Schule Villa Ballester Buenos Aires Humboldt-Sprachakademie an der Goethe-Schule Buenos Aires Buenos Aires Pestalozzi-Schule Buenos Aires Buenos Aires Schiller Schule Buenos Aires Cordoba Deutsche Schule Cordoba Eldorado Hindenburg-Schule Eldorado Florida Rudolf-Steiner-Schule Florida Hurlingham Deutsche Schule Hurlingham Lanus Oeste Deutsche Schule Lanus Oeste Mar del Plata Johann Gutenberg Schule Montecarlo Deutsche Schule Montecarlo Quilmes Deutsche Schule Quilmes Rosario Goethe-Schule Rosario Temperley Deutsche Schule Temperley Villa General Belgrano Deutsche Schule Villa General Belgrano Armenien Eriwan Mesrop-Maschtoz Schule, Eriwan Eriwan Mittelschule Nr. 5 Eriwan Eriwan Mittelschule Nr. 6 Hakob Karapentsi Bolivien Cochabamba Colegio Fröbel Cochabamba La Paz Deutsche Schule La Paz Oruro Colegio Aleman Oruro Santa Cruz de Bolivia Deutsche Schule Santa Cruz de Bolivia Bosnien-Herzegowina Banja Luka Gymnasium Banja Luka Mostar Gymnasium Mostar Sarajewo 2. Gymnasium Sarajewo Sarajewo 3. Gymnasium Sarajewo Seite 1 von 14 Stand: 06.05.2008 Sekretariat der Kultusministerkonferenz Liste der ausländischen Sekundarschulen mit Möglichkeit zum Erwerb des DSD II Land Schulort Schule Sarajewo 4. -

DEUTSCHE AUSLANDSSCHULEN Chancen Weltweit – Lehrer Und Erzieher Gesucht
GEMEINSAM ZUKUNFT TRAGEN DEUTSCHE AUSLANDSSCHULEN Chancen weltweit – Lehrer und Erzieher gesucht. Mit Verzeichnis aller WDA-Mitglieds- schulen EIN EINZIGARTIGES GLOBALES NETZWERK INHALT Die Deutschen Auslandsschulen ermöglichen weltweit Bildung ZAHLEN UND FAKTEN 4 „Made in Germany“ − auf allen Kontinenten, in mehr als 70 Ländern. Als Orte der Begegnung bereiten die Schulen Kinder LEHRER-WELTWEIT.DE 5 und Jugendliche verschiedener Kulturkreise auf eine gemein- same Zukunft vor. Sie bieten fundierte Wissensvermittlung, vom LEHRKRÄFTE IM AUSLAND IM PORTRÄT 6 Kindergarten bis zum Abitur. Und sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der deutschen Sprache. Seit Generatio- LEHRKRÄFTE WELTWEIT: nen, für Generationen. EIN AUFTRAG, ZWEI WEGE 12 Die Abschlüsse der Deutschen Auslandsschulen gelten interna- tional als Qualitätsbegriff. Sie stehen für hochwertige Bildung, PRAKTIKA AN AUSLANDSSCHULEN 14 die zum Studium an deutschen und ausländischen Hochschulen befähigt – und damit weit über einen Sprachkurs hinausgeht. Sie CHECKLISTE: BEWERBUNG ALS ORTSLEHRKRAFT ODER machen die Deutschen Auslandsschulen zu Leuchttürmen der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik und zu verlässlichen ORTSKRAFT 16 Partnern für Schulbildung auf höchstem Niveau. WDA-MITGLIEDSCHAFT: IHRE VORTEILE 17 Bund, Länder und die freien Schulträger nehmen diese Aufgaben gemeinschaftlich wahr. Diese öffentlich-private Partnerschaft WDA-MITGLIEDERVERZEICHNIS 18 sichert eine gleichbleibend hohe Qualität der Lehre. Der Welt- verband Deutscher Auslandsschulen, kurz WDA, vertritt die freien, gemeinnützigen Schulträger der Deutschen Auslands- schulen und fasst ihre Einzelstimmen zu einer starken Stimme zusammen. Etwa 20.000 deutsche und 64.000 nichtdeutsche Schüler besu- chen derzeit die Deutschen Auslandsschulen. Mehr als 8.400 Lehrkräfte sind dort tätig. Lehrern, Erziehern und Führungskräften im Bildungswesen bieten die Deutschen Auslandsschulen viel- fältige berufliche Perspektiven. Lernen Sie dieses einzigartige globale Netzwerk kennen und werden Sie ein Teil davon. -

Anuario-2017.Pdf
Coordinación General: Volker Stender-Mengel Dr. Marcus Schawe Katherine Fuentes Edición de Textos: Volker Stender-Mengel Ana-Rosa López Fotografía: Katherine Fuentes Ana-Rosa López Natalia Peñaranda Concepto de Diseño y Diagramación: Gabriela Fajardo E. Traducción: Hans Huber Ximena González La Paz - Bolivia Dirección Volker Stender-Mengel 2017 - Ein gutes Jahr Schulleiter 2017 - Un buen año Director „2017 bescherte uns aber auch so viele außergewöhnlichen Leistungen und die Abiturientinnen und Abiturienten sympathische Präsentation unserer Schule! wie noch nie: 35! Früher, als es noch Mit einem großen Acto wurde das gesamte Team nach seiner Rückkehr von allen die „Selecta“ gab und damit ein Schülerinnen und Schülern gebührend zusätzliches dreizehntes Schuljahr gefeiert. für die, die das Abitur machen wollten, hieß es scherzhaft: „Ab acht Zum zweiten Mal gab es 2017 ein wird geteilt!“ Denn oft saß nur eine erfolgreiches CAMBMUN: Model United Handvoll Schülerinnen und Schüler Nations des Colegio Alemán Mariscal Braun. In Gänze von unseren Schülerinnen in der Selecta.“ und Schülern organisiert, diskutierten –wie schon 2016– etliche Teilnehmerinnen und Liebe Schulgemeinde, Teilnehmer auch anderer Schulen drei Tage lang weltpolitische Themen und jetzt ist –wie schnell!– schon wieder ein schlüpften dabei in die Rolle von konkreten ganzes Schuljahr vergangen, ein erneut Ländervertreter/innen: USA, Deutschland, ereignisreiches Jahr, aus dem sicherlich Bolivien u.a. - Politische Bildung par die erfolgreiche Teilnahme an den excellence, engagiert begleitet von Humboldtspielen im Mai ‘17 in Quito unserer Kollegin Marinella Bueno. hervorsticht: 16 Sportlerinnen und Sportler von uns sowie drei ihrer Trainer/innen, Ende September gab es bei uns ein ganz Lilly Ayllón, Ado Zacari und Edgar Aguayo, hervoragendes Internationales BigBand- nahmen an diesen Spielen teil, hatten Festival mit Beteiligung der Deutsche Schule sich zuvor lange und intensiv darauf Max Uhle Arequipa. -

Orff-Schulwerk Elementare Musik- Und Tanzpädagogik Elemental Music and Dance Pedagogy
Sommer 2016 Orff-Schulwerk Elementare Musik- und Tanzpädagogik Elemental Music and Dance Pedagogy 94 Interkulturalität in der Elementaren Musik- und Tanzerziehung II Interculturality in Elemental Music and Dance Pedagogy II Publikationen II Publications - Winter 2015 CHANGES?! Orff-Schulwerk Elementare Musik- und Tanzpädagogik 9. INTERNATIONALES Elemental Music and Dance Pedagogy ORFF-SCHULWERK SYMPOSIUM Elementare Musik- und Tanzpädagogik im WANDEL der Medien Interculturality in the Elemental Music and Dance Pedagogy in the Elemental Music Interculturality / 93 Interkulturalität in der Elementaren Musik- und Tanzerziehung Interculturality in the Elemental Music and Interkulturalität in der Elementaren Musik- und Tanzpädagogik Musik- in der Elementaren Interkulturalität Dance Pedagogy Orff-Schulwerk Weitere Informationen siehe Rückseite. Informationen siehe Weitere furtherFor information see back page. ISSNISSN 2312-8895 2305-9079 Schutzgebühr 5,– Euro 93 odh93_umschlag_def.indd 1 02.12.15 16:32 Zum Titelthema werden in Theorie und Praxis Three main questions have been asked in “The- drei großen Fragen nachgegangen: Warum, ory and Practice”: Why, what and how? Reports Was und Wie? Projektberichte ergänzen das of projects expand the theme clearly. They have Thema anschaulich. Dabei geht es vor allem to do above all with advocating music, dance and darum Musik, Tanz und Sprache und die an- speech and the other arts to further a sensibility deren Künste auch einzusetzen um interkul- to intercultural competence in thinking, feeling turelle Kompetenzen zu fördern, d. h. Sensi- and activities with people from other cultures – bilisierung zu fördern um Denken, Fühlen to learn understanding and respect. und Handeln von Menschen aus anderen Kul- turen verstehen und respektieren zu lernen. This approach has been distinctive to the Orff Institute for years. -

Schwarz Rot Gold in Bolivien Caminante, Se Hace Camino Al Andar Deutsche Spuren in Der Bolivianischen Barockmusik Von Schlangen
Erste Ausgabe 2014 / April Schwarz Rot Gold in Bolivien Caminante, se hace camino al andar Deutsche Spuren in der bolivianischen Barockmusik Von Schlangen mit zwei Köpfen und Lamas in Gehegen "Journalismus-Studium in Deutschland - Verbindung von Theorie und Praxis” 40 Jahre im Dienste in der Botschaft Auf den hinteren Seiten finden Sie weitere interessante Artikel www.la-paz.diplo.de Erste Ausgabe 2014 / April www.la-paz.diplo.de Editorial Liebe Leserinnen und Leser, mit dieser ersten Ausgabe des "BOLetins" möchte die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Bolivien einen Beitrag dazu leisten, die vielfältigen Aktivitäten und Projekte im Lande, die von deutschen Institutionen oder Organisationen, oft aber auch von bewundernswert engagierten Einzelpersonen durchgeführt werden, breiter vorzustellen. Wir wollen weniger über die schreiben oder die zu Wort kommen lassen, die schon sehr bekannt sind, sondern werden uns vor allem denen zuwenden, die abseits der ausgetretenen Pfade oft ganz im Stillen Großartiges leisten. Gleichzeitig wollen wir mit dazu beitragen, dass Leser untereinander in Kontakt treten können, wenn sie einen Artikel besonders interessant finden. Allerdings haben wir nicht die Absicht, dies in Form von Leserbriefen abzudrucken, sondern wollen das jedem Einzelnen direkt überlassen. Das "BOLetin" soll zweimal im Jahr, jeweils im Frühjahr und im Herbst erscheinen. Wir sind natürlich auf Ihre aller Hilfe angewiesen. Bitte geben Sie uns ein Feedback, wie Sie diese Mitteilungen aufnehmen, was Ihnen gefällt und was wir besser machen können. Und natürlich möchte ich Sie herzlich einladen, selbst einen Beitrag zu senden, den wir dann sehr gerne bekannt machen werden. Das "BOLetin" gibt es nur als pdf-Datei, die als email versandt wird oder auf der webpage der Botschaft abgerufen werden kann. -

Sekretariat Der Ständigen Konferenz Der Kultusminister Der Länder in Der Bundesrepublik Deutschland
C:\WINWORD\Listen, Übersichten\Bs1154.doc Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland Prüfungen zur Erlangung einer deutschen Hochschulzugangsberechtigung an Schulen im Ausland vom 01. August 2006 bis 31. Juli 2007 I. Abiturprüfung an deutschen Auslandsschulen nach der Ordnung der deutschen Abiturprüfung im Ausland vom 27.01.1995 i.d.F. vom 09.07.2004: Datum des KMK-Beschlusses über die Anerkennung der Schule: Griechenland: Deutsche Schule Athen 10.11.1959 Italien: Deutsche Schule Mailand 15.01.1959 Deutsche Schule Rom 14.05.1958 Schweden: Deutsche Schule Stockholm 04.01.1966 USA: Deutsche Schule Washington 13.03.1973 II. Reifeprüfung an deutschen Auslandsschulen nach der Ordnung der deutschen Reifeprüfung im Ausland vom 27.01.1995 i.d.F. vom 24.03.2004: Datum des KMK-Beschlusses über die Anerkennung der Schule: Ägypten: Deutsche Schule der Borromäerinnen in Alexandria 03.07.1996 Deutsche Schule der Borromäerinnen in Kairo 05.12.1995 Deutsche Evangelische Oberschule Kairo 31.08.1957 Belgien: Deutsche Internationale Schule Brüssel 19.11.1955 Deutsche Abteilung der Internationalen SHAPE-Schule in Shape 11.09.1992 ... - 2 China: Deutscher Zweig der Deutsch-Schweizerischen Internationalen Schule Hongkong 24.02.1984 Deutsche Schule Peking 07.10.1998 Deutsche Schule Shanghai 13.07.2005 Finnland: Deutsche Schule Helsinki 08.01.1963 Frankreich: Deutsche Schule Paris 05.04.1968 Deutsche Schule Toulouse 02.02.1988 Griechenland: Deutsche Schule Thessaloniki 08.11.1984 Großbritannien: Deutsche