Gesamtdatei Herunterladen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
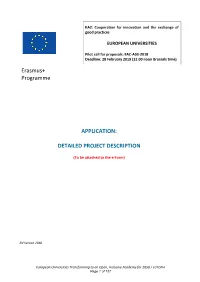
Erasmus+ Programme APPLICATION
KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices EUROPEAN UNIVERSITIES Pilot call for proposals: EAC-A03-2018 Deadline: 28 February 2019 (12.00 noon Brussels time) Erasmus+ Programme APPLICATION: DETAILED PROJECT DESCRIPTION (To be attached to the e-Form) EN Version 2018 European Universities Transforming to an Open, Inclusive Academy for 2050 / EUTOPIA Page 1 of 157 PART I. Relevance of the proposal (max.25 points) Please attach the mission statement of your alliance to the e-Form. The mission statement should: - be endorsed by the relevant decision-making bodies in each of the partner institutions - explain what your European University alliance will look like in 2025 - explain the unique and differentiated vision of your alliance, building on the section "What are European Universities" from the 2019 Erasmus+ Programme Guide1 I.1 Relevance of the proposal: Please describe what your European University alliance will look like in 3 years and explain how it will progress towards the long-term vision described in your mission statement (max.1000 words) The proposal will promote practical development of the universities into a distinctive, daring and driven European University alliance: EUTOPIA, that transforms 21st-century education, challenge-based research and place-shaping relevance. EUTOPIA will employ a long-term vision (whose horizon is 2050), a mid-term project and ambition (2025), and a short-term piloting plan (three years) to realize its ambitions. a. Long-term vision The vision is of a fully federated inter-university -

Deutscher Bundestag Unterrichtung
Deutscher Bundestag Drucksache 16/5016 16. Wahlperiode 12. 04. 2007 Unterrichtung durch die Bundesregierung Bericht der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) über die Exportinitiative Erneuerbare Energien für das Jahr 2005 Inhaltsverzeichnis Seite Einleitung . 4 1 Zusammenfassung und weiterer Handlungsbedarf . 4 1.1 Exportsituation . 4 1.2 Aktivitäten der Exportinitiative Erneuerbare Energien . 5 1.3 Bilanz der Exportinitiative Erneuerbare Energien . 6 1.4 Exporthemmnisse und Handlungsbedarf . 7 2 Exportsituation der deutschen EE-Industrie . 7 2.1 Windenergie . 8 2.2 Photovoltaik . 9 2.3 Solarthermie . 10 2.4 Solarthermische Stromerzeugung . 11 2.5 Bioenergie . 11 2.5.1 Biogas . 12 2.5.2 Biotreibstoffe . 13 2.5.3 Feste Biomasse . 13 2.6 Wasserkraft . 13 2.7 Geothermie . 14 3 Exporthemmnisse für deutsche EE-Unternehmen . 15 3.1 Hemmnisse im Inland . 15 3.2 Hemmnisse im Ausland . 18 Zugeleitet mit Schreiben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie vom 3. April 2007 gemäß Beschluss des Deutschen Bundestages vom 17. Februar 2005 (Bundestagsdrucksache 15/4868). Drucksache 16/5016 – 2 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode Seite 3.3 Finanzierung und Risikoabsicherung . 21 3.3.1 Finanzierung der Projektentwicklung . 22 3.3.2 Finanzierung des Projekts . 22 3.3.3 Zusammenfassung/Ausblick . 24 4 Aktivitäten der Exportinitiative Erneuerbare Energien . 24 4.1 Vernetzung . 24 4.1.1 Bericht an den Deutschen Bundestag . 24 4.1.2 Koordinierungskreis . 24 4.1.3 www.exportinitiative.de und Inlands-Newsletter . 25 4.1.4 Auslands-Newsletter und Online-Forum . 26 4.1.5 Unternehmensansprache . 26 4.2 Auslandsmarktinformationen . 26 4.3 Auslandsmarketing „renewables made in Germany“ . 27 4.3.1 Technologieausstellung . -

Informationen Für Absolventinnen Und Absolventen Deutscher Auslands- Und Partnerschulen 2 Partnerschulen Der Universität Heidelberg
INFORMATIONEN FÜR ABSOLVENTINNEN UND ABSOLVENTEN DEUTSCHER AUSLANDS- UND PARTNERSCHULEN 2 PARTNERSCHULEN DER UNIVERSITÄT HEIDELBERG Alexander von Humboldt Schule Montréal, Kanada Deutsche Schule Washington, D.C., USA Colegio Alemán de Guadalajara, Mexiko Colegio Alemán Alexander von Humboldt La Herradura, Mexiko Colegio Alemán Alexander von Humboldt Lomas Verdes, Mexiko Colegio Alemán Alexander von Humboldt Xochimilco, Mexiko Colegio Alemán, Cali, Kolumbien Deutsche Schule Medellín, Kolumbien Deutsche Schule Barranquilla, Kolumbien Colegio Humboldt Caracas, Venezuela Deutsche Schule Rio de Janeiro, Brasilien Deutsche Schule Helsinki, Finnland Deutsche Schule zu Porto, Portugal Deutsche Schule Madrid, Spanien Deutsche Schule San Alberto Magno, San Sebastián, Spanien Galabov-Gymnasium Sofia, Bulgarien Deutsche Schule Athen, Griechenland Deutsche Schule Thessaloniki, Griechenland Ellinogermaniki Agogi, Pallini, Griechenland Istanbul Lisesi, Türkei Deutsche Schule Istanbul, Türkei ALKEV Gymnasium, Istanbul, Türkei Deutsche Schule Rom, Italien Deutsche Schule Genua Deutsche Schule der Borromäerinnen Alexandria, Ägypten Deutsche Schule der Borromäerinnen Kairo, Ägypten Deutsche Schule Nairobi, Kenia Deutsche Botschaftsschule Addis Abeba, Äthiopien Deutsche Internationale Schule Kapstadt, Südafrika Deutsche Internationale Schule Beirut, Libanon (Stand: Dezember 2019) Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Absolventinnen und Absolventen, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern, Anfang des Jahres 2008 rief der Deutsche Akademische Austauschdienst -

Jahresbericht 2004
DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT IN ROM Jahresbericht 2004 Die Aufnahme neuer, zeitlich befristeter Projekte, sowie reiche Erträge historischer Grundlagenforschung haben das Forschungspro- fil des DHI Rom im Jahr 2004 gestärkt. Sechs Text- und Indicesbände wurden in der Reihe des Repertorium Germanicum vorgelegt. Die noch fehlende Teiledition von Bertalots Initia Humanistica Latina ist ebenso erschienen wie der abschließende Band des Codex Diplomati- cus Amiatinus sowie eine weitere Publikation in der Reihe der Nuntia- turberichte aus Deutschland. Im Rahmen eines Drittmittelprojektes konnten die Arbeiten an einer kritischen Edition der Summa Trium Librorum des Rolandus de Luca in Angriff genommen werden, eines Textes, der für die Entwicklung der europäischen Rechtskultur im Mittelalter von besonderem Interesse ist. Mit der Edition der Tagebü- cher 1938 bis 1940 von Luca Pietromarchi wurde ein Projekt begon- nen, das eine wichtige Quelle zum italienischen Faschismus sowie zur faschistischen Außenpolitik erschließt. Verstärkt wurden im Jahr 2004 in die wissenschaftliche Arbeit des DHI neue Medien und Techniken einbezogen. Sie dienen sowohl wissenschaftlichen Projekten als auch einer verbesserten Außendar- stellung der Institutsarbeit, der auch ein neues Institutslogo dienlich sein soll. Die Arbeit an Onlinepublikationen wurde ebenso intensiviert wie die Vorbereitung eines Relaunchs der Homepage des Instituts. Der Jahressitzung des wissenschaftlichen Beirates war in die- sem Jahr am 19. und 20. 2. eine Tagung unter dem Titel „Forschungs- -

Sabine Ehrmann-Herfort Und Michael Matheus (Hrsg.) Von Der Geheimhaltung Zur Internationalen Und Interdisziplinären Forschung
Sabine Ehrmann-Herfort und Michael Matheus (Hrsg.) Von der Geheimhaltung zur internationalen und interdisziplinären Forschung. Die Musikgeschichtliche Abteilung des Deutschen Historischen Instituts in Rom 1960– 2010 Schriftenreihe Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom Band 123 (2010) Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom DOI: 10.1515/9783110250800 Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat der Creative- Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine Bearbeitung (CC BY-NC-ND 4.0) unterliegt. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode BIBLIOTHEK DES DEUTSCHEN HISTORISCHEN INSTITUTS IN ROM BAND 123 Von der Geheimhaltung zur internationalen und interdisziplinären Forschung Die Musikgeschichtliche Abteilung des Deutschen Historischen Instituts in Rom 1960–2010 HERAUSGEGEBEN VON SABINE EHRMANN-HERFORT UND MICHAEL MATHEUS De Gruyter ISBN 978-3-11-025073-2 e-ISBN 978-3-11-025080-0 ISSN 0070-4156 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der -

LATERAN IV to IGNORANTIA SACERDOTUM by Andrew B
TEACHING THE CREED AND ARTICLES OF FAITH IN ENGLAND: LATERAN IV TO IGNORANTIA SACERDOTUM By Andrew B. Reeves A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Centre for Medieval Studies University of Toronto © Copyright by Andrew B. Reeves 2009 Abstract Title: Teaching the Creed and Articles of Faith in England: Lateran IV to Ignorantia sacerdotum Submitted by: Andrew B. Reeves Degree: Doctor of Philosophy (2009) Department: Medieval Studies, University of Toronto This study examines how English laypeople and clergy of lower ranks were taught the basic principles of Christian doctrine as articulated in the Apostles‘ Creed and Articles of Faith. Chapter one addresses the theological and historical background. Over the course of the twelfth century, school-based theologians came to place an increasing emphasis on faith as a cognitive state while at the same time moral theologians sought to make sure that all Christians had a basic participation in the life of the Church. These trends led to an effort by the Church as an institution to make sure that all Christians had at least a basic understanding of the Christian religion. Chapter two examines how the episcopate carried out a drive to ensure this basic level of understanding through the venues of councils, synods, and deanery and archdeaconry meetings. In all three of these venues, the requirements of making sure the laity know the Creed and Articles of Faith were passed on to parochial clergy, and through these clergy to the laity. Chapter three concerns one particular aspect of presenting the basics of doctrine to the laity, viz., preaching. -

DEUTSCHE AUSLANDSSCHULEN Chancen Weltweit – Lehrer Und Erzieher Gesucht
GEMEINSAM ZUKUNFT TRAGEN DEUTSCHE AUSLANDSSCHULEN Chancen weltweit – Lehrer und Erzieher gesucht. Mit Verzeichnis: WDA-Mitglieder Inhalt ZAHLEN UND FAKTEN 4 WELTWEITE WERTBEITRÄGE 5 AUSLANDSLEHRKRÄFTE IM PORTRÄT 7 WEGE INS AUSLAND 12 IHRE BEWERBUNG: DARAUF SOLLTEN SIE ACHTEN 14 WDA-MITGLIEDSCHAFT: IHRE VORTEILE 15 WDA-MITGLIEDERVERZEICHNIS 16 2 EIN EINZIGARTIGES GLOBALES NETZWERK Die Deutschen Auslandsschulen ermöglichen weltweit Bildung „Made in Germany“ − auf allen Kontinenten, in mehr als 70 Ländern. Als Orte der Begegnung bereiten die Schulen Kinder und Jugendliche verschiedener Kulturkreise auf eine gemein- same Zukunft vor. Sie bieten fundierte Wissensvermittlung, vom Kindergarten bis zum Abitur. Und sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der deutschen Sprache. Seit Generatio- nen, für Generationen. Die Abschlüsse der Deutschen Auslandsschulen gelten interna- tional als Qualitätsbegriff. Sie stehen für hochwertige Bildung, die zum Studium an deutschen und ausländischen Hochschulen befähigt – und damit weit über einen Sprachkurs hinausgeht. Sie machen die Deutschen Auslandsschulen zu Leuchttürmen der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik und zu verlässlichen Partnern für Schulbildung auf höchstem Niveau. Bund, Länder und die freien Schulträger nehmen diese Aufgaben gemeinschaftlich wahr. Diese öffentlich-private Partnerschaft sichert eine gleichbleibend hohe Qualität der Lehre. Der Welt- verband Deutscher Auslandsschulen, kurz WDA, vertritt die freien, gemeinnützigen Schulträger der Deutschen Auslands- schulen und -

DEUTSCHE AUSLANDSSCHULEN Chancen Weltweit – Lehrer Und Erzieher Gesucht
GEMEINSAM ZUKUNFT TRAGEN DEUTSCHE AUSLANDSSCHULEN Chancen weltweit – Lehrer und Erzieher gesucht. Mit Verzeichnis aller WDA-Mitglieds- schulen EIN EINZIGARTIGES GLOBALES NETZWERK INHALT Die Deutschen Auslandsschulen ermöglichen weltweit Bildung ZAHLEN UND FAKTEN 4 „Made in Germany“ − auf allen Kontinenten, in mehr als 70 Ländern. Als Orte der Begegnung bereiten die Schulen Kinder LEHRER-WELTWEIT.DE 5 und Jugendliche verschiedener Kulturkreise auf eine gemein- same Zukunft vor. Sie bieten fundierte Wissensvermittlung, vom LEHRKRÄFTE IM AUSLAND IM PORTRÄT 6 Kindergarten bis zum Abitur. Und sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der deutschen Sprache. Seit Generatio- LEHRKRÄFTE WELTWEIT: nen, für Generationen. EIN AUFTRAG, ZWEI WEGE 12 Die Abschlüsse der Deutschen Auslandsschulen gelten interna- tional als Qualitätsbegriff. Sie stehen für hochwertige Bildung, PRAKTIKA AN AUSLANDSSCHULEN 14 die zum Studium an deutschen und ausländischen Hochschulen befähigt – und damit weit über einen Sprachkurs hinausgeht. Sie CHECKLISTE: BEWERBUNG ALS ORTSLEHRKRAFT ODER machen die Deutschen Auslandsschulen zu Leuchttürmen der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik und zu verlässlichen ORTSKRAFT 16 Partnern für Schulbildung auf höchstem Niveau. WDA-MITGLIEDSCHAFT: IHRE VORTEILE 17 Bund, Länder und die freien Schulträger nehmen diese Aufgaben gemeinschaftlich wahr. Diese öffentlich-private Partnerschaft WDA-MITGLIEDERVERZEICHNIS 18 sichert eine gleichbleibend hohe Qualität der Lehre. Der Welt- verband Deutscher Auslandsschulen, kurz WDA, vertritt die freien, gemeinnützigen Schulträger der Deutschen Auslands- schulen und fasst ihre Einzelstimmen zu einer starken Stimme zusammen. Etwa 20.000 deutsche und 64.000 nichtdeutsche Schüler besu- chen derzeit die Deutschen Auslandsschulen. Mehr als 8.400 Lehrkräfte sind dort tätig. Lehrern, Erziehern und Führungskräften im Bildungswesen bieten die Deutschen Auslandsschulen viel- fältige berufliche Perspektiven. Lernen Sie dieses einzigartige globale Netzwerk kennen und werden Sie ein Teil davon. -

Orff-Schulwerk Elementare Musik- Und Tanzpädagogik Elemental Music and Dance Pedagogy
Sommer 2016 Orff-Schulwerk Elementare Musik- und Tanzpädagogik Elemental Music and Dance Pedagogy 94 Interkulturalität in der Elementaren Musik- und Tanzerziehung II Interculturality in Elemental Music and Dance Pedagogy II Publikationen II Publications - Winter 2015 CHANGES?! Orff-Schulwerk Elementare Musik- und Tanzpädagogik 9. INTERNATIONALES Elemental Music and Dance Pedagogy ORFF-SCHULWERK SYMPOSIUM Elementare Musik- und Tanzpädagogik im WANDEL der Medien Interculturality in the Elemental Music and Dance Pedagogy in the Elemental Music Interculturality / 93 Interkulturalität in der Elementaren Musik- und Tanzerziehung Interculturality in the Elemental Music and Interkulturalität in der Elementaren Musik- und Tanzpädagogik Musik- in der Elementaren Interkulturalität Dance Pedagogy Orff-Schulwerk Weitere Informationen siehe Rückseite. Informationen siehe Weitere furtherFor information see back page. ISSNISSN 2312-8895 2305-9079 Schutzgebühr 5,– Euro 93 odh93_umschlag_def.indd 1 02.12.15 16:32 Zum Titelthema werden in Theorie und Praxis Three main questions have been asked in “The- drei großen Fragen nachgegangen: Warum, ory and Practice”: Why, what and how? Reports Was und Wie? Projektberichte ergänzen das of projects expand the theme clearly. They have Thema anschaulich. Dabei geht es vor allem to do above all with advocating music, dance and darum Musik, Tanz und Sprache und die an- speech and the other arts to further a sensibility deren Künste auch einzusetzen um interkul- to intercultural competence in thinking, feeling turelle Kompetenzen zu fördern, d. h. Sensi- and activities with people from other cultures – bilisierung zu fördern um Denken, Fühlen to learn understanding and respect. und Handeln von Menschen aus anderen Kul- turen verstehen und respektieren zu lernen. This approach has been distinctive to the Orff Institute for years. -

Memory and Moralization in Medieval Bestiaries
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Kenyon College: Digital Kenyon - Research, Scholarship, and Creative Exchange Peregrinations: Journal of Medieval Art and Architecture Volume 3 Issue 2 96-121 2011 Preaching the Book of Creation: Memory and Moralization in Medieval Bestiaries Bobbi Dykema Follow this and additional works at: https://digital.kenyon.edu/perejournal Part of the Ancient, Medieval, Renaissance and Baroque Art and Architecture Commons Recommended Citation Dykema, Bobbi. "Preaching the Book of Creation: Memory and Moralization in Medieval Bestiaries." Peregrinations: Journal of Medieval Art and Architecture 3, 2 (2011): 96-121. https://digital.kenyon.edu/ perejournal/vol3/iss2/5 This Feature Article is brought to you for free and open access by Digital Kenyon: Research, Scholarship, and Creative Exchange. It has been accepted for inclusion in Peregrinations: Journal of Medieval Art and Architecture by an authorized editor of Digital Kenyon: Research, Scholarship, and Creative Exchange. For more information, please contact [email protected]. Dykema Preaching the Book of Creation: Memory and Moralization in Medieval Bestiaries By Bobbi Dykema, Independent Scholar In 1125, Bernard of Clairvaux was asked by the abbot William of St. Thierry to speak in defense of Cistercian simplicity over and against what both saw as the excesses of Cluniac monasticism. In his Apologia XII, Bernard rails against the ornamentation of the Cluniac cloister: But in the cloisters, before the eyes of the brothers while they read—what is that ridiculous monstrosity doing, an amazing kind of deformed beauty and yet a beautiful deformity? What are the filthy apes doing there? The fierce lions? The monstrous centaurs? The creatures, part man and part beast? The striped tigers, fighting soldiers, and hunters blowing their horns? You may see many bodies under one head, and conversely many heads on one body. -

THE PATER NOSTER and the LAITY in ENGLAND C.700
THE PATER NOSTER AND THE LAITY IN ENGLAND c.700 - 1560 WITH SPECIAL FOCUS ON THE CLERGY’S USE OF THE PRAYER TO STRUCTURE BASIC CATECHETICAL TEACHING ANNA EDITH GOTTSCHALL A THESIS SUBMITTED TO THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY DEPARTMENT OF ENGLISH SCHOOL OF ENGLISH, DRAMA AND AMERICAN AND CANADIAN STUDIES UNIVERSITY OF BIRMINGHAM NOVEMBER 2014 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third parties in respect of this work are as defined by The Copyright Designs and Patents Act 1988 or as modified by any successor legislation. Any use made of information contained in this thesis/dissertation must be in accordance with that legislation and must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder. At present no scholar has provided an in-depth study into the dissemination of the Pater Noster outside the clerical sphere. This thesis provides a detailed consideration of the ways in which the Pater Noster was taught to the laity in medieval England. It explores the central position of the prayer in the lay curriculum, the constitutions which played a fundamental role in its teaching, and the methods by which it was disseminated. Clerical expositions of the prayer and its tabular and diagrammatic representations are examined to consider the material available to assist the clergy in their pedagogical role. The ways in which material associated with the Pater Noster was modified and delivered to a lay audience provides an important component in the holistic approach of this thesis. -

Quaritch/Oakland
QUARITCH/OAKLAND Books to be exhibited at the 48th California International Book Fair 6-8 February 2015 Oakland Marriot City Centre Booth #810 THE ASSOCIATION WHICH SPONSORED PARK, BURCKHARDT, HORNEMANN, LEDYARD AND LUCAS 1. [AFRICAN ASSOCIATION.] Proceedings of the Association for promoting the discovery of the interior parts of Africa. London, C. Macrae, 1790. [With:] African researches; or proceedings of the Association for promoting the discovery of the interior parts of Africa. Vol. II. London, W. Bulmer & Co., 1802. Two vols., large 4to., pp. [iii]–xi, 236, with a large folding map of northern Africa by James Rennell; viii, 20, viii, 162, 208, ‘208*’, [1, blank], 209–215, with four folding maps (one hand-coloured in outline); excellent, fresh copies uniformly bound in contemporary marbled calf, spines gilt; slightly rubbed, covers scratched, vol. II joints cracking; bookplates of Walter Harold Wilkin. $11,750 First editions of two volumes of proceedings of the African Association. The first volume, here in the rare quarto format, is usually encountered in an 8vo edition published in 1791. The second volume is a presentation copy, inscribed ‘The Gift to Capt. John Talbot R.N. from his Brother in Law Sr. Wm. Young Secretary of the African Society. Oct. 14. 1802.’ on the half-title. Inscribed in a neat contemporary hand on the verso of the half-title is a memorandum beginning: ‘At a meeting of the African Association held in London May 29th 1802. Resolved unanimously – That a copy of Frederic Hornemans Journal of the Travels from Cairo to Mourzouk be respectfully presented to the General Bonaparte, First Consul of the French Republic .