Herbert Wehner Ein Leben in Den Krisen Des 20
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
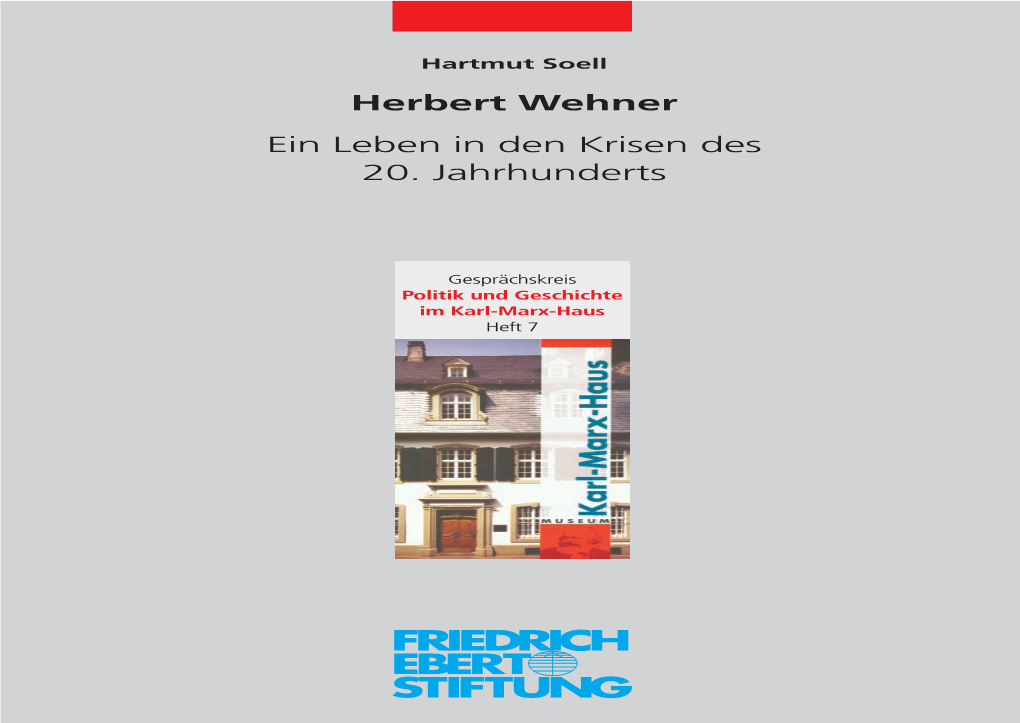
Load more
Recommended publications
-

A History of German-Scandinavian Relations
A History of German – Scandinavian Relations A History of German-Scandinavian Relations By Raimund Wolfert A History of German – Scandinavian Relations Raimund Wolfert 2 A History of German – Scandinavian Relations Table of contents 1. The Rise and Fall of the Hanseatic League.............................................................5 2. The Thirty Years’ War............................................................................................11 3. Prussia en route to becoming a Great Power........................................................15 4. After the Napoleonic Wars.....................................................................................18 5. The German Empire..............................................................................................23 6. The Interwar Period...............................................................................................29 7. The Aftermath of War............................................................................................33 First version 12/2006 2 A History of German – Scandinavian Relations This essay contemplates the history of German-Scandinavian relations from the Hanseatic period through to the present day, focussing upon the Berlin- Brandenburg region and the northeastern part of Germany that lies to the south of the Baltic Sea. A geographic area whose topography has been shaped by the great Scandinavian glacier of the Vistula ice age from 20000 BC to 13 000 BC will thus be reflected upon. According to the linguistic usage of the term -

Local Expellee Monuments and the Contestation of German Postwar Memory
To Our Dead: Local Expellee Monuments and the Contestation of German Postwar Memory by Jeffrey P. Luppes A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Germanic Languages and Literatures) in The University of Michigan 2010 Doctoral Committee: Professor Andrei S. Markovits, Chair Professor Geoff Eley Associate Professor Julia C. Hell Associate Professor Johannes von Moltke © Jeffrey P. Luppes 2010 To My Parents ii ACKNOWLEDGMENTS Writing a dissertation is a long, arduous, and often lonely exercise. Fortunately, I have had unbelievable support from many people. First and foremost, I would like to thank my advisor and dissertation committee chair, Andrei S. Markovits. Andy has played the largest role in my development as a scholar. In fact, his seminal works on German politics, German history, collective memory, anti-Americanism, and sports influenced me intellectually even before I arrived in Ann Arbor. The opportunity to learn from and work with him was the main reason I wanted to attend the University of Michigan. The decision to come here has paid off immeasurably. Andy has always pushed me to do my best and has been a huge inspiration—both professionally and personally—from the start. His motivational skills and dedication to his students are unmatched. Twice, he gave me the opportunity to assist in the teaching of his very popular undergraduate course on sports and society. He was also always quick to provide recommendation letters and signatures for my many fellowship applications. Most importantly, Andy helped me rethink, re-work, and revise this dissertation at a crucial point. -

1 Introduction
Notes 1 Introduction 1. What belongs together will now grow together (JK). 2. The well-known statement from Brandt is often wrongly attributed to the speech he gave one day after the fall of the Berlin Wall at the West Berlin City Hall, Rathaus Schöneberg. This error is understandable since it was added later to the publicized version of the speech with the consent of Brandt himself (Rother, 2001, p. 43). By that time it was already a well known phrase since it featured prominently on a SPD poster with a picture of Brandt in front of the partying masses at the Berlin Wall. The original statement was made by Brandt during a radio interview on 10 November for SFP-Mittagecho where he stated: ‘Jetzt sind wir in einer Situation, in der wieder zusammenwächst, was zusammengehört’ (‘Now we are in a situation in which again will grow together what belongs together’). 3. The Treaty of Prague with Czechoslovakia, signed 11 December 1973, finalized the Eastern Treaties. 4. By doing this, I aim to contribute to both theory formation concerning inter- national politics and foreign policy and add to the historiography of the German question and reunification policy. Not only is it important to com- pare theoretical assumptions against empirical data, by making the theoretical assumptions that guide the historical research explicit, other scholars are enabled to better judge the quality of the research. In the words of King et al. (1994, p. 8): ‘If the method and logic of a researcher’s observations and infer- ences are left implicit, the scholarly community has no way of judging the validity of what was done.’ This does not mean that the historical research itself only serves theory formation. -

Bd. 5: Deutsch- 29 Hs
willy brandt Berliner Ausgabe willy brandt Berliner Ausgabe Herausgegeben von helga grebing, gregor schöllgen und heinrich august winkler Im Auftrag der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung band 1: Hitler ist nicht Deutschland. Jugend in Lübeck – Exil in Norwegen 1928 – 1940 band 2: Zwei Vaterländer. Deutsch-Norweger im schwedischen Exil – Rückkehr nach Deutschland 1940 – 1947 band 3: Berlin bleibt frei. Politik in und für Berlin 1947 – 1966 band 4: Auf dem Weg nach vorn. Willy Brandt und die SPD 1947 – 1972 band 5: Die Partei der Freiheit. Willy Brandt und die SPD 1972 – 1992 band 6: Ein Volk der guten Nachbarn. Außen- und Deutschlandpolitik 1966 – 1974 band 7: Mehr Demokratie wagen. Innen- und Gesellschaftspolitik 1966 – 1974 band 8: Über Europa hinaus. Dritte Welt und Sozialistische Internationale band 9: Die Entspannung unzerstörbar machen. Internationale Beziehungen und deutsche Frage 1974 – 1982 band 10: Gemeinsame Sicherheit. Internationale Beziehungen und deutsche Frage 1982 – 1992 willy brandt Berliner Ausgabe band 5 Die Partei der Freiheit Willy Brandt und die SPD 1972 – 1992 Bearbeitet von karsten rudolph Verlag J.H.W. Dietz Nachf. GmbH Die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung bedankt sich für die groß- zügige finanzielle Unterstützung der gesamten Berliner Ausgabe bei: Frau Ursula Katz, Northbrook, Illinois Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, Essen Otto Wolff von Amerongen-Stiftung, Köln Stiftungsfonds Deutsche Bank im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e. V., Essen Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH, Hamburg Bankgesellschaft Berlin AG Herlitz AG, Berlin Metro AG, Köln Schering AG, Berlin Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; dataillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. -

A State of Peace in Europe
Studies inContemporary European History Studies in Studies in Contemporary Contemporary A State of Peace in Europe A State of Peace in Europe European European West Germany and the CSCE, 1966–1975 History History West Germany and the CSCE, 1966–1975 Petri Hakkarainen In a balanced way the author blends German views with those from Britain, France and the United States, using these countries’ official documents as well. His book represents a very serious piece of scholarship and is interesting to read. It excels with a novel hypothesis, a very careful use of varied archival sources, and an ability not to lose his argument in the wealth of material. Helga Haftendorn, Free University, Berlin Petri Hakkarainen I don’t know of any other book that deals so thoroughly with German CSCE policy in the years described here…The author has done a vast amount of research, using documents from different archives and different countries…While he is of course not the first scholar to write about the origins of the CSCE, the author does contribute new elements and interpretations to the topic. Benedikt Schönborn, University of Tampere, Centre for Advanced Study From the mid-1960s to the mid-1970s West German foreign policy underwent substantial transformations: from bilateral to multilateral, from reactive to proactive. The Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE) was an ideal setting for this evolution, enabling A StateofPeaceinEurope the Federal Republic to take the lead early on in Western preparations for the conference and to play a decisive role in the actual East–West negotiations leading to the Helsinki Final Act of 1975. -
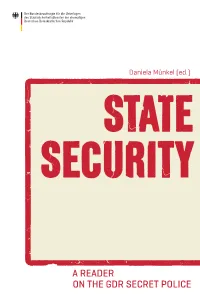
Bstu / State Security. a Reader on the GDR
Daniela Münkel (ed.) STATE SECURITY A READER ON THE GDR SECRET POLICE Daniela Münkel (ed.) STATE SECURITY A READER ON THE GDR SECRET POLICE Imprint Federal Commissioner for the Records of the State Security Service of the former German Democratic Republic Department of Education and Research 10106 Berlin [email protected] Photo editing: Heike Brusendorf, Roger Engelmann, Bernd Florath, Daniela Münkel, Christin Schwarz Layout: Pralle Sonne Originally published under title: Daniela Münkel (Hg.): Staatssicherheit. Ein Lesebuch zur DDR-Geheimpolizei. Berlin 2015 Translation: Miriamne Fields, Berlin A READER The opinions expressed in this publication reflect solely the views of the authors. Print and media use are permitted ON THE GDR SECRET POLICE only when the author and source are named and copyright law is respected. token fee: 5 euro 2nd edition, Berlin 2018 ISBN 978-3-946572-43-5 6 STATE SECURITY. A READER ON THE GDR SECRET POLICE CONTENTS 7 Contents 8 Roland Jahn 104 Arno Polzin Preface Postal Inspection, Telephone Surveillance and Signal Intelligence 10 Helge Heidemeyer The Ministry for State Security and its Relationship 113 Roger Engelmann to the SED The State Security and Criminal Justice 20 Daniela Münkel 122 Tobias Wunschik The Ministers for State Security Prisons in the GDR 29 Jens Gieseke 130 Daniela Münkel What did it Mean to be a Chekist? The State Security and the Border 40 Bernd Florath 139 Georg Herbstritt, Elke Stadelmann-Wenz The Unofficial Collaborators Work in the West 52 Christian Halbrock 152 Roger Engelmann -

Gã¼nter Reimann Papers
http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/kt8n39r9wx No online items Register of the Günter Reimann papers Finding aid prepared by Hoover Institution Library and Archives Staff Hoover Institution Library and Archives © 2008 434 Galvez Mall Stanford University Stanford, CA 94305-6003 [email protected] URL: http://www.hoover.org/library-and-archives Register of the Günter Reimann 2008C55 1 papers Title: Günter Reimann papers Date (inclusive): 1927-2005 Collection Number: 2008C55 Contributing Institution: Hoover Institution Library and Archives Language of Material: German Physical Description: 69 manuscript boxes(27.6 Linear Feet) Abstract: Includes correspondence, writings, notes, and printed matter, relating to international economic conditions, and to national socialism and communism in Germany. Creator: Reimann, Günter, 1904-2005 Hoover Institution Library & Archives Access The collection is open for research; materials must be requested at least two business days in advance of intended use. Publication Rights For copyright status, please contact the Hoover Institution Library & Archives. Acquisition Information Materials were acquired by the Hoover Institution Library & Archives in 2008. Preferred Citation [Identification of item], Günter Reimann papers, [Box no., Folder no. or title], Hoover Institution Library & Archives 1904 November Born, Hans Steinicke, Angermünde, Germany 13 1919 Member, Free Socialist Youth 1920-1924 Member, Communist Youth League 1923-1926 Student, Berlin School of Economics (Degree in Micro -

Herbert Wehner Und Der Rücktritt Willy Brandts Am 7. Mai 19741
AUGUST H. LEUGERS-SCHERZBERG HERBERT WEHNER UND DER RÜCKTRITT WILLY BRANDTS AM 7. MAI 19741 Am 24. April 1974 wurde der persönliche Referent von Bundeskanzler Willy Brandt, Günter Guillaume, unter Spionageverdacht verhaftet. Bei seiner Festnahme gab er sich als Offizier der Nationalen Volksarmee und damit als Mitarbeiter des Ministeri ums für Staatssicherheit (MfS) zu erkennen. Damit konnte es keinen Zweifel mehr darüber geben, dass Guillaume für die DDR spioniert hatte. Am 7. Mai trat Willy Brandt vom Amt des Bundeskanzlers zurück. Wie es in den Tagen zwischen dem 24. April und dem 7. Mai zum Rücktritt Brandts kam, gehört zu den umstrittensten Fragen der deutschen Nachkriegsgeschichte2. Nicht zuletzt Brandt selbst gab dem Verdacht Nahrung, dass im Umfeld seines Rücktritts nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Hatte er unmittelbar nach seinem Rücktritt kategorisch bestritten, dass Wehner ihn aus dem Amt gedrängt habe, so revidierte er diese Behauptung in seinen 1989 erschienenen „Erinnerungen". In diesem Zusam menhang hielt er insbesondere fest: „Auch Briefe und Nachrichten, die in den Tagen um meinen Rücktritt aus Ostberlin eingingen, wurden mir vorenthalten."3 Seine „Notizen zum Fall G."- in den Monaten nach seinem Rücktritt 1974 niedergeschrie ben, aber erst anderthalb Jahre nach seinem Tode im Frühjahr 1994 veröffentlicht - verstärkten den Verdacht gegen Wehner. Darin erklärte Brandt, dass die Rolle Weh ners bei seinem Rücktritt „[v]on zentraler Bedeutung" gewesen sei, und merkte dazu an: „Gibt es Zus[ammen]hang mit Hon[ecker]-Kontakten? Jedenfalls gibt es Briefe, die mir vorenthalten wurden. Von H[elmut] S[chmidt] bestätigt. Hat ,die andere Seite' mit vergiftenden Berichten gespielt?"4 Mitte der neunziger Jahre sind erbitterte öffentliche Auseinandersetzungen da rüber geführt worden, ob und inwieweit Wehner Brandts Sturz systematisch - ja 1 Schriftliche Fassung meiner Antrittsvorlesung an der Universität Essen vom 23. -

A Structured Analysis of Ostpolitik: a Paradigm of a Systems Approach James E
Eastern Illinois University The Keep Masters Theses Student Theses & Publications 1974 A Structured Analysis of Ostpolitik: A Paradigm of a Systems Approach James E. Getz Eastern Illinois University This research is a product of the graduate program in Political Science at Eastern Illinois University. Find out more about the program. Recommended Citation Getz, James E., "A Structured Analysis of Ostpolitik: A Paradigm of a Systems Approach" (1974). Masters Theses. 3698. https://thekeep.eiu.edu/theses/3698 This is brought to you for free and open access by the Student Theses & Publications at The Keep. It has been accepted for inclusion in Masters Theses by an authorized administrator of The Keep. For more information, please contact [email protected]. PAPER CERTIFICATE #2 TO: Graduate Degree Candidates who have written formal theses. SUBJECT: Permission to reproduce theses. The University Library is receiving a number of requests from other institutions asking permission to reproduce dissertations for inclusion in their library holdings. Although no copyright laws are involved, we feel that professional courtesy demands that permission be obtained from the author before we allow theses to be copied. Please sign one of the following statements: Booth Library of Eastern Illinois University has my permission to lend my thesis to a reputable college or university for the purpose of copying it for inclusion in that institution's library or research holdings. I respectfully request Booth Library of Eastern Illinois University not allow my thesis be reproduced because Date Author pdm A S�RUCTURED ANALYSISOFOSTPOLITIK; A PARADIGM OF ASYSTEMSAPPROACH (TITLE) BY JAMES E. PGETZ· B.S. -

Der Weg Zur Koalition Aus SPD Und FDP Nach Der Bundestagswahl Vom
Dokumentation DANIEL HOFMANN „VERDÄCHTIGE EILE" Der Weg zur Koalition aus SPD und F.D.P. nach der Bundestagswahl vom 28. September 1969 I. Die Ablösung der Regierenden von der Macht ist ein Kernproblem der Regierungs lehre wie der praktischen Politik. Dabei haben Demokratien bekanntlich gegenüber Diktaturen den Vorzug, daß sich die Regierten ihrer Regierungen „ohne Blutvergie ßen, zum Beispiel auf dem Wege über allgemeine Wahlen, entledigen können". Dem britischen Staatstheoretiker Karl Popper zufolge ist nicht die Herrschaft des Volkes, sondern der durch institutionelle Garantien gewährleistete unblutige Regierungs wechsel schlechthin „das Prinzip der Demokratie"1. Was dem geschichtlichen Wan del unterliegt, sind lediglich die Mechanismen, durch die sich eine solche Wachablö sung vollziehen kann. Traf die politischen Führer in der Antike noch der Ostrakis- mos - das Scherbengericht -, so müssen sie sich heute in parlamentarisch verfaßten Staaten dem Urteil der Wähler stellen. Als parlamentarisches System hatte die Bundesrepublik Deutschland Anfang 1969 ihre endgültige Bewährungsprobe noch vor sich2. Denn nach bald 20 Jahren ließ ein durch Bundestagswahlen herbeigeführter Regierungswechsel weiterhin auf sich war ten. Seit der Staatsgründung befand sich die CDU/CSU als stärkste Kraft in der Re gierungsverantwortung. Mit den Bundeskanzlern Konrad Adenauer, Ludwig Erhard und Kurt Georg Kiesinger waren ausnahmslos Christdemokraten in das politisch ge wichtigste Amt der Bundesrepublik gewählt worden. Allerdings schickte sich die SPD, seit Dezember 1966 in der Koalition mit der CDU/CSU mit neun von 19 Mi nistern vertreten, unter ihrem Vorsitzenden Willy Brandt an, der Union die Führung streitig zu machen. 1 Karl R. Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, Bd. I: Der Zauber Platons, Bern 1957, S. -
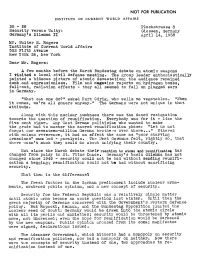
Security Versus Unity: Germany's Dilemma II
NOT FOR PUBLICATION INSTITUTE OF CURRENT VORLD AFFAIRS DB- 8 Plockstrasse 8 Security versus Unity: Gie ssen, Germany Germany' s Dilemma II April l, 19G8 Mr. Walter S. Rogers Institute of Current World Affairs 522 Fifth Avenue ew York 36, Eew York Dear Mr. Rogers: A few months before the -arch Bundestag debate on atomic weapons I Islted a local civil defense meeting. The group leader enthusiastically painted a hideous picture of atomic devastation; the audience remained dumb arid expressionless. Film and magazine reports on hydrogen bombs, fall-out, radiation effects they all seeme to fall on plugged ears in Germany. "at can one do?"'asked Kurt Odrig, who sells me vegetables. "Yhen it comes, we're all goers anyway." The Germans were not uique in that attitude. Along with this nuclear numbness there was the dazed resignation towards the question of reunification. Everybody was for it like the fiv cent clgar. Any West German politlclan who wanted to make the rade had to master the sacred roeunification phase: "Let us not forget our seventeen-million German brothe.,,_s over there..." Uttered ith solen reverence, it had an effect tho same as ,'poor starving rmenlans" ,once had paralysis. The Test Germans felt, rightly so, that there ,sn't much they could do about uifying their country. But since the arch debate their ,reaction to atoms and reunificatoa has changed from palsy to St. Vitus Dance. Germany's basic dilemma has not changed since 1949 security could not be had without sending reunifi- cation a begging; reunification could not be had without sacrificing security. -

Der Politiker Als Zeitzeuge. Heinrich Krone Als Beobachter Der Ära
Der Politiker als Zeitzeuge Heinrich Krone als Beobachter der Ära Adenauer Von Ulrich von Hehl In eigener Sache mit der gebotenen Distanz zu urteilen und dabei durchaus »Partei« zu sein, ist nicht jedermanns Sache. Oft behindern Scheuklap- pen den freien Blick oder Abneigungen bestimmen die Argumentation, so daß selbst bei gutem Willen die Perspektivität der eigenen Sichtweise unübersehbar ist. Dies gilt selbstredend auch für Politiker. Gerade bei ihnen kann nicht überraschen, daß (alte) Gegnerschaften, der eigene Par- teistandpunkt oder die Hitze längst geschlagener Schlachten auch noch im Rückblick das Urteil bestimmen. Wir kennen zahlreiche Beispiele aus der Memoirenliteratur: Bismarcks - auch literarisch glänzende - »Gedanken und Erinnerungen« etwa, deren dritter Band bekanntlich erst 1919, nach der Abdankung Wilhelms II., erschien,1 oder Fürst Bülows »Denkwürdigkeiten« (1930/31)2 oder Franz von Papens allzu durchsichtiger Entlastungsversuch »Der Wahrheit eine Gasse«3 von 1952. Sie alle verbinden die Rechtfertigung des eigenen Handelns mit Attacken auf mißliebige Zeitgenossen und zeigen den tiefsitzenden Groll ihrer Verfasser. Auch Heinrich Brünings lange mit Spannung erwartete »Memoiren«, in seinem Todesjahr 1970 erschienen, lassen die Animositäten des Exkanzlers deutlich erkennen und sind auch aus diesem Grund gewichtigen quellenkritischen Einwänden begegnet.4 Als Konrad Adenauer sich im hohen Alter der »Memoiren-Fron« unterwarf, ließ er sich von dem Bestreben leiten, eine möglichst authentische, aber eben seine Sicht der Dinge zu bieten. So entschied er sich für die Beschreibung seines politischen Weges in der »Form eines kommentierenden Aktenrefe- 1 Otto Fürst von BISMARCK, Gedanken und Erinnerungen, 2 Bde., hrsg. von Horst KOHL, Stuttgart 1898; Bd. 3: Erinnerung und Gedanke, Stuttgart-Berlin 1919 -jetzt am bequemsten zu benutzen in der kritischen Ausgabe der Werke in Auswahl, Bd.