UNIVERSITÄTSKLINIKUM HAMBURG-EPPENDORF Die Darstellung Der
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
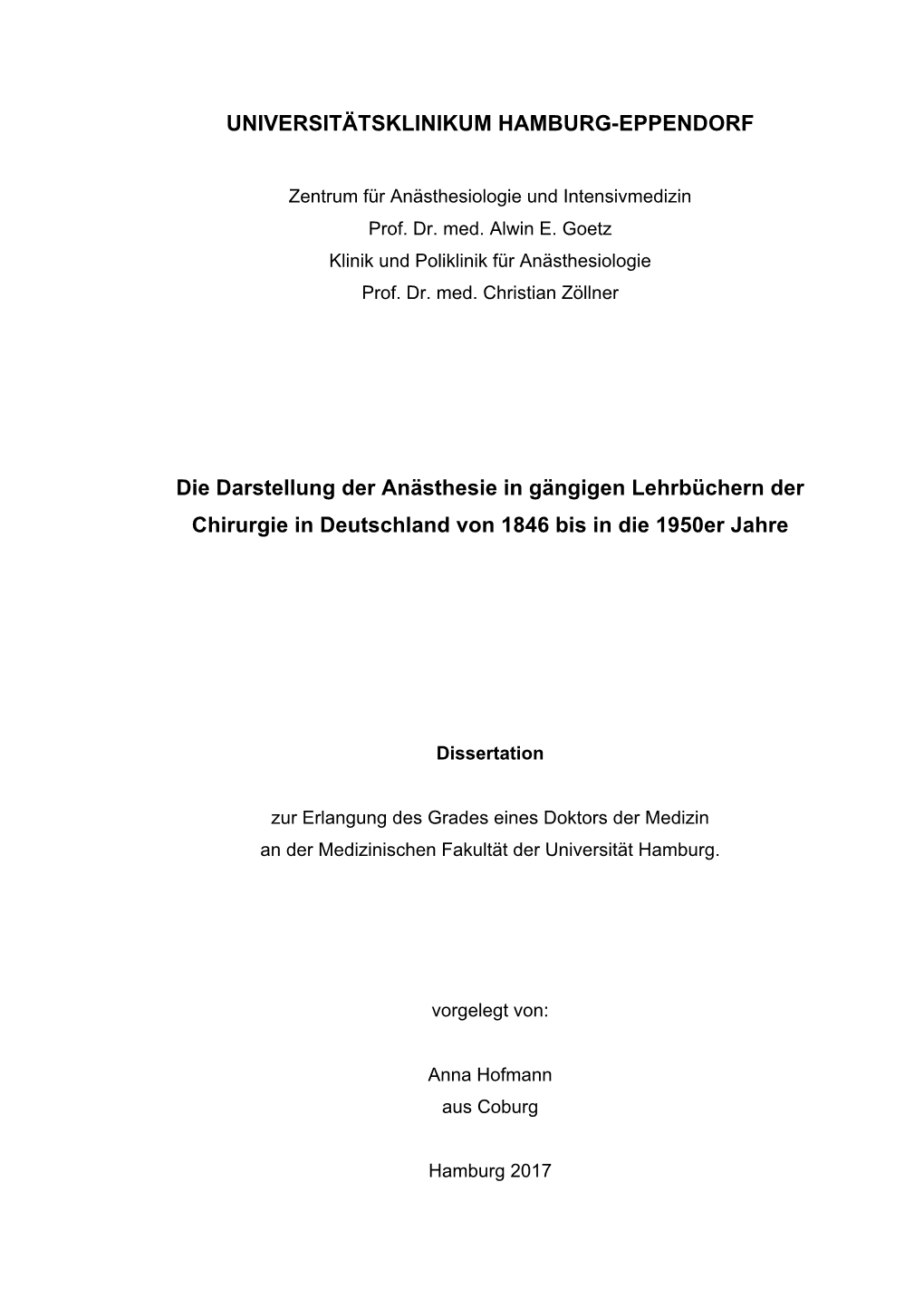
Load more
Recommended publications
-

10. Constructing a Cupid's Bow
10 CONSTRUCTING CUPIDS BOW ARTISTS ASSIST 17 THE THE YEARS MEDICAL ARTISTS WHEN PORTRAYING FINAL CLEFT RESULT CONSTRUCTED SURGEONS LIP INVARIABLY SYMMET RICAL CUPIDS BOW WITH THEIR PEN OR BRUSH THIS POSSIBLY INCREASED THE BUT THE THEIR POPULARITY WITH SURGEONS ANY SIMILARITY TO TRUE UNREAL HERE FEW POSTOPERATIVE RESULT WAS QUITE ARE REPRO OF OF THE FINAL RESULT OF METHODS THAT DUCTIONS ARTISTS CONCEPTS SHOWN WITH THE UNEQUIVOCALLY DESTROYED THE BOW YET CUPIDS BOW STILL STANDING IN ALL ITS GLORY FLJIA1 FINALLY THE SURGEON DOES IT IT WHEN THUS WAS AN IMPORTANT BREAKTHROUGH IN CLEFT LIP SURGERY THE NUMBER THE SURGEON ACTUALLY CREATED CUPIDS BOW ONE 121 GAIN THERE CHAMPION OF THIS DEVELOPMENT WAS THE CANADIAN LEMESUR THE TORONTO ICR PRIMARILY AN ORTHOPEDIC SURGEON WORKING AT HOSPITAL FOR SICK CHILDREN AS LEMESURIER HIMSELF ACKNOWLEDGED HIS OPERATION EXCEPT IN DETAIL WAS NOT ORIGINAL IN FACT IN 1884 40 AFTER MIRAULT MODIFIED THE GERMAN YEARS MALGAIGNE HAGEDORN DESIGNED QUADRILATERAL FLAP CLEFT LIP PROCEDURE WHICH WAS SO FAR AHEAD OF HIS TIME THAT IT TOOK 50 YEARS AND LEMESURIER TO IT ACCEPTANCE BEFORE AND AFTER WERE QUADRILATERAL FLAP DESIGNS HAGE DORN ACTUALLY GUSTAV SIMON HEIDELBERG SURGEON IN 1864 WAS THE FIRST TO INTRODUCE QUADRILATERAL FLAP OPERATION HIS MAIN BUT FLAP CAME FROM THE MEDIAL SIDE AND HAD SOME ADVANTAGES DID NOT CREATE CUPIDS BOW AND NEVER REACHED ANY DEGREE OF IN POPULARITY EXCEPT AS AN OCCASIONAL REPRODUCTION SURGICAL TEXT BOOKS KONIG ANOTHER EARLY QUADRILATERAL FLAP MAKER WAS FRANZ KBNIG HE TRAINED WITH LANGENBECK AND THEN -

The Agnew Clinic, an 1889 Oil Painting by American Artist Thomas Eakins
Antisepsis and women in surgery 12 The Gross ClinicThe, byPharos Thomas/Winter Eakins, 2019 1875. Photo by Geoffrey Clements/Corbis/VCG via Getty Images The Agnew Clinic, an 1889 oil painting by American artist Thomas Eakins. Universal History Archive/UIG via Getty images Don K. Nakayama, MD, MBA Dr. Nakayama (AΩA, University of California, San Francisco, Los Angeles, 1986, Alumnus), emeritus professor of history 1977) is Professor, Department of Surgery, University of of medicine at Johns Hopkins, referring to Joseph Lister North Carolina School of Medicine, Chapel Hill, NC. (1827–1912), pioneer in the use of antiseptics in surgery. The interpretation fits so well that each surgeon risks he Gross Clinic (1875) and The Agnew Clinic (1889) being consigned to a period of surgery to which neither by Thomas Eakins (1844–1916) face each other in belongs; Samuel D. Gross (1805–1884), to the dark age of the Philadelphia Museum of Art, in a hall large surgery, patients screaming during operations performed TenoughT to accommodate the immense canvases. The sub- without anesthesia, and suffering slow, agonizing deaths dued lighting in the room emphasizes Eakins’s dramatic use from hospital gangrene, and D. Hayes Agnew (1818–1892), of light. The dark background and black frock coats worn by to the modern era of aseptic surgery. In truth, Gross the doctors in The Gross Clinic emphasize the illuminated was an innovator on the vanguard of surgical practice. head and blood-covered fingers of the surgeon, and a bleed- Agnew, as lead consultant in the care of President James ing gash in pale flesh, barely recognizable as a human thigh. -

Cardiac Surgery
Gerhard Ziemer Axel Haverich Editors Cardiac Surgery Operations on the Heart and Great Vessels in Adults and Children 123 Cardiac Surgery Gerhard Ziemer Axel Haverich Editors Cardiac Surgery Operations on the Heart and Great Vessels in Adults and Children Editors Gerhard Ziemer Axel Haverich Department of Surgery HTTG - Surgery The University of Chicago Medizinische Hochschule Hannover Chicago, IL Hannover USA Germany ISBN 978-3-662-52670-5 ISBN 978-3-662-52672-9 (eBook) DOI 10.1007/978-3-662-52672-9 Library of Congress Control Number: 2017939170 © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2017 This work is subject to copyright. All rights are reserved by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. The use of general descriptive names, registered names, trademarks, service marks, etc. in this publication does not imply, even in the absence of a specific statement, that such names are exempt from the relevant protective laws and regulations and therefore free for general use. The publisher, the authors and the editors are safe to assume that the advice and information in this book are believed to be true and accurate at the date of publication. Neither the publisher nor the authors or the editors give a warranty, express or implied, with respect to the material contained herein or for any errors or omissions that may have been made. -

A Brief History of Urinary Incontinence and Its Treatment
A Brief History of Urinary Incontinence and its Treatment Chairman DIRK SCHULTHEISS (Germany) 19 CONTENTS I. INTRODUCTION VI. SURGICAL TREATMENT: VESICOVAGINAL FISTULA II. EARLY REPORTS ON URINARY INCONTINENCE FROM ANTIQUITY VII. SURGICAL TREATMENT: TO THE 18th CENTURY STRESS URINARY INCONTINENCE III. CONSERVATIVE TREATMENT VIII. INJECTION THERAPY IV. EXTERNAL DEVICES REFERENCES V. “ELECTROTHERAPY“ CORRESPONDENCE 20 A Brief History of Urinary Incontinence and its Treatment DIRK SCHULTHEISS (GERMANY) account of it and urine drops from his member without I. INTRODUCTION his knowing it ...“ [3, 5]. The „Papyrus Ebers“ consists of a collection of about 900 recipes for the treatment of a wide variety of partly poorly defined diseases. Ancient reports on urinary incontinence are rather Among them one can find remedies “to remove the rare and mainly address cases of extraurethral urine which runs to often“ and “to remove constant incontinence (e.g. due to a fistula acquired during running of the urine“ [4, 6, 7]. Furthermore these childbirth) or overflow incontinence (e.g. in males with Egyptian sources already mention devices for the urinary retention or after spinal cord injury). In later collection of urine in males and also pessaries for centuries several authors dealt with the problem of women. postoperative incontinence after perineal lithotomy. Defined surgical techniques for the cure of urinary An examination of the mummy Henhenit (about 2050 incontinence were not introduced before the 19th B.C.) by D. E. Derry in 1935 revealed a large century. First this was limited to fistula repair but at the vesicovaginal fistula which is most likely due to a birth end of the 19th century new procedures for stress trauma as it was accompanied by a laceration of the incontinence were introduced and became standard perineum [8, 9]. -

Department of General Surgery Medical Academy Named After S.I
Department of General Surgery Medical Academy named after S.I. Georgievskiy, The Federal State Autonomous Educational Establishment of Higher Education “Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky” Ministry of Education and Science of the Russian Federation For the 3rd year students The text of the lectures and the minimum amount of knowledge necessary for a understanding of the subject material. Topic: Aseptics & Antiseptics in surgery Authors: prof.Mikhailychenko V.Yu, Starykh A.A. 2015 Aseptics & Antiseptics in surgery History of aseptic and antiseptic Empirical asepsis In ancient times, demons and evil spirits were though to be the causes of pestilence and infections. Hippocrates (460-377 BC), the great healer of his time irrigated wounds with wine or boiled water foreshadowing asepsis. Galen (130-200 A.D.), a Greek that practiced medicine in Rome and was the most distinguished physician after Hippocrates boiled his surgical instruments used in the caring of wounded gladiators. The writing of Hippocrates and Galen were the established authority for many centuries. In the early to mid 1800's, people like Ignaz Semmelweis, Louis Pasteur, and Robert Koch introduced us to the world of microorganisms. Since this time, we have witnessed the invention of the first steam sterilizer (1886), the practice of passive and active immunization, and the use of antibiotics. Today, we practice asepsis and sterile technique based on scientific principles. Infection control, asepsis, body substance, and sterile technique should always be a part of patient care at any level. Joseph Lister (5 April 1827 — 10 February 1912) was a Scottish surgeon who picked up the work of Louis Pasteur and used it to change the success rates of surgery. -

History of The
HISTORY OF THE AMERICAN GYNECOLOGICAL SOCIETY 1876-1981 AND AMERICAN ASSOCIATION OF OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTS 1888-1981 EDWARD STEWART TAYLOR Denver, Colorado The C. V. Mosby Company ST. LOUIS, MISSOURI 1985 Copyright © 1985 by The C. V. Mosby Company All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or trans- mitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission from the publisher. Printed in the United States of America The C. V. Mosby Company 11830 Westline Industrial Drive, St. Louis, Missouri 63146 Library of Congress Cataloging in Publication Data Taylor, E. Stewart (Edward Stewart), 1911- History of the American Gynecological Society, 1876- 1981, and the American Associate of Obstetricians and Gynecologists, 1888-1981. Includes index. 1. American Gynecological Society—History. 2. American Association of Obstetricians and Gynecologists—History. I. American Gynecological Society. II. American Association of Obstetricians and Gynecologists. III. Title. [DNLM: Gynecology—history—United States. 2. Obstetrics— history—United States. 3. Societies, Medical—history— United States, WP 1 A512T] RG1.A567T39 1985 618'.06’073 85-4768 ISBN 0-8016-5101-8 GW/OB/RR 9 8 7 6 5 4 3 2 1 01/C/088 Contents Preface. ......................................................................................................................................................... 5 Introduction. ................................................................................................................................................ -

Sterilisation
ZENTRAL D 2596 F 2010 Avril Année/Año 18 RSevue inTternatiEonale RILISATRevisIta inOternacionaNl c oncernant la stérilisation Suppl.1 sobre la esterilización Technique : état des lieux – Concepts pour l’avenir FORUM International Dispositifs Estado de la técnica: Médicaux et Procédures Conceptos para el futuro Vérification des paramè- tres des performances FORUM Internacional de Productos Verificación de los pará- metros de rendimiento Médicos y Procedimientos Qu’est-ce que nous pou- vons à vrai dire certifier ? ¿Qué es lo que se puede realmente certificar? Qu’est-ce qui est néces- saire, qu’est-ce qui est possible ? ¿Qué se necesita? ¿Qué es Le meilleur sur une posible? période de 10 ans Gestion des instruments Gestión del instrumental Lo mejor de los Réglementation des últimos 10 años unités des stérilisation : Prétentions et contra- dictions Sistema de regulación CEYE: Aspiraciones y contradicciones Prévention Prevención Contrôle des processus Controles en proceso Utilisateurs et experts Usuarios y expertos Retraitement – Prière de rester simple ! ¡Reprocesamiento, pero por favor sencillo! 0_Titel_ZT_Suppl1_10.indd 1 21.04.10 19:17 U2_Forumseite 21.04.2010 13:12 Uhr Seite 1 Prof. Dr. Peter Heeg Rédacteur en chef EDITORIAL Redactor jefe FORUM International Dispositifs Médicaux et Procédés : Le meilleur sur une période de 10 ans ! FORO Internacional Productos Médicos y Procedemientos : ¡Lo mejor de los últimos 10 años! es 10 dernières années ont apporté non seulement une nouvelle n estos diez últimos años hemos asistido no sólo a una nueva di- Lfaçon de voir le retraitement des dispositifs médicaux orienté Emensión del reprocesamiento de los productos sanitarios orientada vers les processus de retraitement, mais ont également permis, grâce al proceso, sino también a numerosos pasos para mejorar nuestros à de nombreux petits pas, l’acquisition de nouvelles connaissances, conocimientos, las estructuras y la seguridad de los pacientes. -

FORUM Panamericano Dispositos Medicos Procesos Relacionados
Fifth edition ● Quinta edición FORUM PanAmericano 5 Dispositivos Médicos y Procesos Relacionados – desde 2016 International FORUM Medical Devices & Processes since 1999 ¿Estéril, pero no limpio? Sterile, but not clean? www.mhp-medien.de Investigation & Application Investigación & Aplicación VISUALLY INSPECT WITH REMARKABLE CLARITY The FIS includes a distal �p composed of a light source and camera lens at the end of a 110cm flexible sha�, which features gradua�on marks. The Flexible Inspec�on Scope is a perfect tool to get a visualiza�on of any poten�ally soiled device. So�ware is included and allows viewing and recording. FIS-005SK 110CM LONG 2.0MM DIAMETER FIS-006SK 110CM LONG 1.3MM DIAMETER HEALTHMARK OFFERS MANY OPTICAL INSPECTION TOOLS TO SUIT YOUR NEEDS MAGIC TOUCH HANDHELD MADE IN AMERICA 4X LED MAGNIFIER MULTI-MAGNIFIER MAGNIFIER MAGNIFIER HEALTHMARK INDUSTRIES CO. | HMARK.COM | 800.521.6224 | [email protected] FORUM PanAmericano 1/2020 1 Editorial Sterile but not clean: Florence Nightingale searched for evidence Estéril, pero no limpio: Florence Nightingale buscada la «evidencia» a esterilización se remonta a la obra de Louis Pasteur y también a la terilization is attributed to the discoveries of Louis Pasteur but credit Lde Florence Nightingale, una mujer británica nacida en la Toscana y Sfor this is also often given to the British nurse, Florence Nightingale, formada en un hospital alemán cerca de Düsseldorf (Kaiserswerth who was born in Tuscany, trained among other places at a German 1850/51) que trabajó para el imperio colonial británico en el siglo XIX. A hospital in Düsseldorf (Kaiserswerth 1850/51), and worked in the service través de sus viajes y de su experiencia posterior en la Guerra de Crimea of the British Empire during the 19th century. -

Ede La Revista Trauma
pónimos E de la revista Trauma Esta obra es una recopilación de los epónimos publicados en la revista TRAUMA FUNDACIÓN MAPFRE hasta diciembre de 2014, elaborados por el Dr. Francisco Forriol Campos, director de la revista. Los textos contenidos en este libro pueden reproducirse libremente citando la procedencia. © De los textos, su autor. © De la presente edición: FUNDACIÓN MAPFRE Paseo de Recoletos, 23 28004 Madrid. España www.fundacionmapfre.org Edición digital: Moonbook Depósito Legal: M-9509-2015 ÍNDICE PRÓLOGO ......................................... 7 Arthur Legg (1874-1939) ........................ 33 PRESENTACIÓN ................................... 9 Georg Perthes (1869-1927) ..................... 33 Frans Ali Bruno Krogius (1864-1939) ........ 13 José Cañadell (1923-2014). 35 Oscar Huntington Allis (1826-1921) ......... 13 Marie Joseph Auguste (Alexis) Carrel (1873-1944) ..................................... 36 Alan Graham Apley (1914-1996) .............. 14 George Quentin Chance ...................... 41 Aquiles ............................................ 14 Karl Chiari (1912-1982) ......................... 42 Jacques Arlet (1940-. 15 François Chopart (1743-1795) ................. 42 Atlas ............................................... 16 George Cierny, III MD (1947-2013) .......... 43 Joseph Jules F. Félix Babinski (1857-1932) .. 17 (1903-1967) ................ José Luis Bado (1903-1977 ..................... 19 John Robert Cobb 44 (1861-1912) ............. William Morrant Baker (1839-1896) ......... 19 Alessandro Codivilla -

People Teaching Research People Teaching Research
PEOPLE TEACHING RESEARCH PEOPLE TEACHING RESEARCH Charité — excellence in health care CHARITÉ OFFERS OUTSTANDING HEALTH CARE. CHARITÉ’S STAFF MEMBERS DELIVER CLINICAL CARE, RESEARCH, AND TEACHING TO THE HIGH EST INTERNATIONAL STANDARD. ALL OF THEIR EFFORTS COMBINE EXCEPTIONAL EXPERTISE WITH SOCIAL RESPONSIBILITY. 1 Foreword 6 2 From ‘pest house’ to Europe‘s largest university hospital 8 More than 300 years of making people our purpose — insights into the history of Charité 9 Charité today — a leading health care organization with a social conscience 16 3 Medicine in all its facets — Charité‘s pillars of excellence 24 Highest standards of medical care 25 Nursing competence 28 Excellence in research 30 Cutting-edge concepts in teaching and learning 33 4 Health care priorities and research foci with international recognition 36 Neuroscience 37 Oncology 40 Regenerative therapies 42 Cardiology 45 Immunology 48 Genetics 50 5 Charité‘s strategic networks 52 Cooperative projects with industrial partners — from research innovation to practical application 53 Truly international 55 Charité Foundation — promoting innovation 57 World Health Summit — bringing experts together 59 Berlin Institute of Health — a model facility for translational research 62 6 Charité in numbers 64 Organogram 66 Content 5 1 Foreword Charité — Universitätsmedizin Berlin, which recently marked its 300-year anniversary, Welcome to Charité. For over 300 years, within the social care arena. Aside from is now the largest university hospital in Europe. Throughout its history, Charité has been we have been attracting people and interest, being responsible for the well-being of its dedicated to research, teaching, and medical care. We hope that our brochure ’People — not simply from within the Berlin area and patients, Charité is also actively involved in the rest of Germany, but also from all over supporting victims of violence. -

Asepsis and Bacteriology: a Realignment of Surgery and Laboratory Science
Med. Hist. (2012), vol. 56(3), pp. 308–334. c The Author 2012. Published by Cambridge University Press 2012 doi:10.1017/mdh.2012.22 Asepsis and Bacteriology: A Realignment of Surgery and Laboratory Science THOMAS SCHLICH∗ Department of Social Studies of Medicine, McGill University, 3647 Peel Street, Montreal, Quebec, H3A 1X1, Canada Abstract: This paper examines the origins of aseptic surgery in the German-speaking countries. It interprets asepsis as the outcome of a mutual realignment of surgery and laboratory science. In that process, phenomena of surgical reality were being modelled and simplified in the bacteriological laboratory so that they could be subjected to control by the researcher’s hands and eyes. Once control was achieved, it was being extended to surgical practice by recreating the relevant features of the controlled laboratory environment in the surgical work place. This strategy can be seen in the adoption of Robert Koch’s bacteriology by German-speaking surgeons, and the resulting technical changes of surgery, leading to a set of beliefs and practices, which eventually came to be called ‘asepsis’. Keywords: Asepsis, Antisepsis, Surgery, Bacteriology If he were a surgeon, the laboratory scientists Louis Pasteur wrote in 1878, he would not only clean his instruments thoroughly, ‘but after having cleaned my hands with the greatest of care, I would subject them to rapid flaming’. Pasteur did this in his laboratory with all objects that came into contact with his microbial cultures, in order to avoid contamination. Furthermore, he ‘would use only lint, bandages and sponges previously exposed to air temperatures of 130–150 ◦C and use water that had been heated to temperatures of 1 110–120 ◦C’. -

Tochter Oder Schwester – Die Universität Greifswald Aus Rostocker Sicht
Tochter oder Schwester – die Universität Greifswald aus Rostocker Sicht Referate der interdisziplinären Ringvorlesung des Arbeitskreises „Rostocker Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte“ im Wintersemester 2006/07 Herausgegeben von Hans-Uwe Lammel und Gisela Boeck Rostocker Studien zur Universitätsgeschichte Band 8 Universität Rostock 2010 Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. Herausgeber: Der Rektor der Universität Rostock Redaktion: Hans-Uwe Lammel und Gisela Boeck Druckvorlage: Martin Buchsteiner Einband: Medienzentrum der Universität Rostock Druck und Herstellung: Universitätsdruckerei Rostock 15-10 Copyright 2007 by Universität Rostock ISBN 978-3-86009-077-0 Bezugsmöglichkeiten: Universität Rostock Universitätsarchiv Schwaansche Straße 4 18051 Rostock Telefon: +49-381 498 8621 Fax: +49-381 498 8622 Inhalt Vorbemerkung 5 Matthias Asche 7 Konkurrenz belebt das Geschäft, zuviel Konkurrenz schadet – Die Universitäten Rostock und Greifswald als ungleiche Schwestern Gisela Boeck 23 Chemie in Greifswald und Rostock im 19. Jahrhundert – Ein historischer Vergleich Werner Buchholz 43 Das Lexikon Greifswalder Hochschullehrer und seine Wissenschaftlichen Auswertungsmöglichkeiten Niklot Klüßendorf 69 Der Historiker Heinz Maybaum (1896-1955) Ein Leben mit Prägespuren von fünf politischen Systemen Christine Magin 85 Akademische Epigraphik? Zu den historischen