20.09.2004 Landesinterner Bericht Bille
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
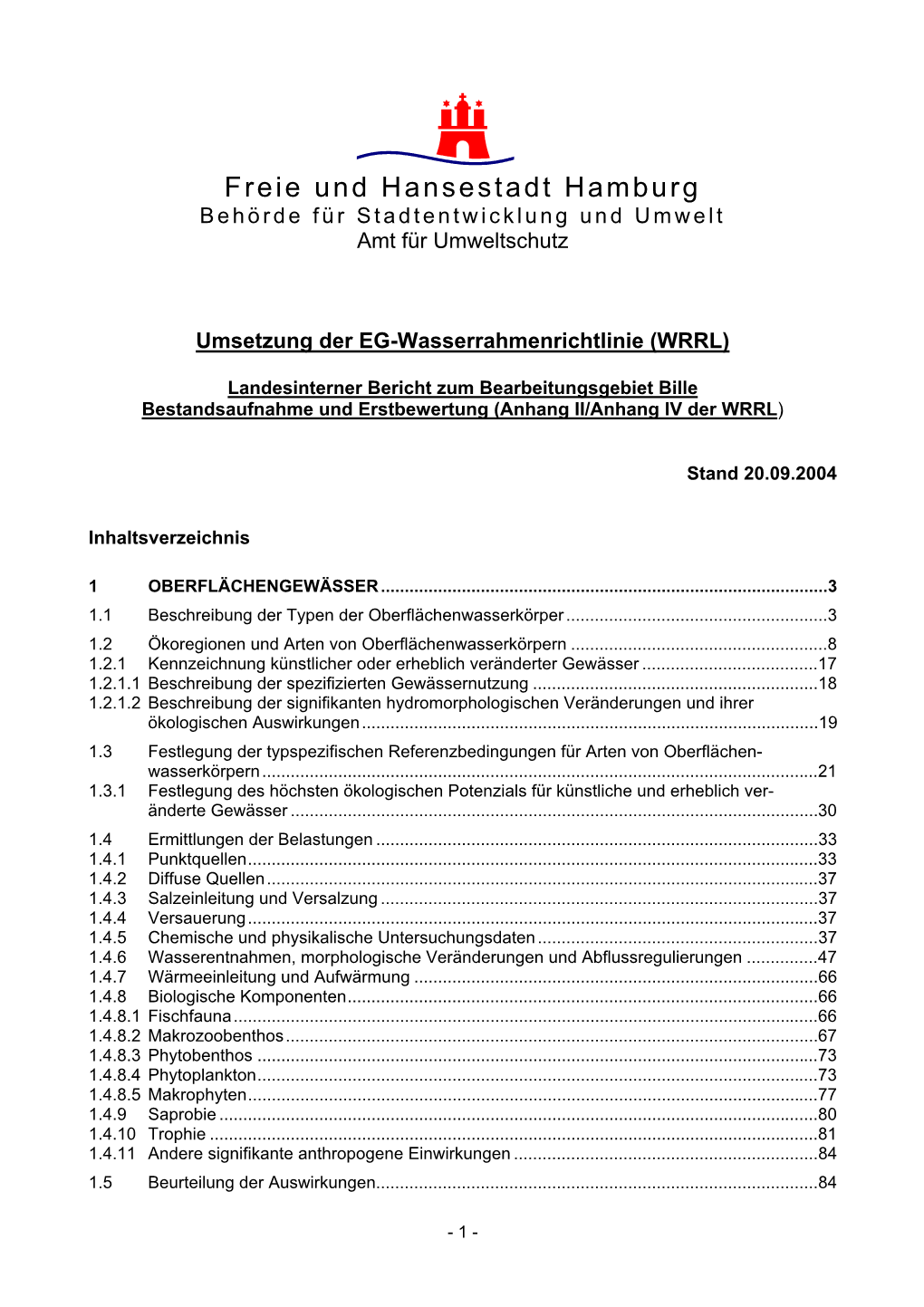
Load more
Recommended publications
-

05-Durch-Die-Bahnhofstrasse.Pdf
Baumspaziergänge Baumspaziergang am 11. Oktober 1992 Wir möchten Ihnen in unseren "Baumspaziergängen" Reinbek aus heimatkundlicher Perspektive zeigen. Wir machen einen Baum oder eine Baumgruppe zum Zentralpunkt eines Spazierganges und suchen Ant- worten auf die Frage: "Was hat dieser Baum schon alles erlebt?" Durch die Bahnhofstraße Bei unserem 5. Baumspaziergang möchten wir uns mit der Bahnhofstraße befassen, dem Gebiet, in dem sich außerhalb des Schloss Bezirkes die ersten Reinbeker ansiedelten. In den Mittelpunkt haben wir heute diese bildschöne Trauerbuche gestellt, die gegenüber der Apotheke steht. Der Spaziergang wird hinunter bis zur Post und dann auf der gegenüberliegenden Straßenseite zurück bis zum Landhausplatz gehen. Ein Bericht über die ersten Reinbeker Wegeverbindungen soll der Auf- takt dafür sein, dass wir Ihnen erzählen, was wir über Häuser und Grundstücke der Bahnhofstraße er- fahren haben und über die Menschen, die hier lebten und arbeiteten. Der Abschluss soll am Landhaus- platz sein. Erhaltungssatzung für die Bahnhofstraße Unsere Bahnhofstraße hat schon ihren besonderen Reiz. Die Stadtverordnetenversammlung hat deshalb versucht, durch eine Satzung das Milieu zu schützen. Der offizielle Name ist: „Satzung über die Erhal- tung baulicher Anlagen für den Bereich südliche Stadtmitte vom 04.06.1988“ Danach kann die Bauauf- sichtsbehörde Abrisse, Neubauten, Änderungen und neuerdings auch Nutzungsänderungen untersa- gen, wenn dadurch der Charakter des Gebietes gestört wird. Wörtlich heißt es im § 3: Im Geltungsbereich dieser Satzung befinden sich bauliche Anlagen als Zeugnisse der geschichtlichen Bau- und Nutzungsentwicklung, insbesondere der Baukultur, wie Kätnerhäuser in Fachwerk, Jugend- stilvillen der Gründerzeit, markanter Baustil der Epoche zwischen den zwei Weltkriegen sowie neuere Gebäude, die sich in das Ensemble trotz gewisser Selbstdarstellung harmonisch einfügen. -

8. Waste Water Treatment
8. Waste water treatment 1. Please describe the present situation and development over the last five to ten years in relation to the proportion of total waste water treated in accordance with the Urban Waste Water Directive (max. 1,000 words): Waste water treatment in Hamburg fulfils the requirements stipulated in the 1991 EU Commission directive on urban waste water treatment to 100%. With a current influent load of 2.7 million population equivalents (p.e.), the combined Köhlbrandhöft/Dradenau treatment plants treat around 150 million m 3 of waste water per year. The average effluent concentrations of 49 mg/l and 4 mg/l in terms of the parameters COD and BOD 5 are significantly lower than the respective reference values of 125 and 25 mg/l. The threshold for total phosphorus of 1 mg/l is being undercut by 30% on average. Annual reduction of the total nitrogen load has been significantly higher than 70% (for example, a constant 78% in the period 2005-2007). The minimum requirements have, therefore, clearly been exceeded. On top of this, a further catchment area with approximately 80,000 p.e., Buxtehude/Apensen, was connected to the combined waste water treatment plants in 2003. The corresponding increase in the pollution load of around 3% was balanced out by a patented SAT (store and treat) biological centrate treatment plant which reduced nitrification in the main flow, and that had meanwhile been built and put into operation by the “Hamburger Stadtentwässerung” (Hamburg Public Sewage Company) HSE. Prior to 2000, waste water treated in the Hamburg treatment plants only met around 90% of the EU directive requirements. -

ERLÄUTERUNGSBERICHT Planstand
Gemeinde Witzhave Flächennutzungsplan Kreis Stormarn Neuaufstellung 2003 Gesamtes Gemeindegebiet ERLÄUTERUNGSBERICHT Planstand: . Ausfertigung Übersichtsplan M. 1 : 75.000 GEMEINDE WITZHAVE, FLÄCHENNUTZUNGSPLAN, NEUAUFSTELLUNG ERLÄUTERUNGSBERICHT PLANLABOR STOLZENBERG SEITE 1 Inhalt: 1. Vorbemerkungen 3 a. Aufgaben und Ziele des Flächennutzungsplanes 3 b. Planungserfordernis 3 c. Rechtliche Grundlagen und übergeordnete Planungsziele 4 d. Plangrundlagen 6 2. Planvorstellungen und Auswirkungen der Planung 6 a. Siedlungsentwicklung 7 b. Übernahme von Inhalten des Landschaftsplans 7 3. Planungsvorgaben 7 a. Allgemeines zur Gemeinde Witzhave 7 b. Geschichtliche Entwicklung 9 c. Statistische Auswertungen - Bestandsaufnahme 10 4. Planinhalt 22 a. Siedlungsentwicklung 22 b. Sonstige Flächenänderungen 28 c. Verkehr 29 d. Sonstige Infrastruktureinrichtungen 29 e. Naturschutz und Landschaftspflege 30 f. Denkmalschutz und Denkmalpflege 32 g. Emissionen/Immissionen 32 h. Reit- und Wanderwege 33 5. Ver- und Entsorgung 34 6. Billigung des Erläuterungsberichtes 35 ERLÄUTERUNGSBERICHT GEMEINDE WITZHAVE, FLÄCHENNUTZUNGSPLAN, NEUAUFSTELLUNG SEITE 2 PLANLABOR STOLZENBERG 1. Vorbemerkungen a. Aufgaben und Ziele des Flächennutzungsplanes Im Flächennutzungsplan stellt die Gemeinde für ihr Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen dar (§ 5 Abs. 1 Baugesetzbuch). Der Flächennutzungsplan enthält die Vorstellungen der Gemeinde über -

NACHHALTIGKEIT Foto: Contrastwerkstatt Stock.Adobe.Com Foto: – EDITORIAL & INHALT
Ausgabe 3 / September 2019 beiWOHNEN MIT HAMBURGER uns GENOSSENSCHAFTEN 58. ordentliche Vertreterversammlung 03 Innovative Mess-Stationen 17 JETZT IST DIE ZEIT FÜR NACHHALTIGKEIT Foto: contrastwerkstatt stock.adobe.com Foto: – EDITORIAL & INHALT LIEBE LESERINNEN UND LESER, Unsere 58. ordentliche Vertreterver- Lesen Sie auf der Seite 21 Interessantes vielleicht auch einmal wieder für einen sammlung hat im Juni mit einer sehr ho- über die Aktivitäten unserer Stiftung im Museumsbesuch (Seite 15). hen Beteiligung stattgefunden. Den aus- Demenz-Netzwerk in Bergedorf oder führlichen Bericht lesen Sie auf Seite 3. über unsere Kooperation mit Berge- Wir wünschen Ihnen bei allen Unter- dorfer für Völker verständigung e.V. in nehmungen viel Spaß und einen son- Auf den Seiten 6 – 7 berichten wir über Sachen Mieterführerschein (Seite 16). nigen und schönen Altweibersommer! ein kleines Jubiläum in Sachen Neubau und Modernisierung unserer Wohnanla- Unseren Veranstaltungskalender für ge am Katendeich. ergedorf und mgebung finden Sie in dieser Ausgabe auf den Seiten 8 und 9. Der Mieterin unserer 500. Fahrradbox – HABEN SIE FRAGEN ODER ANRE- die nach wie vor großen Zuspruch erfah- Wenn die Tage wieder kürzer und ein GUNGEN? Dann schreiben Sie eine ren – hat die Kollegin aus der Ver mietung wenig dunkler werden, ist die Zeit der E-Mail: [email protected] eine Gratulation überbracht (Seite 5). großen Laternenumzüge (Seite 14) und 58. ordentliche Rainer Schilling Mieterführerschein – 03 Vertreterversammlung 10 von der biwag 16 ualifizierung on lüchtlingen UNSERE GENOSSENSCHAFT 21 Aktionswoche Demenz: UNSERE FREIZEIT Wir sind dabei! 03 58. ordentliche 22 Aus unseren Treffpunkten 32 Hallo Kids Vertreter versammlung 05 Vertreterrundfahrt 2019 UNSER HAMBURG UNSER SERVICE 500. -

Hamburg – European Green Capital: 5 Years On
Hamburg – European Green Capital: 5 Years On The City takes it further CONTENT I. Overview .................................................................................................................................... 5 II. Green City of Well-Being ........................................................................................................... 6 III. The Path to becoming a Green Capital ................................................................................... 7 IV. Hamburg’s Year as European Green Capital: Programme and Objectives ........................... 8 V. Assessment and Long-Term Developments ......................................................................... 14 All eyes on Hamburg ............................................................................................................... 14 Hamburg as a business location ............................................................................................... 15 Hamburg as a travel destination ................................................................................................ 15 Hamburg and the European Commission ................................................................................. 16 Hamburg and other European Cities ..........................................................................................16 Infl uence on the culture of participation and debate........................................................... 16 VI. Hamburg’s Population is Growing: Opportunities and Challenges for the Environment and -

In Aumühler Villengegend
Wir müssen ins Handeln kommen Klimaschutz-Initiative Sachsenwald: Wir lernen gerade, was eine Krise bedeutet »Die Bundesrepublik Deutschland wird das Klimaschutzziel, die Treibhausgasemissionen AHRGANG 56.J R um 40 Prozent zu senken, erreichen«, sagt Rolf Eichhorst. Der 52-jährige ist Mitbegründer der Kli- maschutzinitiative Sachsensenwald. Grund für die FOTO: IMKE KUHLMANN FOTO: Zielerreichung sei die Corona-Krise: in der Folge, deutlich eingeschränkter Flugverkehr, reduzierter Autoverkehr, Reduktion der Emissionen durch die Industrie. EKE Erneuerbare Energien, Mobili-tät oder Natur Tel: (040) 727 30 -117 · Fax: -118 Fax: · -117 30 727 (040) Tel: · im Klimawandel gehören zu den Themen der Initi- ative, die 2014 durch einen Volkshochschulkursus ins Rollen kam. Rolf Eichhorst gehört zu den B Personen der ersten Stunde. Er war Teilnehmer des Kurses »Energiebürger Schleswig-Holstein«. einbeker.de einbeker.de Die Energiewende in der eigenen Region mitge- R stalten und Hintergrundwissen für den Einstieg in das bürgerschaftliche Engagement vor Ort wurde den Einsteigern vermittelt. Eichhorst reizten hier vornehmlich die digitalen Lerneinheiten. EIN LesenSieweiteraufSeite17 R R HEUTE: eMail: redaktion@der eMail: DE 56. Jahr · Nr. 7 · 20. April 2020 Nächste Ausgabe: 4.5.2020 56. Jahr · Nr. Kreativ durch die Krise S. 8 Jürgen –Rieger Steuerberatung und Rolf Eichhorst Reinbek seit hilft. 90 Neue Jahren Website –S. 18 setzten auf das Fahrrad als alterna- Ihr Haus- u. Gartenservice tives Bewegungsmittel Kirchliches Leben mit Corona S. 24 schnell – preiswert – zuverlässig TAXIT. Zapf : Buchhaltung · Steuern Rasenpflege/ Festpreise nach Hamburg Buchhaltung · Steuern Flughafen–Hauptbahnhof–alle Stadtteile Rasen vertikutieren EBuchhaltunginkommenst euer· Steuern 2017 Bäume, Büsche, Hecken schneiden, Baumfällen (mit Seilklettertechnik), Platten- Jahresabschluss · Lohn 722 4411 und Pflasterarbeiten, Zäune aufstellen, JahresabschlussFrist bis zum 31. -

Zur Morphogenese Des Billetales Zwischen Witzhave Und Bergedorf (Bei Hamburg)
159—175 Eiszeitalter u. Gegenwart 31 Hannover 1981 12 Abb. Zur Morphogenese des Billetales zwischen Witzhave und Bergedorf (bei Hamburg) ANTJE RECLAM *) Landform evolution, glacial morphology, moraine, glacial valley, overridden, Middle Pleistocene (Saalian), borehole section, langitudinal profile, terrace, sand, gravel, granulometry. Northwestern German Plain (Bille valley, Witzhave/Bergedorf), Schleswig-Holstein. TK 2427,2527 Kurzfassung : Mit Hilfe sedimentpetrographischer und gefügekundlicher Methoden wurden neue Untersuchungen zur Genese des Billetales (östlich von Hamburg) durchgeführt. An den untersuchten Stellen zieht sich die Niendorfer Moräne (Mittlere Saale-Vereisung) in das Tal hinab. Eine Urform des Billetales ist damit möglicherweise bereits während der Saale-Eiszeit ge bildet worden. Durch den Fuhlsbüttler Vorstoß (Spätsaale) wurde das Gebiet erneut vom Eis überfahren. Erst in der Weichsel-Eiszeit kam es zur Ausbildung der heutigen Talform. Im meist etwa 700 m breiten Billetal lassen sich zwei Terrassenniveaus deutlich unterscheiden. Die ca. 1 m mächtigen Terrassensedimente bestehen aus groben Sanden und Kiesen. In diese Sedimente hat sich gegen Ende der Weichsel-Eiszeit die Bille eingeschnitten. Die etwa 200 m breite Talaue wird heute nur noch bei Schneeschmelze in ganzer Breite vom Wasser durchflössen. Hinweise darauf, daß das Weichsel-Eis im Billetal bis an die Elbe vorgestoßen sei, fanden sich nicht. [On the Morphogenesis of the Bille Valley between Witzhave and Bergedorf (near Hamburg)] Abstract: New investigations into the genesis of the Bille valley (east of Hamburg) were conducted by means of sediment-petrographical and structural analyses. In the investigated pro files the Niendorf till (Middle Saalian) was found to reach downslope into the valley. Thus an early form of the Bille valley may have existed as early as the Saalian and was overridden again by the late Saalian Fuhlsbüttel advance. -

Stadteingang Elbbrücken Öffentliche Vorstellung Und Diskussion Der Entwürfe Aus Dem Testplanungsverfahren
Stadteingang Elbbrücken Öffentliche Vorstellung und Diskussion der Entwürfe aus dem Testplanungsverfahren Online-Beteiligung bis 16.12.2019 www.billebogen.de 2 NEUE PERSPEKTIVEN: EIN NEUER EINGANG FÜR HAMBURGS INNERE STADT Neue Perspektiven Ein neuer Eingang für Hamburgs innere Stadt Die meisten Hamburgerinnen und Hamburger* Das „Testplanungsverfahren Stadteingang Elbbrü- Zum Auftakt des Tesplanungsverfahrens wurden nehmen ihn vor allem als Transitraum wahr: Der cken“ betrachtet im Detail die verschiedensten im Januar 2019 sechs Planungsteams aufgefordert, Stadtraum von der nördlichen Veddel bis zur Orten und ihre Potenziale zwischen Elbe und Bille. ihre städtebaulichen und landschaftsplanerischen Amsinckstraße ist von großen Verkehrsschneisen Es untersucht den Stadtraum nicht zuletzt auch im Konzepte für den Stadteingang zu erarbeiten. geprägt. Dabei hat er viele bisher versteckte Qua- Licht des nachhaltigen Wandels durch die Ent- Obwohl diese Konzepte im Vordergrund standen, litäten – die attraktive Lage am Wasser, die Nähe wicklung der benachbarten HafenCity, des Bille- sollten die Planer ebenso über Nutzungen nach- zum Zentrum, Freizeit- und Kulturangebote sowie bogens und des Grasbrooks auf der Südseite der denken: Raum für Gewerbe mit zukunftsfähigen vieles mehr. Die Menschen auf der Veddel und in Elbe. Mit dem Elbtower als künftiger Landmarke an Arbeitsplätzen, Nahversorgung und in geeigneten Rothenburgsort schätzen dies, viele leben gerne hier. Lagen auch für Wohnen. Der öffentliche Zugang zu Wasserlagen und Freiräumen soll verbessert -

Projekt PARKS – Bürgerschaftliches Engagement Für
ALSTER-BILLE-ELBE PARKS 2020 › ALTER RECYCLINGHOF STADTNaTUR TaGUNG BULLERDEICH 6, 20537 HAMBURG NABU HAMBURG, 06.11.2020 PROJEKT PARKS BÜRGERSCHAFTLICHES 00’47.8”E 10° ENGAGEMENT FÜR NATUR ”N .3 0 ’4 3 3 ° 3 5 IN GEWERBEGEBIETEN JOHANNA PADGE, SILKE KOAL UND E ” 9 . 1 5 ’ 1 JULIA MARIE ENGLERT 0 ° 0 1 N ” 3 . 4 0 ’ 2 3 ° 3 5 ALSTER-BILLE-ELBE PARKS 2020 › ALTER RECYCLINGHOF STADTNaTUR TaGUNG BULLERDEICH 6, 20537 HAMBURG NABU HAMBURG, 06.11.2020 PARKS - BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT FÜR NATUR IN GEWERBEGEBIETEN 1. WaS IST PARKS? 2. WER IST PARKS? 3. WIE ARBEITET PARKS? 4. WaS WÄCHST HIER? 5. WIE WIRD DER BESTAND WEITERGEDACHT? 6. WIE WIRD GEPFLEGT? 7. WIE GEHT ES WEITER? ALSTER-BILLE-ELBE PARKS 2020 › ALTER RECYCLINGHOF STADTNaTUR TaGUNG BULLERDEICH 6, 20537 HAMBURG NABU HAMBURG, 06.11.2020 1. WaS IST PARKS? Das Projekt Alster-Bille-Elbe PARKS gibt es seit 2019. Es ist im Auftrag der Umweltbehörde Hamburg entstanden. Mit dem Alster-Bille-Elbe Grünzug plant die Stadt Hamburg eine 4km lange grüne Passage im östlichen Hamburg, die als Teil des grünen Netzes vier Landschaftsachsen miteinander verbindet. Anstelle von klassischen Planer*innen oder Architekt*innen wird das PARKS-Projekt von einer interdisziplinären Gruppe konzipiert und geleitet. Inhalt des Projekts ist es, mit den umliegenden Nachbarschaften, eine Vision für PARKS der Zukunft zu entwickeln und auf der Fläche des ehemaligen Recyclinghofs umzusetzen und auszuprobieren. ALSTER-BILLE-ELBE PARKS 2020 › ALTER RECYCLINGHOF STADTNaTUR TaGUNG BULLERDEICH 6, 20537 HAMBURG NABU HAMBURG, 06.11.2020 1. WaS IST PARKS? Der Alster-Bille-Elbe Grünzug befindet sich abschnittsweise noch in der Planung. -

Billetal Liebe Besucher! Beim Landesamt Für Natur Und Umwelt Des Landes Schleswig-Holstein, Hamburger Chaussee 25, 24220 Flintbek, Angefordert Werden
Liebe Besucherinnen, Dieses Faltblatt wird im Rahmen des Besucherinformationssystems für die Naturschutzgebiete in Schleswig-Holstein herausgegeben und kann Billetal liebe Besucher! beim Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein, Hamburger Chaussee 25, 24220 Flintbek, angefordert werden. Tel. 04347 - 704-230, E-Mail: [email protected] Die Bille entspringt nordöstlich der Hahnheide und mündet bei Ham burg in die Elbe. Sie ge- Finanzierung hört zu den Flüssen in Schleswig-Holstein, die Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche abschnittsweisenochnaturnahe,fließgewässer Räume des Landes Schleswig-Holstein ty pi sche Strukturen mit einer charakteristischen Durchführung Landesamt für Natur und Umwelt des Landes TierundPflanzenweltaufweisen.DasBille- Schleswig-Holstein tal wurde 1987 zwischen Grander Mühle und Gebietsbetreuung: ArGe Naturschutzgebiet „Billetal“ Reinbeker Mühlen teich als Naturschutzge biet Geschäftsstelle: Stadt Reinbek ausgewiesen. Das 176 ha große NSG schließt Amt für Umwelt und Verkehr Hamburger Str. 5-7 den Mündungsbereich der Cor bek mit ein und 21465 Reinbek grenzt unmittelbar an den Sachsenwald, das größ te zusam men hängende Waldgebiet in Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. Schleswig-Holstein. Gemeinschaft für Fischereibiologie und Naturschutz e.V. Naturschutzbund Deutschland e.V. Naturschutzverein Bille e.V. Teilbereiche dieses Gebietes sind Bestandteil des Europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“ Fotos Kairies (Titelbild: Bachlauf, 1,10,12 ), Hess (2,3,5,8), Mordhorst (4,11), Ullrich (6,7), Hecker (9) 1 Die Bille ist ein sommerkühler „Kaltwasserbach“ mit einer ganz- jährigen Wassertemperatur unterhalb von 20°C. Das Wasser Redaktion, Grafik Planungsbüro Mordhorst-Bretschneider GmbH, wird flussabwärts kälter anstatt wärmer. Ein Grund für die und Herstellung Kolberger Straße 25, 24589 Nortorf „Temperaturanomalie“ ist der Zufluß von ganzjährig annähernd Tel: 04392 / 69271, www.buero-mordhorst.de konstant 8°C warmen Wassers aus Quellbächen und Quellen. -

Elbbrücken : Dialog Zum Rahmenplan – Entwurf Inhalt
Stadtwerkstatt18 ELBBRÜCKEN : DIALOG ZUM RAHMENPLAN – ENTWURF INHALT Grußwort von Senatorin Dr. Dorothee Stapelfeldt, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen . 3 Hintergrund und Ablauf . 5 Aktueller Stand Rahmenplan Stadteingang Elbbrücken, Franz-Josef Höing, Oberbaudirektor der Freien und Hansestadt Hamburg . 6 Zusammenwachsen einer heterogenen Nachbarschaft, Prof. Jürgen Bruns-Berentelg Vorsitzender der Billebogen Entwicklungsgesellschaft . 8 Vorstellung Rahmenplanentwurf Stadteingang Elbbrücken . 10 Blitzlicht-Kommentare . 17 Fragen und Antworten . 20 Impressum . 24 Titel: Stadtmodell, Blick auf die Elbbrücken und Elbtower ELBBRÜCKEN : DIALOG Liebe Leserinnen und Leser, der Bereich rund um die Elbbrücken ist der vielleicht reizvollste Stadteingang, den Hamburg zu bieten hat. Reizvoll deswegen, weil das Überqueren der Elbe mit Blick auf die Elbphilharmonie und in einigen Jahren auch auf den Elbtower die Ankommenden auf beson- dere Weise auf die Stadt einstimmt. Doch so sehr viele Reisende beeindruckt sind von der Größe unse- res Hafens und dem vielen Stadtgrün, so wenig einla- dend wirken die Gebiete, über die wir bei der Stadt- werkstatt am 2. Oktober 2020 diskutiert haben. Es ist ein rauer Ort, der freundlicher und auch besser nutzbar gemacht werden soll. 2019 präsentierten uns drei Planungsbüros Vor- stellungen, wie dieser Stadtraum künftig aussehen All dies gilt auch für den Stadteingang rund um die könnte. Davon haben uns die Entwürfe des Hambur- Elbbrücken. Hier soll ein funktionales und anspre- ger Architekturbüros gmp International am meisten chendes „Gelenkstück“ der wachsenden Stadt ent- überzeugt. Dessen Ideen für das Planungsgebiet wur- stehen, das allen Ansprüchen moderner Stadtpla- den bei der Stadtwerkstatt im November letzten Jah- nung entspricht. Wertvolle Bestände sollen integriert, res ausführlich vorgestellt und mit den anwesenden bestehende Zugänge zum Wasser und zu Grünräumen oder online teilnehmenden Bürgerinnen und Bürgern gestärkt und neue Verbindungen geschaffen werden. -

Nachhaltige Naturschutzfachliche Renaturierung Von Naturräumen Durch Ein Projekt
Aus dem Institut für Management ländlicher Räume der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät Nachhaltige naturschutzfachliche Renaturierung von Naturräumen durch ein Projekt- und Naturschutzflächenmanagement - belegt am Beispiel von Kernzonen des Biotopverbundsystems im Kreis Herzogtum Lauenburg - Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Agrarwissenschaften (doctor agriculturae) an der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät der Universität Rostock Vorgelegt von Dipl. Kfm. Carl-Heinz Schulz, geb. am 22. Juli 1949 in Hamburg Jagdhaus, 21493 Groß Schretstaken Rostock, den 28. März 2007 urn:nbn:de:gbv:28-diss2008-0057-9 Gutachter: Prof. Dr. Wolfgang Riedel Universität Rostock, Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät Prof. Dr. Dietwald Gruehn Universität Dortmund, Lehrstuhl für Landschaftsökologie und Landschaftsplanung Prof. Dr. Stefan Porembski Universität Rostock, Mathematisch - Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Bio- wissenschaften Verteidigung: Rostock, den 20. Dezember 2007 Dank Viele Informationen sind auch die Basis dieser Arbeit; und viele Informanten. Zunächst danke ich Herrn Prof. Dr. Wolfgang Riedel, Agrar- und Umweltwissenschaft- liche Fakultät der Universität Rostock, der mich ermunterte, diese Dissertation zu schreiben und der mich betreute. Ebenso danke ich Herrn Prof. Dr. Dietwald Gruehn, Fakultät Raumplanung, FG Landschaftsökologie und Landschaftsplanung der Univer- sität Dortmund sowie Herrn Dr. Hermann Könker, Rostock. Mein ganz besonderer Dank gilt Frau Hanna Böhringer, die mir hilfreich bei der Daten- ermittlung zur Seite stand, wenn ich allein nicht weiter kam. Des Weiteren danke ich Gabriele und Joachim Schmidt-Handke und Frau Cornelia Krohne für ihre praktische Hilfe. Viele Bürgermeister und andere Personen haben mich mit Informationen unter- stützt. Auch hierfür schulde ich Dank. Zum Abschluss geht ein großer Dank an meine Frau Renate und unseren Sohn Alexander, die mich immer wieder ermunterten und unterstützten.