Dissertation Anke Rätsch Monarch
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

DER SPIEGEL Jahrgang 1999 Heft 51
Werbeseite Werbeseite DAS DEUTSCHE NACHRICHTEN-MAGAZIN Hausmitteilung 20. Dezember 1999 Betr.: Moral, Hyperaktive, McCartney olitiker verstricken sich in Skandale, Talk- Pshows suchen nach letzten Perversitäten, Schüler schmieden Mordpläne gegen Lehrer, und für viele dreht sich alles nur ums Geld – gibt es denn keine Moral mehr? Oder zeigt sich Moral heute anders als früher, losgelöst von In- stitutionen wie Kirchen, Gewerkschaften, Ver- einen oder Verbänden? Keine einfachen Fra- gen, die sich die SPIEGEL-Redakteure Carolin Emcke, 32, und Ulrich Schwarz, 63, in der Ti- telgeschichte gestellt haben. Zumal die Autoren ganz unterschiedlich ans Thema gingen: Als ka- T. KLINK / ZEITENSPIEGEL T. tholischer Theologe fühlt sich Schwarz eher Emcke, Schwarz den Gesetzen des Glaubens verpflichtet. Die promovierte Philosophin und Habermas-Schü- lerin Emcke setzt dagegen auf öffentlichen Diskurs als Orientierungshilfe moder- ner Gesellschaften. Dennoch waren sich beide einig: „Ohne Moral geht es nicht“, so Emcke, „und sie lässt sich nicht einfach entsorgen“ (Seite 50). ei ihren Recherchen über das „Zappelphilipp-Syndrom“ traf SPIEGEL- BRedakteurin Renate Nimtz-Köster, 55, verzweifelte Eltern am Ende ihrer Kräfte. Sie haben hyperaktive Kinder, die nie zur Ruhe finden. Ob in der Schule, im Turn- verein oder zu Hause – alles gerät den Kleinen zum Chaos. Die Eltern leiden oft doppelt, hat Nimtz-Köster erfahren: „Viele wissen nicht, wie sie mit der Krankheit umgehen sollen, und dann werden sie auch noch von ihrer Umwelt beschimpft.“ Erzieherinnen mahnen zu mehr Strenge, Freunde sind genervt, Kinderärzte be- schwichtigen: „Das wächst sich aus.“ Tut es nicht. Als Ursache der Ruhelosigkeit gilt inzwischen ein neurobiologisches Defizit im Hirn-Stoffwechsel. In besonders drastischen Fällen helfen kurzfristig Medikamente. -

Anatomie Der Staatssicherheit Geschichte, Struktur Und Methoden — Mfs-Handbuch —
Anatomie der Staatssicherheit Geschichte, Struktur und Methoden — MfS-Handbuch — Bitte zitieren Sie diese Online-Publikation wie folgt: Angela Schmole: Hauptabteilung VIII. Beobachtung, Ermittlung, Durchsuchung, Festnahme (MfS-Handbuch). Hg. BStU. Berlin 2011. http://www.nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0292-97839421300977 Mehr Informationen zur Nutzung von URNs erhalten Sie unter http://www.persistent-identifier.de/ einem Portal der Deutschen Nationalbibliothek. Vorbemerkung Das Handbuchprojekt »Anatomie der Staatssicherheit« ist eines der ältesten Vorhaben des Forschungsbereiches der Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen (BStU). Es wurde bereits im Jahr 1993 begonnen – wenige Monate nach der Gründung der Abteilung »Bil dung und Forschung« und stellt dem wissenschaftlichen Fachpublikum wie auch anderen interessierten Nutzern von Stasi-Akten in kontinuierlich erscheinenden Teillieferungen umfassendes Grundwissen zum MfS zur Verfügung: die Entwicklung der Gesamtinstituti on MfS in ihrem historischen Kontext, die Geschichte seiner wichtigsten Arbeitsbereiche, grundlegende Darlegungen zu den hauptamtlichen und inoffiziellen Mitarbeitern sowie verschiedene Übersichten und Materialien zur Struktur des MfS und ihrer Entwicklung, Kurzbiographien des Leitungspersonals und eine Edition der wichtigsten Grundsatzdoku mente. Das »MfS-Handbuch« folgt der Verpflichtung der BStU zur »Aufarbeitung der Tätigkeit des Staatssicherheitsdienstes durch Unterrichtung der Öffentlichkeit über Struk tur, Methoden und Wirkungsweise des Staatssicherheitsdienstes« -
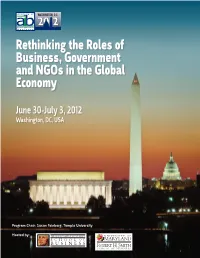
AIB 2012 Conference Program
WASHINGTON, D.C. 20 2 Rethinking the Roles of Business, Government and NGOs in the Global Economy June 30-July 3, 2012 Washington, DC, USA Program Chair: Susan Feinberg, Temple University Hosted by: Table of Contents WELCOMES President’s Letter . 2 Letter from the Program Chair . 3 Letters from the Local Hosts . 6 SPONSORS Conference Sponsors . 8 CONTRIBUTORS 2012 Program Committee .. 9 AIB 2012 Reviewers . 10 AWARDS 2012 Program Awards. 19 AIB President’s Award for International Development . 22 AIB Fellows’ Executive of the Year . 23 AIB Fellows’ Educator of the Year . 24 AIB Fellows’ Eminent Scholar . 25 LOGISTICS When You Arrive . 26 Floor Map . 26 Street Map . 27 PROGRAM AIB 2012 Program Overview . 28 AIB 2012 Detailed Program . 30 Program Contributor Index . 76 EXHIBITORS 2012 Exhibitor Listing . 87 ABOUT AIB AIB Institutional Members . 88 AIB Past Presidents . 89 Past AIB Conference Locations . 89 AIB Fellows . 90 AIB 2013 ISTANBUL AIB 2013 Conference Theme . .. 92 AIB 2012 | Rethinking the Roles of Business, Government and NGOs in the Global Economy 1 AIB President’s Letter Welcome to Washington D .C ., for the Annual Meeting of the Academy of International Business EXECUTIVE BOARD Last year, in Japan, we welcomed what was one of the largest annual AIB conferences ever despite President Mary Ann Von Glinow horrific events preceding our meeting; this year we will surpass those numbers . If size is an indicator Florida International University of membership enthusiasm, then Susan Feinberg and her track chairs have put together an incredible Immediate Past President program on “Rethinking the Roles of Business, Government and NGOs in the Global Economy,” the Yves Doz INSEAD theme of this year’s program . -

Namen, Die Kaum Einer Kennt. Denk´Ich an Polen in Der Nacht
2 1 0 2 R E B O T K O AKADEMISCHE MZeiOtschN riftAdeTsSKaBrteLllveÄrbaTndTesER katholischer deutscher Studenten- AM vereine KV • 124. Jahrgang • Nr. 8 Namen, die kaum einer kennt. Denk´ich an Polen in der Nacht ... Titelthema 228 Hauptausschuss und Vorort 2012/2013 Fuchsentagung 2012 Aktiventag in Marl EDITORIAL Liebe Kartellbrüder, liebe Leserinnen und Leser! Ein Redakteur soll- Außerdem gibt es etwas Erfreuliches mitzuteilen: Der Aktiven - te nicht zu r Schwer - tag, der am 16. September 2012 zum zweiten Mal tagte, hat mut neigen. Den- den Katholischen Studentenverein Markomannia in Münster noch kann ich mich zum Vorort gewählt. Die Redaktion wird alles zu seiner Unter - nicht einer An wand - stützung tun. Heute können wir die aktiven Kartellbrüder, die lung dazu erweh - für das kommende Jahr Mitverantwortung für die Geschicke des ren, wenn ich über Verbandes übernommen haben, schon in Wort und Bild vor - den gerade am 16. stellen. September 2012 zu Ende gegangenen Hauptausschuss nach - Diskussionswürdig ist ein Beitrag dreier Mitglieder des Alther - denke. Was ist passiert? Der KV-Rat hatte den Antrag gestellt, renbundsvorstandes, die vorschlagen, unser Prinzip Religion für das nächste Jahr 20.000 Euro mehr zu bewilligen, damit wir konkreter zu fassen und es stattdessen mit Christentum zu um - die „Akademischen Monatsblätter “ im Jahr ihres 125-jährigen schreiben. Bestehens wieder repräsentativer drucken könnten. Die über - Besonders aufmerksam machen möchte ich überdies auf das wältigende Mehrheit der Aktiven lehnten das ab, ohne dass Geistliche Wort, das sich u.a. mit der Frage befasst, ob AIDS als recht deutlich wurde, warum sie dagegen war. Ich will über die eine Strafe Gottes angesehen werden darf. -

Randauszaehlungbrdkohlband
Gefördert durch: Randauszählungen zu Elitestudien des Fachgebiets Public Management der Universität Kassel Band 21 Die Politisch-Administrative Elite der BRD unter Helmut Kohl (1982 – 1998) Bastian Strobel Simon Scholz-Paulus Stefanie Vedder Sylvia Veit Die Datenerhebung erfolgte im Rahmen des von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien geförderten Forschungsprojektes „Neue Eliten – etabliertes Personal? (Dis-)Kontinuitäten deut- scher Ministerien in Systemtransformationen“. Zitation: Strobel, Bastian/Scholz-Paulus, Simon/Vedder, Stefanie/Veit, Sylvia (2021): Die Poli- tisch-Administrative Elite der BRD unter Helmut Kohl (1982-1998). Randauszählungen zu Elite- studien des Fachgebiets Public Management der Universität Kassel, Band 21. Kassel. DOI: 10.17170/kobra-202102193307. Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ...................................................................................................................................... 1 2 Personenliste ................................................................................................................................ 4 3 Sozialstruktur .............................................................................................................................. 12 4 Bildung ........................................................................................................................................ 16 5 Karriere ....................................................................................................................................... 22 6 Parteipolitisches -

Politische Studien Nr. 360 SED Und
49. Jahrgang • Juli/August 1998 • ISBN 3-928561-77-4 B 2237 F Zweimonatszeitschrift für Politik und Zeitgeschehen POLITISCHE STUDIEN 360 José María Aznar POLITISCHE STUDIEN-Zeitgespräch mit dem spanischen Ministerpräsidenten Theo Waigel Die moderne christliche Volkspartei - Das politische Werk Josef Müllers Norbert Walter Perspektiven der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion Schwerpunktthema: SED und PDS: Beiträge zu Geschichte und Gegenwart einer sozialistischen Partei mit Beiträgen von Rüdiger Dambroth, Olaf Kappelt, Otto Wenzel und Manfred Wilke Hanns Seidel Stiftung eV Atwerb-Verlag KG Hanns Seidel Stiftung eV Herausgeber: tronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder Hanns-Seidel-Stiftung e.V. verbreitet werden. Redaktionelle Zuschriften wer- Vorsitzender: Alfred Bayer, Staatssekretär a. D. den ausschließlich an die Redaktion erbeten. Hauptgeschäftsführer: Manfred Baumgärtel Verantwortlich für Publikationen, Presse- und Die Beiträge in diesem Heft geben nicht unbedingt Öffentlichkeitsarbeit: Burkhard Haneke die Meinung der Redaktion wieder; die Autoren tragen für ihre Texte die volle Verantwortung. Redaktion: Unverlangt eingesandte Manuskripte werden nur Dr. Reinhard C. Meier-Walser (Chefredakteur) zurückgesandt, wenn ihnen ein Rückporto beiliegt. Paula Bodensteiner (Redakteurin) Verena Hausner (Redakteurin) Bezugspreis: Einzelhefte DM 8,80. Irene Krampfl (Redaktionssekretärin) Jahresabonnement DM 53,40. Für Studierende 50 % Abonnementnachlaß gegen Vorlage eines Hö- Anschrift: rerscheins ihres Instituts. Redaktion POLITISCHE -

Berlin Wird Brücke Zu Osteuropa Werden
Heute auf Seite 3: War Moskaus Aufmarsch bekannt? tXB £>ftpttudmWfltt UNABHÄNGIGE WOCHENZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND Jahrgang 42 - Folge 26 Erscheint wöchentlich Landsmannschaft Ostpreußen e.V. £ RKOA ß Postvertriebsstück. Gebühr bezahlt 29. Juni 1991 Parkallee 84/36,2000 Hamburg 13 ^J u Hauptstadt: Berlin wird Brücke zu Osteuropa werden Die Bundestagsentscheidung hat weitgehendste Bedeutung für Deutschlands Stellung in der Welt Man könne Deutschland auch von seinen Rändern her neu aufrichten, meinten dieje• nigen Kräfte, denen das geteilte Land immer ein Stachel im Herzen geblieben war. Nun, da die Vereinigung von West- und Mittel• deutschland ebenso vollzogen ist wie die Rückverlegung der Hauptstadt, bekommt die oben erwannte These einen wiederum neuen Sinngehalt - Berlin liegt ungefähr gleichviele Kilometer von Küstrin entfernt wie Eupen-Malmedy von Bonn. Mit der einen Randlage, der Bonner, ist es in den gut vierzig Nacnkriegsjahren nicht nur gelungen, die tragische Konkursmasse des Reiches, die Vertriebenen und Flüchtlin• ge, so zu kanalisieren, daß sie in den teilwei• se strukturschwachen Gebieten West• deutschlands Zonen höchster wirtschaftli• cher Leistungsfähigkeit entwickeln konnte, sondern auch die ideologische Ab• wehrschlacht, von Moskau massiv hinein• getragen in die Gebiete Ost- und Mittel• deutschlands, erfolgreich bestehen zu kön• nen. Zonen dichtester Bevölkerungskonzen• tration entstanden in Westdeutschland durch die beispiellosen Vertreibungsaktio• nen aus Ostdeutschland, die nach der Instal• lierung des SED-Regimes auch noch durch flüchtende Mitteldeutsche verstärkt wurde. Dem muzsmen Jetzt, da sich das Parlament, freilich mit den Stimmanteilen der SED-Nachfolgepar• tei PDS und dem Bündnis 90, in der Haupt• stadtfrage entschieden hat, wird sich bevöl• kerungspolitisch eine Entspannungsphase auftun, die gewiß keine Umwertung aller Werte mit sicn bringen dürfte, wohl aber ein allmähliches Rückströmen jener Kräfte an• zeigen wird, denen Frankfurt/Oder und Cottbus nicht ganz aus dem Sinn gekommen ist. -
CLOUD COMPUTING 2019 Proceedings
CLOUD COMPUTING 2019 The Tenth International Conference on Cloud Computing, GRIDs, and Virtualization ISBN: 978-1-61208-703-0 May 5 - 9, 2019 Venice, Italy CLOUD COMPUTING 2019 Editors Bob Duncan, University of Aberdeen, UK Yong Woo Lee, University of Seoul, Korea Magnus Westerlund, Arcada University of Applied Sciences, Finland Andreas Aßmuth, Technical University of Applied Sciences OTH Amberg-Weiden, Germany 1 / 148 CLOUD COMPUTING 2019 Forward The Tenth International Conference on Cloud Computing, GRIDs, and Virtualization (CLOUD COMPUTING 2019), held between May 5 - 9, 2019 - Venice, Italy, continued a series of events targeted to prospect the applications supported by the new paradigm and validate the techniques and the mechanisms. A complementary target was to identify the open issues and the challenges to fix them, especially on security, privacy, and inter- and intra-clouds protocols. Cloud computing is a normal evolution of distributed computing combined with Service- oriented architecture, leveraging most of the GRID features and Virtualization merits. The technology foundations for cloud computing led to a new approach of reusing what was achieved in GRID computing with support from virtualization. The conference had the following tracks: Cloud computing Computing in virtualization-based environments Platforms, infrastructures and applications Challenging features Similar to the previous edition, this event attracted excellent contributions and active participation from all over the world. We were very pleased to receive top quality contributions. We take here the opportunity to warmly thank all the members of the CLOUD COMPUTING 2019 technical program committee, as well as the numerous reviewers. The creation of such a high quality conference program would not have been possible without their involvement. -
AIB 2010 Rio De Janeiro Conference Program
International Business in Tough Times June 25–29, 2010 Rio de Janeiro, Brazil Program Chair: Tatiana Kostova University of South Carolina Hosted By: Contents AIB President’s Letter . 2 From the Program Chair . 3 From the Local Host Committee Chair . 6 Local Host Institutions . 7 AIB 2010 Conference Sponsors . 8 Program Acknowledgements . 9 AIB 2010 Reviewers . 10 2010 Program Awards . 19 Executive of the Year . 22 Educator of the Year . 23 When You Arrive . .24 Hotel Maps . .24 2010 Exhibitor Listing . .26 AIB 2010 Program Overview . .28 2010 AIB Conference Detailed Program . .30 Program Contributor Index . 73 Advertisements . .86 AIB Institutional Members . .89 Past Presidents of the AIB . .90 Past AIB Conference Locations . .90 AIB Fellows . 91 AIB 2011 Destination . 92 AIB 2011 Conference Theme . .94 AIB 2010 Annual Conference Rio de Janeiro, Brazil June 25–29 International Business in Tough Times 1 EXECUTIVE BOARD President AIB President’s Letter Yves Doz INSEAD A warm welcome to Rio for the 2010 Annual Meeting Immediate Past President of the Academy of International Business Stefanie Ann Lenway University of Illinois at Chicago Vice President - 2009 Program Tatiana Kostova and her track chairs have put together an outstanding program, reflecting Torben Pedersen the complex predicament of international business in this tough time of crisis and uncer- Copenhagen Business School tainty .They deserve our warmest thanks . We are indeed facing tough times .The process of Vice President - 2010 Program Tatiana Kostova adjustment is painful . It is symbolic that Brazil is perhaps best handling the economic crisis University of South Carolina among large countries . We can learn from Brazil . -

The State at Its Borders: Germany and the Schengen Negotiations
The state at its borders: Germany and the Schengen negotiations Ph.D. in International Relations Franziska Doebler-Hagedorn The London School of Economics and Political Science 2003 UMI Number: U615239 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. Dissertation Publishing UMI U615239 Published by ProQuest LLC 2014. Copyright in the Dissertation held by the Author. Microform Edition © ProQuest LLC. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 T H t £ £ £ £ f 8o ° i2. lOZ$b°\3 Abstract The objective of this thesis is to explore Germany’s border policies in the face of a European-level intergovernmental regime for border-related policies: The Schengen Agreements (1985-1995)1. The results are twofold: The border retains an essential role for state authorities for security provision since European solutions were only sought to nationally understood security threats. Yet a new principle of internal and external borders emerged in which competence for border policies was moved to the European level and in which the interests of other states have to be taken into account as if they were the state’s own. The thesis analyses the rationale of Germany for advocating such a transfer of hitherto essentially national competence to an intergovernmental mechanism. -
Schriftliche Fragen Mit Den in Der Woche Vom 21
Deutscher Bundestag Drucksache 12/6893 12. Wahlperiode 25.02.94 Schriftliche Fragen mit den in der Woche vom 21. Februar 1994 eingegangenen Antworten der Bundesregierung Verzeichnis der Fragenden Abgeordnete Nummer Abgeordnete Nummer der Frage der Frage Augustinowitz, Jürgen (CDU/CSU) 10, 68 Lowack, Ortwin (fraktionslos) 18, 67 Beucher, Friedhelm Julius (SPD) 11 Löwisch, Sigrun (CDU/CSU) 69, 70, 71, 72 Böhm, Wilfried (Melsungen) (CDU/CSU) 12, 13, 14, 15 Lüder, Wolfgang (F.D P ) 43, 44 Dr. von Billow, Andreas (SPD) 39, 40, 41 Matthäus-Maier, Ingrid (SPD) 45 Duve, Freimut (SPD) 1 Dr. Meyer, Jürgen (Ulm) (SPD) 19, 20 Eich, Ludwig (SPD) 42 Michalk, Maria (CDU/CSU) 21, 22, 23, 24 Dr. Feldmann, Olaf (F.D.P ) 46, 47 Neumann, Volker (Bramsche) (SPD) . 51, 52, 53, 54 Fuchtel, Hans-Joachim (CDU/CSU) 73, 74, 75 Dr. Otto, Helga (SPD) 25 Ganseforth, Monika (SPD) 56, 57 Dr. Protzner, Bernd (CDU/CSU) 55 Haack, Hermann (Extertal) (SPD) . 59, 60, 61, 62 Dr. Sonntag-Wolgast, Cornelie (SPD) 6, 7 Hörster, Joachim (CDU/CSU) 33 Wallow, Hans (SPD) 26 Dr. Jobst, Dionys (CDU/CSU) 48 Walther, Rudi (Zierenberg) (SPD) 2, 3, 4, 5 Keller, Peter (CDU/CSU) 34 Wartenberg, Gerd (Berlin) (SPD) 8, 9, 27, 28 Dr. Klejdzinski, Karl-Heinz (SPD) . 35, 36, 37, 38 Weis, Reinhard (Stendal) (SPD) . 58, 65, 66 Koschyk, Hartmut (CDU/CSU) 49 Weisheit, Matthias (SPD) 63, 64 Kuessner, Hinrich (SPD) 50 Welt, Jochen (SPD) 29, 30, 31, 32 Laumann, Karl-Josef (CDU/CSU) 16, 17 Drucksache 12/6893 Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode Verzeichnis der Fragen nach Geschäftsbereichen -

UID 1989 Nr. 22, Union in Deutschland
CDU-Informationsdienst Union in Deutschland Mö© Bonn, den 13. Juli 1989 22/89 Bundeskanzler Helmut Kohl: Wir wollen Verständigung mit dem polnischen Volk Zur gegenwärtigen Diskussion über die Rechtslage Deutschlands erklärt Bun- HEUTE AKTUELL deskanzler Helmut Kohl: • Beschäftigung Die Staats- und völkerrechtlichen Grundlagen unse- Anhaltende Besserung auf dem rer Außen- und Deutschlandpolitik stehen nicht zur Arbeitsmarkt. Seite 3 Disposition. Namens der Bundesregierung habe ich diese Grundlagen in zahlreichen Regierungserklä- • Präsidium: rungen und allgemeinen Berichten zur Lage der Keine politische Zusammen- Nation im geteilten Deutschland immer wieder arbeit mit radikalen Parteien. Seite 4 bekräftigt. Die deutsche Frage bleibt rechtlich und politisch offen. • Bundesregierung Die Deutschlandpolitik sowie unsere Politik gegen- Rudolf Seiters: Bilanz der über den Staaten Mittel- und Osteuropas bleiben Regierungsarbeit. Seite 5 bestimmt durch • Berlin • das Grundgesetz für die Bundesrepublik Rot-radikales Regierungsbünd- Deutschland, nis in Bonn wäre eine andere Republik. Seite 9 • den Deutschlandvertrag, • den Moskauer und den Warschauer Vertrag von • Kommunen 1970, (Fortsetzung auf Seite 2) Neue Baunutzungsverordnung verabschiedet: Weniger Spiel- hallen, mehr Dachgeschoß- Aufforderung zur Diskussion wohnungen. Seite 11 Im grünen Teil dieser Ausgabe finden Sie als • Altersversorgung Dokumentation den Antrag des Bundesausschus- Die Renten sind wieder sicher. ses an den 37. Bundesparteitag „Moderne Par- Seite 14 teiarbeit in den 90er