Von Ost-Berlin Nach West- Berlin
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Victims at the Berlin Wall, 1961-1989 by Hans-Hermann Hertle/Maria Nooke August 2011
Special CWIHP Research Report The Victims at the Berlin Wall, 1961-1989 By Hans-Hermann Hertle/Maria Nooke August 2011 Forty-four years after the Berlin Wall was built and 15 years after the East German archives were opened, reliable data on the number of people killed at the Wall were still lacking. Depending on the sources, purpose, and date of the studies, the figures varied between 78 (Central Registry of State Judicial Administrations in Salzgitter), 86 (Berlin Public Prosecution Service), 92 (Berlin Police President), 122 (Central Investigation Office for Government and Unification Criminality), and more than 200 deaths (Working Group 13 August). The names of many of the victims, their biographies and the circumstances in which they died were widely unknown.1 This special CWIHP report summarizes the findings of a research project by the Center for Research on Contemporary History Potsdam and the Berlin Wall Memorial Site and Documentation Center which sought to establish the number and identities of the individuals who died at the Berlin Wall between 1961 and 1989 and to document their lives and deaths through historical and biographical research.2 Definition In order to provide reliable figures, the project had to begin by developing clear criteria and a definition of what individuals are to be considered victims at the Berlin Wall. We regard the “provable causal and spatial connection of a death with an attempted escape or a direct or indirect cause or lack of action by the ‘border organs’ in the border territory” as the critical factor. In simpler terms: the criteria are either an attempted escape or a temporal and spatial link between the death and the border regime. -

Fluchtgeschichten
Fluchtgeschichten Bath, Matthias : 1197 Tage als Fluchthelfer in DDR-Haft , Berlin, 1987. Mathias Bath will sich aus politischer Überzeugung als Fluchthelfer betätigen. Bei seiner ersten Fluchtaktion kommt er mit Flüchtlingen im Kofferraum in eine gezielte Grenzkontrolle und wird festgenommen. In seinem Buch schildert und entlarvt er die Mittel und Methoden der Strafverfolgungs- und Strafvollzugsorgane der DDR. Beck, Kerstin : Verschleierte Flucht. Aus der DDR über Afghanistan in die Freiheit, Berlin 2005. Spektakuläre Flucht aus der DDR in den 80er Jahren: Zu Fuß, auf Pferden und Eseln flieht Kerstin Beck von Kabul zur afghanisch-pakistanischen Grenze. Sie ließ sich für sechs Monate mit sechs anderen Studenten zu einem Sprachpraktikum ins sozialistische Bruderland Af- ghanistan schicken. Dort konnte sie der Wachsamkeit der (ost-)deutschen, sowjetischen und afghanischen Staatssicherheit entkommen und wurde von einer Gruppe Mudschahedin zur Grenze nach Pakistan geleitet. Detjen, Marion : Ein Loch in der Mauer. Die Geschichte der Fluchthilfe im geteilten Deutsch- land. 1961 – 1989, München 2005. Die Autorin legt die erste Gesamtgeschichte der Fluchthilfe vor, das bis heute als Standard- werk gilt. Die Darstellung lebt von dem abenteuerlichen Stoff konspirativer Treffen, gehei- mer Aktionen und gefährlicher Fluchten. Gleichzeitig wirft die zeithistorische Analyse ein neues Licht auf die Geschichte der beiden deutschen Staaten auf Grundlage der einschlägi- gen Quellen. Heinz, Volker G. : Der Preis der Freiheit. Eine Geschichte über Fluchthilfe, Gefangenschaft und die geheimen Geschäfte zwischen Ost und West , Reinbek bei Hamburg, 2016. Volker Heinz erzählt seine Geschichte als studentischer Fluchthelfer 1. Dutzende DDR- Bürger gelangen mit seiner Hilfe 1966/67 erfolgreich nach West-Berlin, bis er von Mitarbei- tern des MfS wegen seiner Aktivitäten verhaftet wird. -

DER SPIEGEL Jahrgang 1999 Heft 51
Werbeseite Werbeseite DAS DEUTSCHE NACHRICHTEN-MAGAZIN Hausmitteilung 20. Dezember 1999 Betr.: Moral, Hyperaktive, McCartney olitiker verstricken sich in Skandale, Talk- Pshows suchen nach letzten Perversitäten, Schüler schmieden Mordpläne gegen Lehrer, und für viele dreht sich alles nur ums Geld – gibt es denn keine Moral mehr? Oder zeigt sich Moral heute anders als früher, losgelöst von In- stitutionen wie Kirchen, Gewerkschaften, Ver- einen oder Verbänden? Keine einfachen Fra- gen, die sich die SPIEGEL-Redakteure Carolin Emcke, 32, und Ulrich Schwarz, 63, in der Ti- telgeschichte gestellt haben. Zumal die Autoren ganz unterschiedlich ans Thema gingen: Als ka- T. KLINK / ZEITENSPIEGEL T. tholischer Theologe fühlt sich Schwarz eher Emcke, Schwarz den Gesetzen des Glaubens verpflichtet. Die promovierte Philosophin und Habermas-Schü- lerin Emcke setzt dagegen auf öffentlichen Diskurs als Orientierungshilfe moder- ner Gesellschaften. Dennoch waren sich beide einig: „Ohne Moral geht es nicht“, so Emcke, „und sie lässt sich nicht einfach entsorgen“ (Seite 50). ei ihren Recherchen über das „Zappelphilipp-Syndrom“ traf SPIEGEL- BRedakteurin Renate Nimtz-Köster, 55, verzweifelte Eltern am Ende ihrer Kräfte. Sie haben hyperaktive Kinder, die nie zur Ruhe finden. Ob in der Schule, im Turn- verein oder zu Hause – alles gerät den Kleinen zum Chaos. Die Eltern leiden oft doppelt, hat Nimtz-Köster erfahren: „Viele wissen nicht, wie sie mit der Krankheit umgehen sollen, und dann werden sie auch noch von ihrer Umwelt beschimpft.“ Erzieherinnen mahnen zu mehr Strenge, Freunde sind genervt, Kinderärzte be- schwichtigen: „Das wächst sich aus.“ Tut es nicht. Als Ursache der Ruhelosigkeit gilt inzwischen ein neurobiologisches Defizit im Hirn-Stoffwechsel. In besonders drastischen Fällen helfen kurzfristig Medikamente. -

Bibliografie Zum Staatssicherheitsdienst Der DDR
Bibliografie zum Staatssicherheitsdienst der DDR – 2018 .bstu.de w ww Bibliografie zum Staatssicherheitsdienst der DDR Stand: Dezember 2018 BStU Bibliografie zum Fachbibliothek Staatssicherheitsdienst der DDR Stand: Dezember 2018 BStU Bibliografie zum Fachbibliothek Staatssicherheitsdienst der DDR Inhalt Vorbemerkung 4 1. Hilfsmittel (Bibliografien, Nachschlagewerke, Quellenkunde und Archivberichte) 5 2. Apparat und Tätigkeit des MfS 15 2.1. Vor 1990 erschienene Literatur 15 2.2. Allgemeine und Überblicksdarstellungen 19 2.3. Vorgeschichte des MfS 35 2.4. Apparat des MfS 41 2.5. Inoffizielle Mitarbeit und operative Methoden 66 2.6. Internationale Verbindungen 111 3. Einzelne staatliche und gesellschaftliche Bereiche 118 3.1. Spionage und Westarbeit 118 3.2. Politische Justiz 166 3.3. Opposition und Verfolgung 210 3.4. Staatssicherheit und Kirche 279 3.5. Staatssicherheit in Wissenschaft, Kultur und Medien 310 3.6. Staatssicherheit in der Wirtschaft 357 3.7. Sonstige Bereiche 371 3.8. Wendegeschehen und Auflösung des Staatssicherheitsdienstes 414 4. Angrenzende Themenbereiche 442 4.1. Andere Sicherheitsorgane und sicherheitspolitische Gremien der DDR 442 4.2. Sonstige Literatur zu Geheimdiensten (Auswahl) 457 5. Aktuelle Themen 467 5.1. Das Stasi-Unterlagen-Gesetz und seine Anwendung 467 5.2. Juristische Aufarbeitung 506 5.3. Weitere politische Aufarbeitung 541 6. Biografien 591 6.1. Sammelbiografien (auch biografische Handbücher) 591 6.2. Einzelbiografien und biografische Schriften 597 Autoren- und Herausgeberregister 640 Stand: Dezember -

Anatomie Der Staatssicherheit Geschichte, Struktur Und Methoden — Mfs-Handbuch —
Anatomie der Staatssicherheit Geschichte, Struktur und Methoden — MfS-Handbuch — Bitte zitieren Sie diese Online-Publikation wie folgt: Angela Schmole: Hauptabteilung VIII. Beobachtung, Ermittlung, Durchsuchung, Festnahme (MfS-Handbuch). Hg. BStU. Berlin 2011. http://www.nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0292-97839421300977 Mehr Informationen zur Nutzung von URNs erhalten Sie unter http://www.persistent-identifier.de/ einem Portal der Deutschen Nationalbibliothek. Vorbemerkung Das Handbuchprojekt »Anatomie der Staatssicherheit« ist eines der ältesten Vorhaben des Forschungsbereiches der Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen (BStU). Es wurde bereits im Jahr 1993 begonnen – wenige Monate nach der Gründung der Abteilung »Bil dung und Forschung« und stellt dem wissenschaftlichen Fachpublikum wie auch anderen interessierten Nutzern von Stasi-Akten in kontinuierlich erscheinenden Teillieferungen umfassendes Grundwissen zum MfS zur Verfügung: die Entwicklung der Gesamtinstituti on MfS in ihrem historischen Kontext, die Geschichte seiner wichtigsten Arbeitsbereiche, grundlegende Darlegungen zu den hauptamtlichen und inoffiziellen Mitarbeitern sowie verschiedene Übersichten und Materialien zur Struktur des MfS und ihrer Entwicklung, Kurzbiographien des Leitungspersonals und eine Edition der wichtigsten Grundsatzdoku mente. Das »MfS-Handbuch« folgt der Verpflichtung der BStU zur »Aufarbeitung der Tätigkeit des Staatssicherheitsdienstes durch Unterrichtung der Öffentlichkeit über Struk tur, Methoden und Wirkungsweise des Staatssicherheitsdienstes« -

Berliner Mauer Und Innerdeutsche Grenze Bestandsverzeichnis Aus Der Bibliothek Der Bundesstiftung Aufarbeitung
Berliner Mauer und innerdeutsche Grenze Bestandsverzeichnis aus der Bibliothek der Bundesstiftung Aufarbeitung In der Nacht zum 13. August 1961 begann die Abriegelung der Grenze zu den Berliner Westsektoren durch das SED-Regime. Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften von Volks- und Grenzpolizei sowie Betriebskampfgruppen der SED wurden Verbindungs- straßen aufgerissen, Spanische Reiter und Stacheldrahtverhaue errichtet und der öffentliche Nahverkehr zwischen den beiden Stadtteilen dauerhaft unterbrochen. In den folgenden Tagen und Wochen wurden die provisorischen Stacheldrahtsperren unter scharfer Bewachung durch DDR-Grenzposten mit einer Mauer aus Hohlblock- steinen und Betonplatten ersetzt. Walter Ulbricht hatte sein Ziel erreicht. Der letzte noch offene Fluchtweg in den Westen war geschlossen und die bis dahin stetig wachsende Fluchtbewegung aus der DDR gestoppt. Die Berliner Mauer existierte über 28 Jahre lang und wurde zum Symbol für das menschenverachtende Regime in der DDR-Diktatur und zum Symbol der Deutschen Teilung und des Kalten Krieges. Die Mauer stand zudem für die Unerbittlichkeit eines Regimes, das auch vor Todesschüssen auf Flüchtlinge nicht zurückschreckte. Die vorliegende Bibliographie umfasst sämtliche Monographien, Broschüren und audiovisuellen Medien aus dem Bestand der Stiftungsbibliothek, die sich dem Themenkomplex Berliner Mauer und innerdeutsche Grenze widmen. Das Verzeichnis ist in folgende Rubriken gegliedert: Mauerbau und Vorgeschichte ● Leben mit der Mauer ● Innerdeutsche Grenze ● Flucht und Opfer der Mauer/innerdeutschen Grenze ● Grenze und Fluchtbewegung vor 1961 ● Gedenkstätten und Erinnerung ● Ausreise Mauerbau und Vorgeschichte 3 x durch den Zaun. Bonn: Büro Bonner Berichte, 1963. Signatur: F 9591 13. August 1961. Bonn: Kuratorium Unteilbares Deutschland, 1961. Signatur: F 9963 13. August 1961. 2., überarb. Aufl. Bonn: Gesamtdt. Inst., 1986. (Seminarmaterial des Gesamtdeutschen Instituts). -
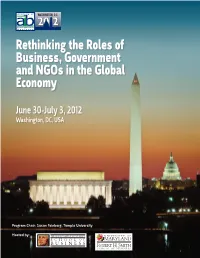
AIB 2012 Conference Program
WASHINGTON, D.C. 20 2 Rethinking the Roles of Business, Government and NGOs in the Global Economy June 30-July 3, 2012 Washington, DC, USA Program Chair: Susan Feinberg, Temple University Hosted by: Table of Contents WELCOMES President’s Letter . 2 Letter from the Program Chair . 3 Letters from the Local Hosts . 6 SPONSORS Conference Sponsors . 8 CONTRIBUTORS 2012 Program Committee .. 9 AIB 2012 Reviewers . 10 AWARDS 2012 Program Awards. 19 AIB President’s Award for International Development . 22 AIB Fellows’ Executive of the Year . 23 AIB Fellows’ Educator of the Year . 24 AIB Fellows’ Eminent Scholar . 25 LOGISTICS When You Arrive . 26 Floor Map . 26 Street Map . 27 PROGRAM AIB 2012 Program Overview . 28 AIB 2012 Detailed Program . 30 Program Contributor Index . 76 EXHIBITORS 2012 Exhibitor Listing . 87 ABOUT AIB AIB Institutional Members . 88 AIB Past Presidents . 89 Past AIB Conference Locations . 89 AIB Fellows . 90 AIB 2013 ISTANBUL AIB 2013 Conference Theme . .. 92 AIB 2012 | Rethinking the Roles of Business, Government and NGOs in the Global Economy 1 AIB President’s Letter Welcome to Washington D .C ., for the Annual Meeting of the Academy of International Business EXECUTIVE BOARD Last year, in Japan, we welcomed what was one of the largest annual AIB conferences ever despite President Mary Ann Von Glinow horrific events preceding our meeting; this year we will surpass those numbers . If size is an indicator Florida International University of membership enthusiasm, then Susan Feinberg and her track chairs have put together an incredible Immediate Past President program on “Rethinking the Roles of Business, Government and NGOs in the Global Economy,” the Yves Doz INSEAD theme of this year’s program . -

Behind the Berlin Wall.Pdf
BEHIND THE BERLIN WALL This page intentionally left blank Behind the Berlin Wall East Germany and the Frontiers of Power PATRICK MAJOR 1 1 Great Clarendon Street, Oxford Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University’s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide in Oxford New York Auckland Cape Town Dar es Salaam Hong Kong Karachi Kuala Lumpur Madrid Melbourne Mexico City Nairobi New Delhi Shanghai Taipei Toronto With offices in Argentina Austria Brazil Chile Czech Republic France Greece Guatemala Hungary Italy Japan Poland Portugal Singapore South Korea Switzerland Thailand Turkey Ukraine Vietnam Oxford is a registered trade mark of Oxford University Press in the UK and in certain other countries Published in the United States by Oxford University Press Inc., New York Patrick Major 2010 The moral rights of the author have been asserted Database right Oxford University Press (maker) First published 2010 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press, or as expressly permitted by law, or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization. Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to the Rights Department, Oxford University Press, at the address above You must not circulate this book in any other binding or cover and you must impose the same condition on any acquirer British Library Cataloguing in Publication Data Data available Library of Congress Cataloging in Publication Data Major, Patrick. -

140 Victims at the Berlin Wall, 1961 – 1989
August 2017 Hans-Hermann Hertle/Maria Nooke 140 Victims at the Berlin Wall, 1961 – 1989 Fugitives who were either shot, suffered a fatal accident or took their own lives at the Berlin Wall between 1961 and 1989; individuals from the East and the West who did not intend to flee but were killed or suffered a fatal accident on the border grounds Name Born Died Circumstances of death 1961 Ida Siekmann 23.08.1902 22.08.1961 Killed in an accident while trying to escape. Günter Litfin 19.01.1937 24.08.1961 Shot dead while trying to escape Roland Hoff 19.03.1934 29.08.1961 Shot dead while trying to escape Rudolf Urban 06.06.1914 17.09.1961 Died as a result of injuries incurred while trying to escape Olga Segler 31.07.1881 26.09.1961 Died as a result of injuries incurred while trying to escape Bernd Lünser 11.03.1939 04.10.1961 Fatally wounded under fire while trying to escape Udo Düllick 03.08.1936 05.10.1961 Drowned under fire while trying to escape Werner Probst 18.06.1936 14.10.1961 Shot dead while trying to escape Lothar Lehmann 28.01.1942 26.11.1961 Drowned while trying to escape Dieter Wohlfahrt 27.05.1941 09.12.1961 Shot as an escape helper while supporting others in their escape attempts Ingo Krüger 31.01.1940 11.12.1961 Drowned while trying to escape Georg Feldhahn 12.08.1941 19.12.1961 Drowned while trying to escape 1962 Dorit Schmiel 25.04.1941 19.02.1962 Shot dead while trying to escape. -

102/210 Bereiche.Indd
bkxxhhdd B 337 At midday on December 6, 1961, Private K. was on duty at Strelitzer Strasse. He stood directly in front West of the Wall. His guard leader was monitoring Strelitzer Strasse, sixty meters away. A screen posi- tioned between them prevented the squad leader from seeing K. when he climbed over the Wall shortly past noon. Private K. had been transferred from the riot police to border duty and was Station: Station: Station: B 331: Protest rally, 1962 B 334: Report on Bernd B.’ escape attempt. critical of the Wall because it sep- The Reconciliation Church The Suffering of the People Escaping to the West arated families. His brother and sister lived in the West. B 331 B 334 B 335 The construction of the Berlin Bernd B. tried to climb over the A family fled from the first floor of B 338 M10 Documentation Center Wall evoked anger and outrage Wall near the Reconciliation the building at Bernauer Strasse Hildegard K. worked as a singer Gedenkstätte among residents on both sides of Berliner Mauer Church on the night of July 7, 1968. 10, probably on August 24, 1961. for East German radio. The reli- Commemorative the city. In West Berlin the ongo- He approached the border strip A couple and their 14-year-old gious mother of four children Berlin Wall Memorial M column for Representation of border houses Bernauer Strasse B 379 Bernauer Strasse Representation ing resentment was specifically from the Elisabeth parish ceme- daughter slid down a rope from risked losing her job because of B 366 Rudolf Urban Representation of the border wall B 372 of border houses expressed by attacks on the for- tery and got past the signal the window. -

Namen, Die Kaum Einer Kennt. Denk´Ich an Polen in Der Nacht
2 1 0 2 R E B O T K O AKADEMISCHE MZeiOtschN riftAdeTsSKaBrteLllveÄrbaTndTesER katholischer deutscher Studenten- AM vereine KV • 124. Jahrgang • Nr. 8 Namen, die kaum einer kennt. Denk´ich an Polen in der Nacht ... Titelthema 228 Hauptausschuss und Vorort 2012/2013 Fuchsentagung 2012 Aktiventag in Marl EDITORIAL Liebe Kartellbrüder, liebe Leserinnen und Leser! Ein Redakteur soll- Außerdem gibt es etwas Erfreuliches mitzuteilen: Der Aktiven - te nicht zu r Schwer - tag, der am 16. September 2012 zum zweiten Mal tagte, hat mut neigen. Den- den Katholischen Studentenverein Markomannia in Münster noch kann ich mich zum Vorort gewählt. Die Redaktion wird alles zu seiner Unter - nicht einer An wand - stützung tun. Heute können wir die aktiven Kartellbrüder, die lung dazu erweh - für das kommende Jahr Mitverantwortung für die Geschicke des ren, wenn ich über Verbandes übernommen haben, schon in Wort und Bild vor - den gerade am 16. stellen. September 2012 zu Ende gegangenen Hauptausschuss nach - Diskussionswürdig ist ein Beitrag dreier Mitglieder des Alther - denke. Was ist passiert? Der KV-Rat hatte den Antrag gestellt, renbundsvorstandes, die vorschlagen, unser Prinzip Religion für das nächste Jahr 20.000 Euro mehr zu bewilligen, damit wir konkreter zu fassen und es stattdessen mit Christentum zu um - die „Akademischen Monatsblätter “ im Jahr ihres 125-jährigen schreiben. Bestehens wieder repräsentativer drucken könnten. Die über - Besonders aufmerksam machen möchte ich überdies auf das wältigende Mehrheit der Aktiven lehnten das ab, ohne dass Geistliche Wort, das sich u.a. mit der Frage befasst, ob AIDS als recht deutlich wurde, warum sie dagegen war. Ich will über die eine Strafe Gottes angesehen werden darf. -

Randauszaehlungbrdkohlband
Gefördert durch: Randauszählungen zu Elitestudien des Fachgebiets Public Management der Universität Kassel Band 21 Die Politisch-Administrative Elite der BRD unter Helmut Kohl (1982 – 1998) Bastian Strobel Simon Scholz-Paulus Stefanie Vedder Sylvia Veit Die Datenerhebung erfolgte im Rahmen des von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien geförderten Forschungsprojektes „Neue Eliten – etabliertes Personal? (Dis-)Kontinuitäten deut- scher Ministerien in Systemtransformationen“. Zitation: Strobel, Bastian/Scholz-Paulus, Simon/Vedder, Stefanie/Veit, Sylvia (2021): Die Poli- tisch-Administrative Elite der BRD unter Helmut Kohl (1982-1998). Randauszählungen zu Elite- studien des Fachgebiets Public Management der Universität Kassel, Band 21. Kassel. DOI: 10.17170/kobra-202102193307. Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ...................................................................................................................................... 1 2 Personenliste ................................................................................................................................ 4 3 Sozialstruktur .............................................................................................................................. 12 4 Bildung ........................................................................................................................................ 16 5 Karriere ....................................................................................................................................... 22 6 Parteipolitisches