Bericht Zur Gewässergüte 2010
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Informationen Zum ADFC Usinger Land
Liebe Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer, Touristinformationen: Usatal-Radweg Usingen, die alte Residenz- und Kreisstadt im Buch- Bei der Suche nach einer passenden Unterkunft oder Ein weiterer empfehlenswerter Fahrradweg ist der Usatal- finkenland, liegt inmitten des schönen Taunus. Gastronomie helfen wir Ihnen gerne! Radweg. Dieser ist die Ost-West-Verbindung zwischen Wetterau und Taunus. Vom Weiltalweg bei Schmitten- Rund um Usingen bietet die Landschaft für Besucher Stadt Usingen Brombach bis zur Nidda bei Niddatal-Assenheim führt der einiges zu entdecken. Aus diesem Grund hat die Wilhelmjstr. 1 Usatalradweg. Auf rund 45 Kilometern begleitet der Weg das 61250 Usingen Flüsschen Usa von der Quelle zwischen Neu-Anspach und Stadt auf Anregung und in Zusammenarbeit mit dem Tel. (06081) 1024-0 dem Weiltal bis an seine Mündung in die Wetter und weiter ADFC Usinger Land eine Fahrradroute rund um die Fax: (06081) 1024-9033 zum Anschluss an die Nidda mit dem Niddauferweg und Buchfinkenstadt zusammengestellt. [email protected] dem hier verlaufenden Hessischen Radfernweg R4. www.usingen.de www.adfc-hochtaunus.de Auf der ca. 37 km langen beschilderten Strecke Usinger Becken oder für den gesamten Taunus: besteht die Möglichkeit, Abstecher zu verschiedenen Taunus Touristik Service e. V. Sehenswürdigkeiten zu machen. So ist beispielsweise Naturpark Hochtaunus Taunus-Informationszentrum ein Stopp am Hattsteinweiher, den Eschbacher Hohemarkstraße 192 Der Naturpark Hochtaunus ist der zweitgrößte Naturpark 61440 Oberursel (Taunus) Klippen oder ein Rundgang durch die historische Hessens. Ziel ist es, dem Besucher die Schönheit des Taunus Altstadt Usingens eine schöne Ergänzung. Telefon: (06171) 507 80 umweltverträglich zugänglich zu machen. Es gibt zahlreiche Telefax: (06171) 507 81 5 Die Stadt Usingen wünscht Ihnen eine gute und Angebote zur Erholung und für sportliche Aktivitäten. -

Beteiligungsbericht 2017
MAIN-KINZIG-KREIS Beteiligungsbericht 2017 ® Aleksei Vasileika/123rf.com Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises Beteiligungsbericht 2017 Seit e 1 Main-Kinzig-Kreis IMPRESSUM Herausgeber: Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises Barbarossastraße 16 - 24 63571 Gelnhausen Telefon 06051/85-0 Ansprechpartner: Referat 6 - Beteiligungsmanagement (Jochen Hemmer) Druck: Main-Kinzig-Kreis, Hausdruckerei Stand: 15. Oktober 2018 Beteiligungsbericht 2017 Seit e 2 Main-Kinzig-Kreis VORWORT Sehr geehrte Leserinnen und Leser, vermutlich ist Ihnen häufig gar nicht bewusst, wie viele Leistungen der Main-Kinzig-Kreis über seine Unternehmen und Beteiligungen im Alltagsleben der Bürger erbringt. Ob es der Besuch eines Englischkurses in der Volkshochschule, der Aufenthalt im Krankenhaus, der schnelle Internetzugang oder auch die wohnortnahe Unterbringung von pflegebedürftigen Menschen in einem Seniorenzentrum ist, überall stehen häufig Unternehmen des Main-Kinzig-Kreises dahinter. Über 4.100 Mitarbeiter machen es sich täglich zum Ziel, die Einwohner des Main-Kinzig-Kreises mit Produkten und Dienstleistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge sicher und möglichst wirtschaftlich zu versorgen. Mitunter auch dort, wo es für private Unternehmen wirtschaftlich nicht attraktiv ist, wichtige Leistungen für eine gute Infrastruktur anzubieten. Einen sichtbaren Beleg hierfür stellt die Strategie „Gesunde Kliniken 2020“ der Main-Kinzig-Kliniken dar. Nach Fertigstellung des Erweiterungsneubaus der Kinder- und Frauenklinik in 2017, konnte im August 2018 das Richtfest für das größte Bauvorhaben, der Erweiterungsneubau des Hauptgebäudes Haus A mit 6.500 qm zusätzlicher Fläche, gefeiert werden. Im Bereich der Bildung bietet der Bildungspartner Main-Kinzig mit dem Projektstart des Alpha mobil MKK gezielte Maßnahmen für Menschen mit funktionalem Analphabetismus. Dies ist immer noch ein Tabuthema in der Gesellschaft, stellt die betroffenen Menschen aber durch die zunehmende Digitalisierung vor immer größere Herausforderungen. -

Das Usinger Becken Und Seine Randgebiete*). Von Theodor Geisel, Usingen Im Taunus
download unter www.zobodat.at Das Usinger Becken und seine Randgebiete*). Von Theodor Geisel, Usingen im Taunus. Inhaltsübersicht. Gliederung und Relief. Der geologische Bau und der Boden Die Formen der Landschaft Die hohen TJsaterrassen Die Rumpffläche Die Beckenwasserscheide und die Wehrheimer Mulde Die diluvialen Gehänge- und Sohlenterrassen und die alluvialen Formen Die klimatischen Verhältnisse Die Gewässer Die Pflanzen- und Tierwelt Das Werden der Kulturlandschaft in Vorgeschichte und Römerzeit in Mittelalter und Neuzeit Die Kulturlandschaft der Gegenwart Die Form und Lage der Siedlungen Die Bodennutzung Intensität der Bewirtschaftung und Flurverhältnisse Anbauverhältnisse Wiesenbau und Viehhaltung Obstbau F orstwirtschaf t Das Gewerbe Der Verkehr Die wirtschaftlichen Siedhmgstypen und die Berufsgliederung der Bevölkerung Die Volkszahl und Volksdichte *) Diese Arbeit erscheint als geographische Dissertation der Hohen Phi losophischen Fakultät der Universität Köln. download unter www.zobodat.at 81 Gliederung und Relief. Das Usinger Becken liegt im nordöstlichen Taunus und ist damit ein Ausschnitt aus dem Rheinischen Schiefergebirge. Als Senke, deren Längsachse in der Streichrichtung des Gebirges nordostwärts verläuft, gruppiert sich das Becken um das Tal der oberen und mittleren Usa, die als einziges Flüßchen in der Längsrichtung des Taunus nach NO entwässert. Im Südtaunus verläuft nur noch das Wispertal in der Streichrichtung des Gebirges nach SW. Während allerdings das Wisper tal eine Folge von tief eingesenkten Mäandern darstellt, ist das Usatal breit und muldenförmig. Zur Usinger Beckenlandschaft im weiteren Sinne gehört noch das Erlenbachtal von der Quelle bis zum Austritt aus dem Gebirge. Die Durchbruchsstrecke, das Köpperner Tal, liegt bereits im Beckenrand. Beide Teile des Gesamtbeckens werden durch die Beckenwasserscheide voneinander getrennt. Diese zieht sich, zunächst im S in der Streich richtung, weiter nördlich dann quer zu ihr durch das Gesamtbecken. -

Jeder Treu Auf Seinem Posten: German Catholics
JEDER TREU AUF SEINEM POSTEN: GERMAN CATHOLICS AND KULTURKAMPF PROTESTS by Jennifer Marie Wunn (Under the Direction of Laura Mason) ABSTRACT The Kulturkampf which erupted in the wake of Germany’s unification touched Catholics’ lives in multiple ways. Far more than just a power struggle between the Catholic Church and the new German state, the conflict became a true “struggle for culture” that reached into remote villages, affecting Catholic men, women, and children, regardless of their age, gender, or social standing, as the state arrested clerics and liberal, Protestant polemicists castigated Catholics as ignorant, anti-modern, effeminate minions of the clerical hierarchy. In response to this assault on their faith, most Catholics defended their Church and clerics; however, Catholic reactions to anti- clerical legislation were neither uniform nor clerically-controlled. Instead, Catholics’ Kulturkampf activism took many different forms, highlighting both individual Catholics’ personal agency in deciding if, when, and how to take part in the struggle as well as the diverse factors that motivated, shaped, and constrained their activism. Catholics resisted anti-clerical legislation in ways that reflected their personal lived experience; attending to the distinctions between men’s and women’s activism or those between older and younger Catholics’ participation highlights individuals’ different social and communal roles and the diverse ways in which they experienced and negotiated the dramatic transformations the new nation underwent in its first decade of existence. Investigating the patterns and distinctions in Catholics’ Kulturkampf activism illustrates how Catholics understood the Church-State conflict, making clear what various groups within the Catholic community felt was at stake in the struggle, as well as how external factors such as the hegemonic contemporary discourses surrounding gender roles, class status, age and social roles, the division of public and private, and the feminization of religion influenced their activism. -

Zum Vorkommen Der Fluss-Kugelmuschel Sphaerium Rivicola (LAMARCK 1818) in Darmstadt Mit Anmerkungen Zum Bestandsrückgang Von Sphaerium Corneum (LINNAEUS 1758)
29 Mitt. dtsch. malakozool. Ges. 96 29 – 32 Frankfurt a. M., Januar 2017 Zum Vorkommen der Fluss-Kugelmuschel Sphaerium rivicola (LAMARCK 1818) in Darmstadt mit Anmerkungen zum Bestandsrückgang von Sphaerium corneum (LINNAEUS 1758) HASKO F. NESEMANN Abstract: The River orb mussel Sphaerium rivicola (LAMARCK 1818) is recorded for the first time in Darmstadt from a small stream feeding several fish ponds. The rapid decline of S. rivicola and S. corneum (O. F. MÜLLER 1774) during the last decades is mentioned. Keywords: Sphaerium rivicola new record, S. corneum, rapid decline, Hesse. Zusammenfassung: Die Flusskugelmuschel Sphaerium rivicola (LAMARCK 1818) wurde neu für Darmstadt in einem sehr kleinen Fließgewässer nachgewiesen, das eine Kette von Teichen speist. Auf den raschen Bestands- rückgang von S. rivicola und S. corneum (O. F. MÜLLER 1774) in den letzten Jahrzehnten wird hingewiesen. Einleitung Die bekannte Verbreitung der Fluss-Kugelmuschel Sphaerium rivicola (LAMARCK 1818) in Hessen war auf die größeren Ströme und Flüsse Rhein, Main, Neckar, Lahn, Fulda und Werra begrenzt (KO- BELT 1871, JUNGBLUTH 1978). Die Art ist durch ihre Adultgröße und Gehäusemerkmale eindeutig von den anderen Arten der Gattung unterschieden (ZETTLER & GLÖER 2006). Unsichere Fundangaben sind dennoch verbreitet in der Literatur zu finden, weil junge und halbwüchsige S. rivicola häufig nicht erkannt und als S. corneum (LINNAEUS 1758) bestimmt bzw. besonders große „Mastformen“ der letzteren wegen ihrer Dimensionen mit S. rivicola verwechselt wurden. Bestandsentwicklung von Sphaerium rivicola in Südhessen In jüngster Vergangenheit haben die Bestände von S. rivicola in den südhessischen Flüssen trotz ver- besserter Wasserqualität stark abgenommen (NESEMANN 1984, 2014). Es kann ein direkter Zusam- menhang mit der explosiven Ausbreitung und Vermehrung der neozoischen Körbchenmuschel Corbi- cula fluminea (O. -

The German-American Family of Johann Klesen (1857–1933)
Maria Besse/Nathalie Besse/ Thomas Besse/Johannes Naumann The German-American Family of Johann Klesen (1857–1933) Verein für Heimatgeschichte Thalexweiler e.V. Historischer Verein zur Erforschung des Schaumberger Landes – Tholey e.V. Maria Besse/Nathalie Besse/Thomas Besse/Johannes Naumann: The German-American Family of Johann Klesen (1857–1933) Maria Besse/Nathalie Besse/ Thomas Besse/Johannes Naumann The German-American Family of Johann Klesen (1857–1933) Authors: Professor Dr. Maria Besse, Dr. Nathalie Besse, Thomas Besse, and Johannes Naumann Publisher and Marketing: Verein für Heimatgeschichte Thalexweiler (Historical Society Thalexweiler) Thomas Besse Tannenweg 21 D-66292 Riegelsberg, Saarland/Germany [email protected] http://www.besse.de and Historischer Verein zur Erforschung des Schaum- berger Landes (Historical Society Tholey) Theulegium Museum Rathausplatz 6 D-66636 Tholey, Saarland/Germany Internet: www.theulegium.de Book design, composition and photographic works: Thomas Besse, Riegelsberg/Germany Copyright © 2017 by Thomas Besse All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form without prior permission in writing of the authors. Print: Publishing company Pirrot Saarbrücken, Trierer Straße 7, 66125 Saar- brücken-Dudweiler/Germany (http://www.pirrot.de) ISBN 978-3-937436-60-9 Saarbrücken/Germany 2017 Contents Page Foreword ....................................................................................................................... 6 1 Introduction ................................................................................................................ -

Bad Homburger Woche Sucht Universität Frankfurt Kooperierenden Islami- Grundschulen Vorhanden Sind
BaBadd HoHommburgerburger Wöchentlich erscheinende unabhängige Lokalzeitung für die Stadt Bad Homburg mit den Stadtteilen Dornholzhausen, Gonzenheim, Kirdorf, Ober-Eschbach und Ober-Erlenbach sowie die Stadt Friedrichsdorf mit den Stadtteilen Friedrichsdorf, Burgholzhausen, Köppern und Seulberg. Erfahren Sie den aktuellen Marktwert Ihrer Immobilie – kostenfrei und diskret. Auflage: 40.200 Exemplare WoWochchee Tel: 06172 - 680 980 Herausgegeben vom Hochtaunus Verlag GmbH · Vorstadt 20 · 61440 Oberursel · Telefon 06171/62 88 -0 · Telefax 06171/62 88 -19 21. Jahrgang Mittwoch, 4. Mai 2016 Kalenderwoche 18 Dicht an dicht und mit hohem Tempo fuhren Profis und Amateure an den ab Mittag dicht gedrängten Zuschauern vor dem Homburger Kurhaus die Louisenstraße hoch. Foto: fch Mit hohem Tempo Richtung Ziel Bad Homburg (fch). Homburger polizei verstärkt von wenigen gut eingemum- haus die U23-Fahrer. Die 161 Radprofis hat- Radrenntage sind lang. Erst fangen melten Bürgern. ten seit dem Start in Eschborn bereits 37 Ki- sie ganz langsam an, aber dann, aber Vor den Radrennfahrern und dem Ziel lag lometer bis nach Bad Homburg zurückgelegt. dann. Der abgewandelte Songtext noch der steile Mammolshainer Berg. Den Sie sausten mit einer Geschwindigkeit von bis der „Kreuzberger Nächte“ von den frühen Radsport-Fans heizte die mit Bad zu 60 Kilometern pro Stunde innerhalb einer Hochwertige Damenoberbekleidung Gebrüdern Blattschuss traf voll und Homburger und Oberurseler Musikern besetz- guten Minute an den applaudierenden Rad- mit Anspruch und Stil te Band „Voll Daneben“ mit Hits wie „Sharp sportfans vorbei. Bis zum Ziel lagen noch Louisenstraße 60 im Kurhaus von Bad Homburg ganz auf das Publikumsinteresse beim dressed man“ oder „Kayleigh“ von Marillion 169,8 Kilometer vor ihnen. -

Hochwasserrisikomanagementpl
Regierungspräsidium Darmstadt Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden Dezernat 41.2 Hochwasserrisikomanagementplan für das Einzugsgebiet Sulzbach / Liederbach Strategische Umweltprüfung Umweltbericht Stand: Dezember 2014 Bildquelle: http://www.liederbach.eu/ Bearbeitet durch: Fugro Consult GmbH Im Auftrag des Landes Hessen Vertreten durch das: Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden Hochwasserrisikomanagementplan Sulzbach/Liederbach - Umweltbericht Inhaltsverzeichnis 1 EINLEITUNG ...................................................................................................................................... 9 2 GEGENSTAND DES HOCHWASSERRISIKOMANAGEMENTPLANS SULZBACH/LIEDERBACH .............................................................................................................. 10 2.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Hochwasserrisikomanagementplans Sulzbach/Liederbach ......................................................................................................................... 10 2.2 Räumlicher Geltungsbereich und Festlegung der Hochwasserbrennpunkte ................................... 12 2.3 Beschreibung der Flächennutzungen in den Überschwemmungsgebieten von Sulzbach/Liederbach .......................................................................................................................................................... 13 2.4 Betroffene Einwohner ....................................................................................................................... -

21St TSC to Get New Commander Thursday by Angelika Lantz the Commanding General of the U.S
August 14, 2009 HAVE YOU READ YOUR KA TODAY? Volume 33, number 32 Allied Strike preps JTACs to put bombs on target by Airman 1st Class Alexandria Mosness Ramstein Public Affairs GRAFENWÖHR, Germany — Air Force, U.S. Marine Corps and NATO joint terminal attack control- lers and tactical air control party members joined together Aug. 2 to 7 in Grafenwöhr, Germany, to partici- pate in an exercise known as Allied Strike IV. Known as JTACs, their primary duty is to direct combat aircraft onto enemy targets. They are qualifi ed and recognized to provide close air support to units in which they are attached. Put on by the 4th Air Support Operations Group out of Heidelberg, Germany, the exercise was designed to prepare JTACs for upcoming deployments in support of Operation Enduring Freedom. The 4th ASOG’s battlefi eld Airmen recently became a part of one of the Air Force’s new- Photo by Sta Sgt. Jocelyn Rich est wings – the 435th Air Ground Airman 1st Class Matthew Aguirre, a Tactical Air Control Party, ROMAD, from the 1st Air Support Operations Squadron, secures the position of his teammates during Allied Strike IV Aug. 3 in Grafenwöhr, Germany. Allied Strike is a multi-service, multi-national exercise that presents See STRIKE, Page 8 realistic scenarios for participants to hone their skills before deploying. 21st TSC to get new commander Thursday by Angelika Lantz the commanding general of the U.S. Army TSC from the Defense Supply Center Columbus 21st TSC Public Affairs Sustainment Command in Rock Island, Ill. The headquartered in Columbus, Ohio. -

Ahsgramerican Historical Society of Germans from Russia
AHSGR American Historical Society of Germans From Russia German Origins Project Legend: BV=a German village near the Black Sea . FN= German family name. FSL= First Settlers’ List. GL= a locality in the Germanies. GS= one of the German states. ML= Marriage List. RN= the name of a researcher who has verified one or more German origins. UC= unconfirmed. VV= a German Volga village. A word in bold indicates there is another entry regarding that word or phrase. Click on the bold word or phrase to go to that other entry. Red text calls attention to information for which verification is completed or well underway. Push the back button on your browser to return to the Germanic Origins Project home page. Oa-Ozz updated Jan 2015 Obelies(?)GL, Ridelsch(?): an unidentified place said by the Dobrinka FSL to be homeUC to a Kaltenschnee family. This might be Ober Lais? which is some 8 miles WNW of Mauswinkel. ObenauerFN: listed by the Bergdorf 1816 census (KS:661, 388, 664) without origin and with a Fischer pseudonym. Origin in Nieder-Floersheim, Worms [Amt], Hesse was proven by the GCRA using FHL(1,475,714). See their book for more details. ObenauerFN: Curt Renz has found the church records for this Hoffnungstal, Bessarabia, family in Niederfloersheim, Worms Kreis, Hesse. Obendoerfer FN: see Obendoerfer. Oberaltenbernheim, Kaestel?: is 8.5 km SE of Bad-Windsheim and said by the Warenburg FSL to be homeUC to a Stroemer family. OberaltertheimGL, [Castell County]: is some 9 miles SW of Wuerzburg city, and said by the Lauwe FSL to be homeUC to Schatz and possibly Kerner families. -
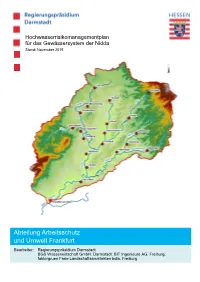
HWRM-Nidda-Langfassung.Pdf
Hochwasserrisikomanagementplan für das Gewässersystem der Nidda Stand: November 2015 Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt Bearbeiter: Regierungspräsidium Darmstadt BGS Wasserwirtschaft GmbH, Darmstadt; BIT Ingenieure AG, Freiburg, faktorgruen Freie Landschaftsarchitekten bdla, Freiburg Bearbeiter: Brandt Gerdes Sitzmann Wasserwirtschaft GmbH Pfungstädter Straße 20 64297 Darmstadt Internet: www.bgswasser.de Tel.: +49 (0)6151 9453-0 Fax: +49 (0)6151 9453-80 BIT Ingenieure AG Talstraße1 79102 Freiburg Internet: http://www.bit-ingenieure.de Tel.: +49 (0)761 29657-0 Fax: +49 (0)761 29657-11 faktorgruen Freie Landschaftsarchitekten BDLA Merzhauser Straße 110 79100 Freiburg Internet: www.faktorgruen.de Tel.: +49 (0)761 707647-0 Fax: +49 (0)761 707647-50 Regierungspräsidium Darmstadt Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt Dezernat IV/F 41.2 - Oberflächengewässer Gutleutstraße 114 60327 Frankfurt am Main Internet: www.rp-darmstadt.hessen.de Tel.: +49 (0)69 2714-0 Fax: +49 (0)69 2714-5950 Hochwasserrisikomanagementplan Nidda Der Hochwasserrisikomanagementplan für das Gewässersystem der Nidda, nachfolgend vereinfachend als Hochwasserrisikomanagementplan Nidda bezeichnet, umfasst das gesamte Einzugsgebiet der Nidda mit der Nidda als Hauptge- wässer inklusive der Nebengewässer Nidder, Seemenbach, Wetter, Usa und Horloff. Der Hochwasserrisikomanagementplan Nidda ist wie folgt dokumentiert: Mappe 1: Textunterlagen - Hochwasserrisikomanagementplan - Maßnahmensteckbrief - Umweltbericht Mappe 2: Planunterlagen - Übersicht Projektgebiet - -

Abteilung Arbeitsschutz Und Umwelt Frankfurt
Hochwasserrisikomanagementplan für das Gewässersystem der Nidda - Kurzfassung - Stand: November 2015 Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt Bearbeiter: Regierungspräsidium Darmstadt BGS Wasserwirtschaft GmbH, Darmstadt; BIT Ingenieure AG, Freiburg, faktorgruen Freie Landschaftsarchitekten bdla, Freiburg Bearbeiter: Brandt Gerdes Sitzmann Wasserwirtschaft GmbH Pfungstädter Straße 20 64297 Darmstadt Internet: www.bgswasser.de Tel.: +49 (0)6151 9453-0 Fax: +49 (0)6151 9453-80 BIT Ingenieure AG Talstraße1 79102 Freiburg Internet: http://www.bit-ingenieure.de Tel.: +49 (0)761 29657-0 Fax: +49 (0)761 29657-11 faktorgruen Freie Landschaftsarchitekten BDLA Merzhauser Straße 110 79100 Freiburg Internet: www.faktorgruen.de Tel.: +49 (0)761 707647-0 Fax: +49 (0)761 707647-50 Regierungspräsidium Darmstadt Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt Dezernat IV/F 41.2 - Oberflächengewässer Gutleutstraße 114 60327 Frankfurt am Main Internet: www.rp-darmstadt.hessen.de Tel.: +49 (0)69 2714-0 Fax: +49 (0)69 2714-5950 Hochwasserrisikomanagementplan Nidda – Kurzfassung Der Hochwasserrisikomanagementplan für das Gewässersystem der Nidda, nachfolgend vereinfachend als Hochwasserrisikomanagementplan Nidda bezeichnet, umfasst das gesamte Einzugsgebiet der Nidda mit der Nidda als Hauptge- wässer inklusive der Nebengewässer Nidder, Seemenbach, Wetter, Usa und Horloff. Der Hochwasserrisikomanagementplan Nidda ist wie folgt dokumentiert: Mappe 1: Textunterlagen - Hochwasserrisikomanagementplan - Maßnahmensteckbrief - Umweltbericht Mappe 2: Planunterlagen