Bearbeitungsgebiet Main Bericht Zur Bestandsaufnahme
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Beteiligungsbericht 2017
MAIN-KINZIG-KREIS Beteiligungsbericht 2017 ® Aleksei Vasileika/123rf.com Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises Beteiligungsbericht 2017 Seit e 1 Main-Kinzig-Kreis IMPRESSUM Herausgeber: Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises Barbarossastraße 16 - 24 63571 Gelnhausen Telefon 06051/85-0 Ansprechpartner: Referat 6 - Beteiligungsmanagement (Jochen Hemmer) Druck: Main-Kinzig-Kreis, Hausdruckerei Stand: 15. Oktober 2018 Beteiligungsbericht 2017 Seit e 2 Main-Kinzig-Kreis VORWORT Sehr geehrte Leserinnen und Leser, vermutlich ist Ihnen häufig gar nicht bewusst, wie viele Leistungen der Main-Kinzig-Kreis über seine Unternehmen und Beteiligungen im Alltagsleben der Bürger erbringt. Ob es der Besuch eines Englischkurses in der Volkshochschule, der Aufenthalt im Krankenhaus, der schnelle Internetzugang oder auch die wohnortnahe Unterbringung von pflegebedürftigen Menschen in einem Seniorenzentrum ist, überall stehen häufig Unternehmen des Main-Kinzig-Kreises dahinter. Über 4.100 Mitarbeiter machen es sich täglich zum Ziel, die Einwohner des Main-Kinzig-Kreises mit Produkten und Dienstleistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge sicher und möglichst wirtschaftlich zu versorgen. Mitunter auch dort, wo es für private Unternehmen wirtschaftlich nicht attraktiv ist, wichtige Leistungen für eine gute Infrastruktur anzubieten. Einen sichtbaren Beleg hierfür stellt die Strategie „Gesunde Kliniken 2020“ der Main-Kinzig-Kliniken dar. Nach Fertigstellung des Erweiterungsneubaus der Kinder- und Frauenklinik in 2017, konnte im August 2018 das Richtfest für das größte Bauvorhaben, der Erweiterungsneubau des Hauptgebäudes Haus A mit 6.500 qm zusätzlicher Fläche, gefeiert werden. Im Bereich der Bildung bietet der Bildungspartner Main-Kinzig mit dem Projektstart des Alpha mobil MKK gezielte Maßnahmen für Menschen mit funktionalem Analphabetismus. Dies ist immer noch ein Tabuthema in der Gesellschaft, stellt die betroffenen Menschen aber durch die zunehmende Digitalisierung vor immer größere Herausforderungen. -

Anlage 5 Tabellen Der Natura 2000-Gebiete, Die Mit Ihrem Größeren Flächenanteil in Einem Der Nachbarregierungsbezirke Liegen
Anlage 5 Tabellen der Natura 2000-Gebiete, die mit ihrem größeren Flächenanteil in einem der Nachbarregierungsbezirke liegen und daher in der dortigen Natura 2000-Verordnung gesichert werden. Sie sind in dieser Anlage nur nachrichtlich aufgeführt und in der Übersichtskarte (Anlage 2) zu dieser Verordnung nur nachrichtlich mit dünner blauer Schraffur dargestellt oder bei sehr schmalen linienhaften Fließgewässergebieten mit einem textli- chen Hinweis in der Karte „Rechtliche Sicherung durch das benannte Nachbarregierungspräsidium“ versehen. Tabelle der RP-übergreifenden FFH-Gebiete mit dem größten Flächenanteil im Regierungsbezirk Darmstadt, die in der Übersichtkarte dieser Verord- nung mit dünner blauer Schraffur und Natura-Nummer nachrichtlich dargestellt werden NATURA_NR NAME HA REG_BEZ KREIS GEMEINDE 5518-301 Salzwiesen von Münzenberg 64.20 Darmstadt, Wetteraukreis, Gießen, Münzenberg, Lich Gießen 5520-302 Talauen von Nidder und Hillersbach 253,90 Darmstadt, Wetteraukreis, Vogelsbergkreis Gedern, Schotten bei Gedern und Burkhards Gießen 5520-306 Waldgebiete südlich und südwestlich 1680,60 Darmstadt, Wetteraukreis, Vogelsbergkreis Hirzenhain, Nidda, Schot- von Schotten Gießen ten 5622-310 Steinaubachtal und Ürzeller Wasser 45,30 Darmstadt, Main-Kinzig-Kreis, Vogelsbergkreis Steinau an der Straße, Gießen Schlüchtern, Freiensteinau Tabelle der RP-übergreifenden schmalen linienhaften Fließgewässer-FFH-Gebiete mit dem größten Flächenanteil im Regierungsbezirk Darmstadt, die in der Übersichtkarte dieser Verordnung mit dem textlichen Hinweis -

Zum Vorkommen Der Fluss-Kugelmuschel Sphaerium Rivicola (LAMARCK 1818) in Darmstadt Mit Anmerkungen Zum Bestandsrückgang Von Sphaerium Corneum (LINNAEUS 1758)
29 Mitt. dtsch. malakozool. Ges. 96 29 – 32 Frankfurt a. M., Januar 2017 Zum Vorkommen der Fluss-Kugelmuschel Sphaerium rivicola (LAMARCK 1818) in Darmstadt mit Anmerkungen zum Bestandsrückgang von Sphaerium corneum (LINNAEUS 1758) HASKO F. NESEMANN Abstract: The River orb mussel Sphaerium rivicola (LAMARCK 1818) is recorded for the first time in Darmstadt from a small stream feeding several fish ponds. The rapid decline of S. rivicola and S. corneum (O. F. MÜLLER 1774) during the last decades is mentioned. Keywords: Sphaerium rivicola new record, S. corneum, rapid decline, Hesse. Zusammenfassung: Die Flusskugelmuschel Sphaerium rivicola (LAMARCK 1818) wurde neu für Darmstadt in einem sehr kleinen Fließgewässer nachgewiesen, das eine Kette von Teichen speist. Auf den raschen Bestands- rückgang von S. rivicola und S. corneum (O. F. MÜLLER 1774) in den letzten Jahrzehnten wird hingewiesen. Einleitung Die bekannte Verbreitung der Fluss-Kugelmuschel Sphaerium rivicola (LAMARCK 1818) in Hessen war auf die größeren Ströme und Flüsse Rhein, Main, Neckar, Lahn, Fulda und Werra begrenzt (KO- BELT 1871, JUNGBLUTH 1978). Die Art ist durch ihre Adultgröße und Gehäusemerkmale eindeutig von den anderen Arten der Gattung unterschieden (ZETTLER & GLÖER 2006). Unsichere Fundangaben sind dennoch verbreitet in der Literatur zu finden, weil junge und halbwüchsige S. rivicola häufig nicht erkannt und als S. corneum (LINNAEUS 1758) bestimmt bzw. besonders große „Mastformen“ der letzteren wegen ihrer Dimensionen mit S. rivicola verwechselt wurden. Bestandsentwicklung von Sphaerium rivicola in Südhessen In jüngster Vergangenheit haben die Bestände von S. rivicola in den südhessischen Flüssen trotz ver- besserter Wasserqualität stark abgenommen (NESEMANN 1984, 2014). Es kann ein direkter Zusam- menhang mit der explosiven Ausbreitung und Vermehrung der neozoischen Körbchenmuschel Corbi- cula fluminea (O. -

WANDERWELT Tourenvorschläge
WANDERWELT Tourenvorschläge JETZT: mit NEUEN Premiumwegen! VOGELSBERG Hessen www.vogelsberg-touristik.de 02|03 VULKANREGION VOGELSBERG … auf neuen Wegen INHALTSVERZEICHNIS 04 | 11 Vulkanring Vogelsberg 12 | 17 Wander-Gastgeber und Pauschalen 18 Premiumwege ExtraTouren Vogelsberg 19 Höhenrundweg Hoherodskopf 20 | 21 Bergmähwiesenpfad 22 | 23 Drei-SeenTour Freiensteinau 24 | 25 SchächerbachTour Homberg (Ohm) 26 | 27 StauseeTour Eschenrod 28 | 29 NaturTour Nidda 30 | 31 BachTour Lauterbach 32 | 33 GipfelTour Schotten 34 | 35 FelsenTour Herbstein 36 | 37 WeitblickTour Ulrichstein 38 | 39 HeinzemannTour Gemünden 40 | 41 WiesenTour Lauterbach Geotouren Vogelsberg 42 Geführte Geotouren 43 Geopark Vulkanregion Vogelsberg 44 Amanaburch-Tour 45 Geotour Felsenmeer 46 Zeitpfad Wartenberg 47 Erzweg Süd 48 | 49 Eisenpfad Gedern 50 Spur der Natur mit geol. Baumhecke 51 Erlebnispfad: Geopfad Themenwege Naturerlebnis Marburg Homberg/ Alsfeld Wandern auf dem Vulkan Ohm Fulda 52 | 53 Erlebnispfade ab Hoherodskopf Schlitz 54 | 55 Schäfer- und Magerrasenroute Lauterbach Lahn REGION Der Vogelsberg ist ein Vulkangebirge, genau genommen ein Vulkanfeld mit ungemeiner Mächtigkeit Gießen Grünberg Ulrichstein 56 Auf Schäfers Spuren und 60 km Durchmesser. Immer wieder ergossen sich Lavamassen aus Schloten und Spalten über die Herbstein Fulda 57 Bismarcksteinrunde Schotten Erde. Das war in der Zeit vor 15 bis 18 Millionen Jahren. Laubach 58 | 59 Berchtaweg Hungen Grebenhain Regionale Touren Viele Schichten sind bereits verwittert. Erosion und Wasser formten das Mittelgebirge, auf dem sich Wetter Nidda Freiensteinau Gedern VOGELSBERG 60 Zum Kirchlein Fraurombach die Natur so herrlich breit machen konnte. Der waldreiche Hohe Vogelsberg mit Gipfeln über 700 Friedberg Büdingen Birstein 61 Y-Tour Büdingen Meter ist umgeben von einer parkartigen Landschaft mit Hecken, Lesesteinwällen, Weiden und Seen, Nidda Wächtersbach 62 Antrifttal Rundweg sodass auf den Wanderwegen immer wieder Weitsichten begeistern. -

Abschied Baureihe
Fotoausstellung Abschied von der Baureihe 218 24 April bis 5. Oktober 2015 im Modellbahnhof Glauburg-Stockheim Bahnhofstr. 51 63695 Glauburg-Stockheim MoBa-Klein [email protected] VERKEHRSFREUNDE STUTTGART E.V. Abschied von der BR 218 Kapitel 1 Tafel T 1 Die Technik der Baureihe V 160 Die Lokomotiven der Baureihe 218 sind das zuletzt entwickelte Mitglied der V-160 - Lokfamilie. In ihr wurden die viele Gemeinsamkeiten aufweisenden Entwicklungen der Baureihen V 160 bis V 169 (spätere 215 bis 219) zusammengefasst. Bei der 218 wurden von der Baureihe 217 die elektrische Zugheizung übernommen, von den Prototypen der Baureihe 215 übernahm man den 1840-kW-Motor (2500 PS), der einen Hilfsmotor zum Betrieb des Heizgenerators überflüssig machte. Die BR 218 ist somit auch die letzte Baureihe aus der 160er Großdiesellokserie die noch im Plandienst im Einsatz ist. Doch auch ihre Einsätze sind drastisch zurückgegangen. So verlor sie alle Leistungen in Niedersachsen (Regionalexpress Hannover - Bad Harzburg) und in Hessen (Niddertalbahn Stockheim - Frankfurt/Main). Auch der Sylt- Shuttle soll 2015 auf BR 245 umgestellt werden. Bild T 1-1: Die erste Serie der Baureihe 218 war in purpurrot (RAL 3004) lackiert. In den 1980er Jahren gönnte die Deutsche Bundesbahn sich noch den Luxus Zierleisten in verchromter Ausführung anzubringen. Aufnahme Klaus Apprich, 1980er Jahre Aufnahmeort unbekannt. Sammlung Rainer Vogler. Bild T 1-2: In den 1980er Jahren folgte die Lackierung in Ozeanblau/Beige. 218 475-2 rangiert im Münchner Hauptbahnhof. Unterhalb des Fensters von Führerstand 2 klebt das offizielle Plakat der DB zur Hundertfünfzigjahrfeier der Deutschen Eisenbahn. Aufnahme: Harald Klein, 05. Mai 1985. -

Elisabeth Johann Archivarin Und Heimatforscherin Aus Leidenschaft
Altenstädter Porträt Elisabeth Johann Archivarin und Heimatforscherin aus Leidenschaft Altenstadt 2014 2 Angela Vogel, Elisabeth Johann: Archivarin und Heimatforscherin aus Leidenschaft, Altenstadt, 20. Mai 2014 Archivarin und Heimatforscherin aus Leidenschaft Elisabeth Johann zum 90zigsten Geburtstag Wer kennt ihn in Altenstadt nicht, den alten ehemals blaugrauen Renault. Samstags ist er gelegentlich noch zu Einkaufszeiten zu beobachten. Und wer kennt sie nicht, die Fahrerin des blauen Renaults 4? Es ist Elisabeth Johann, hoch betagte Pensionärin und immer noch Archivarin des Archivs der Gemeinde Altenstadt – wenn auch nur noch hilfsweise. Das alte Schulhaus in Höchst Noch vor wenigen Monaten, am Abend des achten November 2013, hielt sie einen bewegenden Vortrag am Mahnmal für die vertriebenen und ermordeten jüdischen Altenstädter. Sie erinnerte daran, wie perfide die Nazis und deren AnhängerInnen Deutsche jüdischen Glaubens oder solche, die sie mit wenigen Federstrichen dazu gemacht hatten, mit Verordnung um Verordnung, Gesetz um Gesetz, Schritt für Schritt erst entrechteten, dann enteigneten, ihnen nahezu alle Existenzgrundlagen nahmen und schließlich mit Hilfe unendlich vieler MittäterInnen und Miethir- nen in die KZ-Mordmaschine trieben. Elisabeth Johann lebt seit 1965 in Altenstadt Höchst. Dort bewohnt sie das alte Höchster Schulhaus, zunächst mit ihrem Mann Wilhelm und ihren vier Kindern. Jetzt vorwiegend allein. Es ist ein schöner alter Fachwerkbau in einer Bauweise, die für die Wetterau einst typisch war. Der älteste Teil ist 1722 entstanden. Man mag es kaum glauben, aber es ist historisch belegt: Im größeren und einzig beheizbaren Raum der Schule wurden zeitweise bis zu hundert Kinder unterrichtet. Weil es sonst überall zu kalt war, setzten sich auch die übrigen Hausbewohner zu den Schulkindern dazu. -
Natura Trails „Rund Um Den Glauberg“
Rund um den Glauberg Vom Keltenschatz zu den Naturschätzen der Nidderauen Auenlandschaft mit Seggenrieder Biologische Vielfalt erleben Natura Trails: Rund um den Glauberg Hessens Naturschätzen Die Spuren der Kelten können auf dem Glauberg mit seinem sehenswerten Museum der Keltenwelt besichtigt auf der Spur werden. Hier gibt es die in den Gräbern gefundenen Schätze zu sehen. Von dort führt der Weg durch die Hessen ist bekannt für seine einzigartige Natur und beiden FFH-Gebiete „Basaltmagerrasen am Rand der Landschaft mit ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit. Wetterauer Trockeninsel“ und „Grünlandgebiete in Mittelgebirge, Flussauen, Streuobstwiesen oder auch der Wetterau“ und dann durch das Vogelschutzgebiet Dünenlandschaften bieten ein lebenswertes Umfeld „Wetterau“ zu den Naturschätzen der Auenlandschaft und Raum für Erholung. des Niddertales und wieder zurück. Sämtliche Lebensräume in Hessen sind geprägt durch jahrhunderte lange Nutzung des Naturraums durch „Naturschutz wird in der Wetterau den Menschen. Unter ihnen finden sich sowohl solche, schon seit langem großgeschrieben. Ein die noch als naturnah anzusehen sind als auch Leuchtturmprojekt ist das großräumige Lebensraumtypen, die erst durch traditionelle Wirt- Schutzgebietsystem des Auenverbundes schaftsweisen des Menschen entstanden sind. Alle Wetterau.” sind Heimat einer beeindruckenden Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten. Michael Elsaß: Wetterausflüge 2 Viele dieser Land schaftstypen stehen unter gesetz - lichem Schutz, um sie für zukünftige Generationen Die Nidder und ihre Auen zu erhalten, so auch das Natura 2000-Gebiet, an das der hier vorgestellte Natura Trail heranführt. Die Nidder entspringt im Vogelsberg bei der Herchen- hainer Höhe. Sie hat eine Länge von 68,8 km und Angelegt wurde dieser Natura Trail im Rahmen eines mündet bei Bad Vilbel-Gronau in die Nidda. -

7. Biberkartierung 2017 7.1 Legende Biberkartierung
7. Biberkartierung 2017 7.1 Legende Biberkartierung 7.2.2 Landkreis Fulda Biberrevier FD 01: Fliede bei Fulda-Bronnzell Biberrevier FD 02: Schmalnau bei Gichenbach Biberrevier FD 03: Fulda Stadtbereich Biberrevier FD 04: Fulda bei Gläserzell Biberrevier FD 05: Fulda bei Eichenzell Biberrevier FD 06: Fliede bei Nüchtershof/Weimesmühle Biberrevier FD 07: Haune bei Burghaun/Hünfeld Biberrevier FD 09: Lütter bei Rönshausen Biberrevier FD 10: Döllbach zwischen Döllbach und Rothemann Biberrevier FD 11: Lüder bei Großenlüder Biberrevier FD 12: Fulda bei Fulda-Kämmerzell Biberrevier FD 13: Gröllbach südöstlich Sparhöfe Biberrevier FD 15: Haune nördlich Burghaun Biberrevier FD 16: Fulda bei Welkers Biberrevier FD 17: Fliede bei Neuhof Biberrevier FD 19: Lauter bei Bad Salzschlirf Biberrevier FD 20: Lüder bei Uffhausen Biberrevier FD 21: Fulda Horaser Wiesen Biberrevier FD 22: Haune östlich Burghaun Biberrevier FD 23: Haunesee bei Marbach Biberrevier FD 24: Lütter zwischen Lütter und Weyhers Biberrevier FD 25: Lüder zwischen Hainzell und Kleinlüder Biberrevier FD 26: Kalte Lüder bei Hessenmühle Biberrevier FD 27: Rehbach bei Hattenhof Biberrevier FD 28: Fulda an der Johannisberger Brücke in Fulda Biberrevier FD 29: Engelhelmsbach östlich Bronnzell 7.2.3 Wetteraukreis Biberrevier FB 01: Nidder bei Heegheim Biberrevier FB 02: Nidda bei Dauernheim Biberrevier FB 04: Nidda bei Ober-Florstadt Biberrevier FB 05: Wetter zwischen Ossenheim und Bauernheim Biberrevier FB 06: Nidda am Dauernheimer Hof Biberrevier FB 07: Teich im Kurpark Bad Nauheim Biberrevier -

Biber in Hessen
Regierungspräsidium Darmstadt Biber in Hessen © Gisela Rösch Kartierung der Biber in Hessen im Jahr 2017 Jahresbericht 2017 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 1 2. Methodik 1 3. Biberreviere im Jahr 2017 2 4. Zusammenfassung und Ausblick 4 5. Biber-Totfunde 5 6. Übersicht der Biberreviere in Hessen 5 6.1 Revierliste 5 6.2 Karten 11 a) Übersichtskarten Hessen 11 b) Teilblätter Mitte, Nord 1, Nord 2, Süd 1, Süd 2 13 c) Bestandskarten Hessen 18 6.3 Entwicklung der Biberpopulation in Hessen 20 6.4 Verteilung der Biberreviere auf Meßtischblätter (TK 25) 21 6.5 Übersichtstabellen zu den Biberrevieren 2017 22 6.6 Übersichtstabellen der Biberreviere seit 2007 26 6.7 Biberreviere in Unterfranken 2017 30 6.8 Entwicklung der Biberpopulation in Unterfranken 2017 30 7. Biberkartierung 2017 31 7.1 Legende Biberkartierung 31 7.2 Biberreviere der Landkreise und Städte in Hessen 2017 32 Bildquelle: Titelbild Gisela Rösch (Forstamt Schlüchtern) Jahresbericht 2017: Auswertung und Bearbeitung Matthias Fink, Jürgen Siek, Regierungspräsidium Darmstadt Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt, Tel. +49(6151) 12-5166/-5267 E-Mail: [email protected] [email protected] Internet: www.rp-darmstadt.hessen.de 1. Einleitung Auch im Jahr 2017 wurden die Biber-Reviere in Hessen durch viele ehrenamtliche Betreuer kartiert. Die Ergebnisse wurden wie üblich dem Regierungspräsidium Darmstadt gemeldet und dort ausgewertet. In Einzelfällen wurden auch wieder Gebietsüberprüfungen durchgeführt. Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung der Meldungen im Jahresbericht. Aufgabe der Revierbetreuer ist es, die Reviere in den zugeteilten Gewässer- abschnitten kontinuierlich zu beobachten. Die Daten geben eine Übersicht über die Entwicklung des Biberbestandes und die Ausbreitung des Bibers in Hessen. -
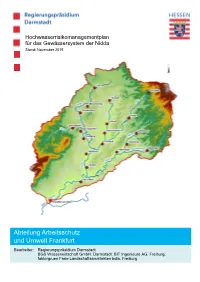
HWRM-Nidda-Langfassung.Pdf
Hochwasserrisikomanagementplan für das Gewässersystem der Nidda Stand: November 2015 Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt Bearbeiter: Regierungspräsidium Darmstadt BGS Wasserwirtschaft GmbH, Darmstadt; BIT Ingenieure AG, Freiburg, faktorgruen Freie Landschaftsarchitekten bdla, Freiburg Bearbeiter: Brandt Gerdes Sitzmann Wasserwirtschaft GmbH Pfungstädter Straße 20 64297 Darmstadt Internet: www.bgswasser.de Tel.: +49 (0)6151 9453-0 Fax: +49 (0)6151 9453-80 BIT Ingenieure AG Talstraße1 79102 Freiburg Internet: http://www.bit-ingenieure.de Tel.: +49 (0)761 29657-0 Fax: +49 (0)761 29657-11 faktorgruen Freie Landschaftsarchitekten BDLA Merzhauser Straße 110 79100 Freiburg Internet: www.faktorgruen.de Tel.: +49 (0)761 707647-0 Fax: +49 (0)761 707647-50 Regierungspräsidium Darmstadt Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt Dezernat IV/F 41.2 - Oberflächengewässer Gutleutstraße 114 60327 Frankfurt am Main Internet: www.rp-darmstadt.hessen.de Tel.: +49 (0)69 2714-0 Fax: +49 (0)69 2714-5950 Hochwasserrisikomanagementplan Nidda Der Hochwasserrisikomanagementplan für das Gewässersystem der Nidda, nachfolgend vereinfachend als Hochwasserrisikomanagementplan Nidda bezeichnet, umfasst das gesamte Einzugsgebiet der Nidda mit der Nidda als Hauptge- wässer inklusive der Nebengewässer Nidder, Seemenbach, Wetter, Usa und Horloff. Der Hochwasserrisikomanagementplan Nidda ist wie folgt dokumentiert: Mappe 1: Textunterlagen - Hochwasserrisikomanagementplan - Maßnahmensteckbrief - Umweltbericht Mappe 2: Planunterlagen - Übersicht Projektgebiet - -

Verbundweiter Nahverkehrsplan Für Die Region Frankfurt Rhein-Main 2
Verbundweiter Nahverkehrsplan für die Region Frankfurt Rhein-Main 2. Fortschreibung 2020 – 2030 Entwurf 1 Inhaltsverzeichnis 1 Ziele und Anforderungen .................................................................................................... 6 1.1 Einführung ..................................................................................................................... 6 1.2 Leitbild und Ziele – Mobilität 2030 ................................................................................. 7 1.3 Vorgehensweise .......................................................................................................... 15 1.4 Künftige Entwicklungen und Zukunftstrends ............................................................... 16 1.5 Gesetzliche und planerische Rahmenbedingungen.................................................... 24 2 Bestandsaufnahme ........................................................................................................... 25 2.1 Einführung ................................................................................................................... 25 2.2 Leistungsangebot und Verkehrsnachfrage ................................................................. 41 2.3 Bahnhöfe und Haltestellen .......................................................................................... 51 2.4 Streckeninfrastruktur ................................................................................................... 73 2.5 Fahrzeuge .................................................................................................................. -

Abteilung Arbeitsschutz Und Umwelt Frankfurt
Hochwasserrisikomanagementplan für das Gewässersystem der Nidda - Kurzfassung - Stand: November 2015 Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt Bearbeiter: Regierungspräsidium Darmstadt BGS Wasserwirtschaft GmbH, Darmstadt; BIT Ingenieure AG, Freiburg, faktorgruen Freie Landschaftsarchitekten bdla, Freiburg Bearbeiter: Brandt Gerdes Sitzmann Wasserwirtschaft GmbH Pfungstädter Straße 20 64297 Darmstadt Internet: www.bgswasser.de Tel.: +49 (0)6151 9453-0 Fax: +49 (0)6151 9453-80 BIT Ingenieure AG Talstraße1 79102 Freiburg Internet: http://www.bit-ingenieure.de Tel.: +49 (0)761 29657-0 Fax: +49 (0)761 29657-11 faktorgruen Freie Landschaftsarchitekten BDLA Merzhauser Straße 110 79100 Freiburg Internet: www.faktorgruen.de Tel.: +49 (0)761 707647-0 Fax: +49 (0)761 707647-50 Regierungspräsidium Darmstadt Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt Dezernat IV/F 41.2 - Oberflächengewässer Gutleutstraße 114 60327 Frankfurt am Main Internet: www.rp-darmstadt.hessen.de Tel.: +49 (0)69 2714-0 Fax: +49 (0)69 2714-5950 Hochwasserrisikomanagementplan Nidda – Kurzfassung Der Hochwasserrisikomanagementplan für das Gewässersystem der Nidda, nachfolgend vereinfachend als Hochwasserrisikomanagementplan Nidda bezeichnet, umfasst das gesamte Einzugsgebiet der Nidda mit der Nidda als Hauptge- wässer inklusive der Nebengewässer Nidder, Seemenbach, Wetter, Usa und Horloff. Der Hochwasserrisikomanagementplan Nidda ist wie folgt dokumentiert: Mappe 1: Textunterlagen - Hochwasserrisikomanagementplan - Maßnahmensteckbrief - Umweltbericht Mappe 2: Planunterlagen