Aus Der Geschichte Der Pfarrei Rohrdorf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Militär Und Bevölkerungsschutz Koordination Zivilschutz PLZ
DEPARTEMENT GESUNDHEIT UND SOZIALES Militär und Bevölkerungsschutz Koordination Zivilschutz GEMEINDEN MIT IHREN ZIVILSCHUTZORGANISATIONEN 2020 PLZ Gemeinde ZSO 5000 Aarau Aare Region 4663 Aarburg Wartburg 5646 Abtwil Freiamt 5600 Ammerswil Lenzburg Region 5628 Aristau Freiamt 8905 Arni Freiamt 5105 Auenstein Lenzburg Region 5644 Auw Freiamt 5400 Baden Baden (Region) 5330 Bad Zurzach Zurzibiet 5333 Baldingen Zurzibiet 5712 Beinwil am See aargauSüd 5637 Beinwil (Freiamt) Freiamt 5454 Bellikon Aargau Ost 8962 Bergdietikon Wettingen-Limmattal 8965 Berikon Aargau Ost 5627 Besenbüren Freiamt 5618 Bettwil Seetal 5023 Biberstein Aare Region 5413 Birmenstorf Baden (Region) 5242 Birr Brugg Region 5244 Birrhard Brugg Region 5708 Birrwil aargauSüd 5334 Böbikon Zurzibiet 5706 Boniswil Seetal 5623 Boswil Freiamt 4814 Bottenwil Suhrental-Uerkental 5315 Böttstein Zurzibiet 5076 Bözen Oberes Fricktal 5225 Bözberg Brugg Region 5620 Bremgarten Aargau Ost 4805 Brittnau Zofingen (Region) 5200 Brugg Brugg Region 5505 Brunegg Lenzburg Region 5033 Buchs Aare Region 5624 Bünzen Freiamt 5736 Burg aargauSüd 5619 Büttikon Aargau Ost 5632 Buttwil Freiamt Seite 1 PLZ Gemeinde ZSO 5026 Densbüren Oberes Fricktal 6042 Dietwil Freiamt 5606 Dintikon Aargau Ost 5605 Dottikon Aargau Ost 5312 Döttingen Zurzibiet 5724 Dürrenäsch Seetal 5078 Effingen Oberes Fricktal 5445 Eggenwil Aargau Ost 5704 Egliswil Seetal 5420 Ehrendingen Baden (Region) 5074 Eiken Unteres Fricktal 5077 Elfingen Oberes Fricktal 5304 Endingen Zurzibiet 5408 Ennetbaden Baden (Region) 5018 Erlinsbach AG Aare -
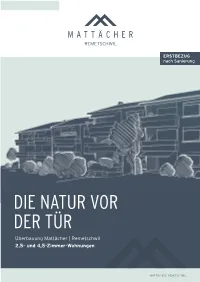
Dokumentation (PDF)
REMETSCHWIL ERSTBEZUG nach Sanierung DIE NATUR VOR DER TÜR Überbauung Mattächer | Remetschwil 2,5- und 4,5-Zimmer-Wohnungen MATTÄCHER | REMETSCHWIL 02 | INHALT INHALT LIEGENSCHAFT 04 WOHNGEFÜHL 06 LAGE UND UMGEBUNG 08 GRUNDRISSE 10 IMPRESSIONEN 24 KURZBAUBESCHRIEB 36 KONTAKT 38 03 LIEGENSCHAFT MATTÄCHER DIE LIEGENSCHAFT Die Mattächer-Liegenschaft befindet sich am östlichen Dorfrand von Remetschwil und grenzt an die Landwirtschaftszone. Umgeben von viel Natur, ruhig gelegen und gut erschlossen, ist die Überbauung nicht nur für Familien, sondern auch für Paare und Singles attraktiv, die gerne im Grünen leben und dennoch nicht auf die Nähe zur Stadt verzichten möchten. Die Häuser mit Baujahr 1984-1985 wurden saniert und technisch auf den neuesten Stand gebracht. Sie sind über eine gemeinsame Tiefgarage miteinander verbunden. Die gemüt- lichen Wohnungen verfügen über attraktive Grundrisse, einen schönen Balkon und warten mit hochwertigen Materialien und Geräten auf. Erste Etappe: BEZUG Das Haus 5 ist ab April 2021 bezugsbereit. ab 1.4.2021 Zweite Etappe: HAUS 5 Bezug ab Mai / Juni 2021 04 | LIEGENSCHAFT LIEGENSCHAFT MATTÄCHER Alle Angaben und Visualisierungen sind unverbindlich. Stand Januar 2021 Stand sind unverbindlich. Alle Angaben und Visualisierungen 05 SO GUT WIE NEU DAS WOHNGEFÜHL Am Grundriss der Wohnungen wurde nichts Die Fussböden sind mit einem pflegeleichten, verändert. Die Räume in klassischer Auftei- grosszügigen Eichenparkett belegt, was für lung erstrahlen jedoch in neuem Glanz. Die ein warmes Wohnambiente sorgt. Geräte und Einbauten sind qualitativ hoch- wertig und technisch auf dem neuesten Stand. Alle verbauten Materialien sind von hoher, langlebiger Qualität und wurden sorgfältig In der Mehrzahl der Wohnungen gelangen Sie aufeinander abgestimmt. von der Küche direkt auf den Balkon, perfekt, um die eigenen Küchenkräuter aufzuziehen. -

Polizeireglement (Polr) Der Gemeinden
Polizeireglement (PolR) der Gemeinden Bellikon Fislisbach Mägenwil Mellingen Niederrohrdorf Oberrohrdorf Remetschwil Stetten Wohlenschwil .&>A^ Tägerig vom 01. Mai 2009 Polizeireglement der Gemeinden Bellikon, Fislisbach, Mägenwil, Mellingen, Niederrohrdorf, Oberrohrdorf, Remetschwil, Stetten, Tägerig und Wohlenschwil Inhaltsverzeichnis Seite l. Allgemeine Bestimmungen § 1 Zweck 4 § 2 Geltungsbereich 4 § 3 Polizeiorgane 4 § 4 Anordnung und Vorladungen 4 § 5 Identitätsnachweis 5 § 6 Störungen der polizeilichen Tätigkeit 5 II. Besondere Bestimmungen A. Immissionsschutz § 7 Grundsatz 5 § 8 Lärmschutz 5 § 9 Nachtruhestörung 6 § 10 Lautsprecher 6 § 11 Himmelsstrahler 6 §12 Verbrennen von Material 6 B. Schutz der öffentlichen Sachen § 13 Grundsatz 6 § 14 Zurückschneiden von Sträuchern 6 § 15 Reinigungspflicht, Schneeräumung, Littering 7 § 16 Lagerung von Materialien 7 § 17 Entsorgungsstellen 7 § 18 Plakate, Reklamen 7 C. Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit § 19 Grundsatz 7 § 20 Veranstaltungen 7 § 21 Schiessen 7 § 22 Feuerwerk 8 § 23 Sprengungen 8 D. Schutz der öffentlichen Sittlichkeit § 24 Grundsatz 8 § 25 Öffentliches Ärgernis 8 § 26 Verrichten der Notdurft 8 Polizeireglement der Gemeinden Bellikon, Fislisbach, Mägenwil, Mellingen, Niederrohrdorf, Oberrohrdorf, Remetschwil, Stetten, Tägerig und Wohlenschwil E. Wirtschafts- und Gewerbepolizei § 27 Sammlungen, Betteln 9 § 28 Bewilligung von Veranstaltungen 9 F. Tierhaltung § 29 Grundsatz 9 § 30 Hundehaltung 9 §31 Versäubern von Tieren 10 §32 Ausbringen von Hofdünger 10 III. Bewilligungsverfahren -

Jahresbericht 2019
Jahresbericht 2019 Schulhausweg 10, Postfach 100, 5442 Fislisbach, Tel. 056 483 00 69, Fax 056 483 00 70, [email protected], www.baden-regio.ch - 2 - I. Organisation Mitgliedsgemeinden Baden Regio gehören folgende 26 Gemeinden an: Baden Mägenwil Stetten Bergdietikon Mellingen Tägerig Birmenstorf Neuenhof Turgi Ehrendingen Niederrohrdorf Untersiggenthal Ennetbaden Oberrohrdorf Wettingen Fislisbach Obersiggenthal Wohlenschwil Freienwil Remetschwil Würenlingen Gebenstorf Schneisingen Würenlos Killwangen Spreitenbach Zwei Gemeinden haben ihre Mitgliedschaft bei Baden Regio satzungskonform gekündigt: Tägerig per 31.12.2020 und Schneisingen per 31.12.2021. Die beiden Gemeinden wollen sich künftig ver- mehrt Richtung Mutschellen-Rohrdorferberg-Reusstal resp. Zurzibiet ausrichten. Vorstand seit Präsident Roland Kuster, Gemeindeammann, Grossrat, Wettingen 2017 Vizepräsident Markus Schneider, Stadtammann, Baden 2018 Vertreter der Gemeinden Baden Markus Schneider, Stadtammann 2018 Rolf Wegmann, Leiter Entwicklungsplanung 1996 Stv.: Regula Dell'Anno, Vizeammann, Grossrätin 2018 Stv.: Wladimir Gorko, Entwicklungsplanung 2006 Bergdietikon Ralf Dörig, Gemeindeammann 2018 Stv.: Urs Emch, Vizeammann 2018 Birmenstorf Marianne Stänz, Gemeindeammann 2018 Stv.: Urs Rothlin, Gemeinderat 2017 Ehrendingen Urs Burkhard, Gemeindeammann 2018 Stv.: Markus Frauchiger, Vizeammann 2018 Ennetbaden Pius Graf, Gemeindeammann 2010 Stv.: Jürg Braga, Vizeammann 2010 Fislisbach Peter Huber, Gemeindeammann 2018 Stv.: Hanspeter Zaugg, Vizeammann 2018 Freienwil Robert A. Müller, -

«Die Reformierte Kirche Bietet Für Mich Einen Ort, an Dem Ich So Sein Kann, Wie Ich Bin.» INTERVIEW MIT PETRA SCHMIDLIN, UFWIND-TEAM, TEILGEMEINDE MELLINGEN
MAI 2017 www.ref-mellingen.ch DIE KIRCHGEMEINDE- BEILAGE VON Informationen der Reformierten Kirchgemeinde Mellingen mit den Teilgemeinden Mellingen, Rohrdorf, Fislisbach «Die Reformierte Kirche bietet für mich einen Ort, an dem ich so sein kann, wie ich bin.» INTERVIEW MIT PETRA SCHMIDLIN, UFWIND-TEAM, TEILGEMEINDE MELLINGEN Wichtige Stationen Ihres Lebens: In Kürze: Was hat Sie geprägt? Mein Lebensmotto? Die Schule des Lebens hat mich geprägt. Mit 4 Jahren fiel ich Das Leben ist eine Chance, nutze sie. Foto:MIC durch eine Krankheit in ein Koma. Als junge Frau verlor ich meinen Bruder, welcher mir bis heute fehlt. Ich absolvierte Ausrichtung meines Glaubens... Die Anderen trotz meiner beiden Kinder, im Alter von 34 Jahren eine Nach- Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten holbildung und setze mich seit über 10 Jahren für die Rechte auf allen deinen Wegen. (Psalm 91.11) Ich weiss, dass ich nie Ich sehe den sanften Wind von transgeschlechtlichen Menschen ein. alleine bin. in den Lärchen gehn Wie sind Sie zu Ihrer Aufgabe in der Die Reformierte Kirche bietet für mich... und höre das Gras wachsen, Reformierten Kirchgemeinde Mellingen gekommen? Einen Ort an dem ich so sein kann, wie ich bin. Wo ich nicht und die anderen sagen: Keine Zeit! An Weihnachten, brauchte es Verstärkung im Chor, so half ich einer Norm entsprechen muss um dazu zu gehören. ad-hoc-mässig aus. Seither möchte ich das Singen in der Kir- Ich erhalte dort mehr als ich gebe. che nicht mehr missen. Ich kann sein, wie ich bin und das ist Ich sehe den wilden Wassern zu gut so. -

«Mich Ärgert, Wenn Jemand Er- Niedrigt Wird, Weil Er Anders Ist.» INTERVIEW MIT SUSAN GASSER, FIIRE MIT DE CHLIINE TEAM, TEILGEMEINDE ROHRDORF
JUNI 2017 www.ref-mellingen.ch DIE KIRCHGEMEINDE- BEILAGE VON Informationen der Reformierten Kirchgemeinde Mellingen mit den Teilgemeinden Mellingen, Rohrdorf, Fislisbach «Mich ärgert, wenn jemand er- niedrigt wird, weil er anders ist.» INTERVIEW MIT SUSAN GASSER, FIIRE MIT DE CHLIINE TEAM, TEILGEMEINDE ROHRDORF Wichtige Stationen Ihres Lebens: In Kürze: Was hat Sie geprägt? Mein Lebensmotto? Ein sehr liebevolles Elternhaus und Bücher als Rückzugsort Mit der richtigen Musik geht alles besser. vor nicht immer sehr netten Klassen«kameraden». Freundinnen und Verwandte, bei welchen man sich auch dann Ausrichtung meines Glaubens... Foto:MIC sofort wieder zuhause fühlt, wenn man sie mal eine Weile nicht ... dass Jede und Jeder seinen selbst gewählten Weg gehen gesehen hat. kann. Mein Gottesbild ist das eines liebevollen und offenen Musik, um alles um sich herum zu vergessen; sich an schöne Gottes, der jedem die Freiheit gibt, zu glauben wie es für ihn Momente zu erinnern oder sich einfach stark zu fühlen. stimmt; ob privat oder in einer Kirche. Wie sind Sie zu Ihrer Aufgabe in der Die Reformierte Kirche bietet für mich... Reformierten Kirchgemeinde Mellingen gekommen? ... viel Platz für nette Begegnungen und liebe Menschen. Bei einem unserer ersten Besuche im Fiire mit de Chliine wur- de ein neues Team-Mitglied gesucht. Da ich die Feiern, auch Buch für die Insel... schon in anderen Gemeinden, sehr gerne besucht habe und Isaac Asimovs Foundation-Zyklus auch gerne Kindern Geschichten weitergebe, habe ich die Ge- Bild: DEM legenheit spontan beim Schopf gepackt. Schön war, dass ich In unserer Kirchgemeinde ist mein Lieblingsort... dabei gerade in die Jahresplanung fürs darauffolgende Jahr .. -

201901-Wegweiser-Januar
Eine Beilage der Zeitung reformiert. Nr. 1/28. Dezember 2018 Wegweiser www.ref-mellingen.ch Reformierte Kirche Mellingen Rohrdorf Fislisbach «Glaube, Hoffnung, Liebe» Gedanke des Monats Verena Künzler wirkt seit mehr als 30 Jahren in der Kirchgemeinde in vielen verschiedenen Aufgabenbereichen. Eine glückliche Zeit. Meine Kindheit in einem gast- hineingeboren zu sein und darin in für mich ein ganz bedeutsames und freundlichen Drei-Generationen- Anstand und Wohlstand leben zu liebes Symbol in meinem Leben. Geschäftshaushalt zu verbringen, dürfen. wog das Fremdsein unter Gleichalt- Was mich ärgert... rigen weitgehend auf. Dem frühen Eine Überschrift über mein Wir- Teilhaben an Verantwortung stan- ken und Werken: «Gaben verlan- Dress-Waste (eigene Wortschöp- den verhältnismässig viele Freihei- gen nach Hingabe», Lukas Evangeli- fung in Anlehnung an Food-Waste). ten in der Freizeitgestaltung und um 19, 12-27 Meine Zeit steht in der Berufswahl gegenüber. In Glau- deinen Händen bensangelegenheiten war es haupt- Meine Lieblingsorte innerhalb sächlich meine Mutter, welche mir Was mich fasziniert unserer Kirchgemeinde Impulse gab. Vor einiger Zeit ist mir eine Kirch- Andere mit meiner Kreativität Der Panoramaweg hoch oben am turmuhr aufgefallen. Das Ziffer- Mein Vorname wurde mir anstecken und das Schlummernde Heitersberg bietet eine grandiose blatt hat keine Zahlen, sondern auf Grund der Familientradition in ihnen wecken. In der Kirche Sicht weit über die Grenzen unserer Buchstaben. Die Buchstaben erge- gegeben und nicht aus Verehrung vor Ort, der Landeskirche wie der Kirchgemeinde hinaus. Auf der ben zusammen «Zeit ist Gnade», zur Hl. Verena, welche mir im Laufe weltweiten Kirche frauenspezifisch Reussbrücke, ganz unten zwischen und die Zeiger gehen in jeder Stun- meiner Spurensuche trotzdem und ökumenisch leben und Stetten und Niederwil, fällt der de diesen Worten nach: «Zeit ist zum Vorbild wurde. -

Pastoralraum Am Rohrdorferberg
Horizonte Mellingen-Rohrdorferberg 24. April 2021 10 Horizonte Mellingen-Rohrdorferberg 24. April 2021 Pastoralraum am Rohrdorferberg Bellikon St. Josef Pastoralraumleitung Mitarbeitender Priester Künten Heiligkreuz vakant vakant Niederrohrdorf Gut Hirt Koordination Jugendseelsorge Oberrohrdorf St. Martin Josef Bürge, Seelsorge Katrin Heeb Stetten St. Vinzenz TEL 056 496 11 74 Manuel Wüthrich Sekretariat TEL 056 496 67 40 Katrin Heeb, Administration TEL 056 496 12 25 TEL 056 496 67 40 MAIL [email protected] WEB www.pastoralraum-am-rohrdorferberg.ch 4. Sonntag der Osterzeit. «Ich bin der gute Hirt; ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne; und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind; auch sie muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören; dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten.» LEBENSEREIGNISSE 5. Sonntag der Osterzeit Unsere Taufen «Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich blei- Emely Manuela Hauri, Oberrohr- be, der bringt reiche Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. dorf; Maxime Makani Mattenber- Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man ger, Bellikon sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen.» «In jedem Kind träumt Gott den Kreuzwegandacht Traum der Liebe. In jedem Kind Der sonnige Karfreitagmor- wacht ein Stück Himmel auf. In gen lockte viele Teilnehmen- jedem Kind blüht Hoffnung, wächst de zum Kreuzweg in den die Zukunft. In jedem Kind wird Wald oberhalb Remetschwil. -

Reihenfamilienhausasse 43, 5453 Remetschwil REFH Mit Neuer Küche, Modernem Wintergarten Und Ganz Tags Besonnung Im Familienfreundlichen Quartier
Verkaufsobjekt HüslerstrReihenfamilienhausasse 43, 5453 Remetschwil REFH mit neuer Küche, modernem Wintergarten und ganz Tags Besonnung im familienfreundlichen Quartier. Kontakt I Marianne Winkler I 079 643 27 91 I [email protected] Inhaltsverzeichnis Angaben zum Objekt............................................ 1 Lage...................................................................... 2 Objektbeschreibung............................................. 3 Impressionen........................................................ 4 Pläne..................................................................... 6 Allgemeine Hinweise........................................... 9 1 ANGABEN ZUM OBJEKT Das im 2017 teilrenovierte 5.5 Zimmer Reiheneinfamilienhaus steht in einem ruhigen, kinderfreundlichen und für Familien ideal gelegenen Quartier. Das Haus ist ganz tags besonnt und der moderne Wintergarten lädt das ganze Jahr zum Verweilen ein. Das Haus verteilt sich auf 4 Etagen und wurde über die letzten Jahre laufend teilrenoviert. Anzahl Zimmer 5.5 Zimmer Anzahl Entagen 4 Wohnfläche 161m2 Grundstückfläche 180m2 Nutzfläche 161m2 Kubatur 734m3 Raumhöhe 2.38m Baujahr 1996 letztes Renovation 2017 Verkaufspreis in CHF 830`000.- Verfügbar nach Vereinbarung Garage Tiefgarage 1 Platz CHF 35`000.- inkl. Parkplätze Besucherparkplätze in unmittelbarer Nähe Nebenkosten in CHF ca. 3`500.- bis 4`000.- im Jahr bei einem vier Personen Haushalt (Beinhaltet Liegen- schaftsverwaltung, Heizkosten, Wasser, Strom und Entsorgung) Grundbuchdaten: Kataster Nr. 874 Bauzustand: -

Verkaufsdokumentation Gässli 4, Oberrohrdorf
Grosszügiges 5.5-Zimmer-Landhaus an privilegierter Lage mit grossem Umschwung Gässli 4, 5452 Oberrohrdorf Vertrauen verbindet. www.hbl.ch 2 Verkaufsdokumentation Verkauf und Kontakt Preis Verhandlungsbasis CHF 1‘600‘000 Verkauf Per sofort Kontakt Beratung Hypothekarbank Lenzburg AG Fachteam Immobilien Augustin Keller-Strasse 26 5600 Lenzburg Tel. 062 885 12 74 Fax 062 885 15 82 [email protected] www.hbl.ch Wünschen Sie eine persönliche Beratung oder einen unverbindlichen Besichtigungstermin? Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Freundliche Grüsse Hypothekarbank Lenzburg AG Die Hypothekarbank Lenzburg AG als Maklerin stützt sich bei ihrer Verkaufsdokumentation auf vorhandene Pläne, GB-Auszüge, externe Schätzungen, Feststellungen anlässlich von Besichtigungen und auf Aussagen der Eigentümerschaft u. a. m. Die Wiedergabe erfolgt ohne Gewähr. Die Hypothekarbank Lenzburg AG haftet zudem nicht für die Wiedergabe unkorrekter In- formationen bzw. Aussagen Dritter. 3 Verkaufsdokumentation Objektspezifische Informationen Verkaufsobjekt 5.5-Zimmer-Einfamilienhaus Gässli 4 5452 Oberrohrdorf Umfang Freistehendes Einfamilienhaus Zahlreiche Arbeits- und Lagerflächen Wintergarten Grosser Umschwung Doppelgarage Aussenparkplätze Zwei Werkstätten Stübli Merkmale Grosszügige und liebevoll gepflegte Umgebung Fantastische Weitsicht Ruhiges und familienfreundliches Wohnquartier Riegelbauweise Wohnzimmer mit Kachelofen Decken mit Sichtbalken Parzelle Nummer 786 Fläche 1‘651 m2 Wohnhaus Baujahr 1850 Volumen (AGV) ca. 1‘130 m3 Hauptnutzfläche (SIA 416) ca. 140 m2 Nebennutzfläche -
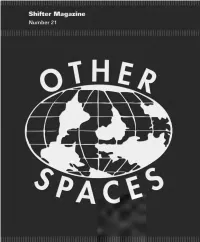
Other Spaces Spreads03.Pdf
9 8 9 7 8 6 7 5 6 4 5 3 4 2 3 1 2 INCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SHIFTER® 14 9 1 Shifter Magazine INCH Number 21: Other Spaces ® 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SHIFTER 14 8 Editors’ Note . 5. Luis Camnitzer . *6. Sean Raspet . 7. 7 Joanne Greenbaum . .*18 Blithe Riley . 20. Tyler Coburn . 31. Sheela Gowda . 39. Blank Noise . 42. Lise Soskolne . 55. 6 Mariam Suhail . 77. Julia Fish . *89. Dan Levenson . 90. Beate Geissler / Oliver Sann . .102 Alison O’Daniel . .110 Greg Sholette / Agata Craftlove . 115. Jacolby Satterwhite . .126 5 Josh Tonsfeldt . 130. Jeremy Bolen . .138 Kitty Kraus . 140. Tehching Hsieh . .143 * Work by these artists is dispersed throughout the issue . The page number marks the first 4 occurrence of their work . Publisher . SHIFTER Editor . .Sreshta Rit Premnath 3 Editor . .Matthew Metzger Designer . Dan Levenson SHIFTER, Number 21, September, 2013 Shifter is a topical magazine that aims to illuminate and broaden our understanding of the inter- sections between contemporary art, politics and philosophy .The magazine remains malleable and 2 responsive in its form and activities, and represents a diversity of positions and backgrounds in its contributors . shifter-magazine .com shiftermail@gmail .com This issue of SHIFTER was funded by a grant from the Graham Foundation © 2013 SHIFTER 1 INCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SHIFTER® 14 9 Other Spaces A city square is occupied by hundreds of shouting voices, and transformed 8 by hundreds of sleeping bodies building together a polis for action as well as a home for repose . -
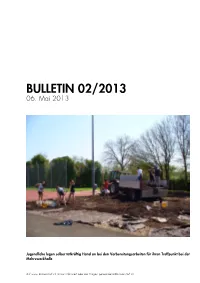
Bulletin 02/2013 06
BULLETIN 02/2013 06. Mai 2013 Jugendliche legen selber tatkräftig Hand an bei den Vorbereitungsarbeiten für ihren Treffpunkt bei der Mehrzweckhalle Auf www.birmenstorf.ch immer informiert oder bei Fragen [email protected] Bulletin 02/2012, 06. Mai 2013 Seite 2 Inhalt (ein Auszug) Seite − Gesamterneuerungswahlen 2014/2017 03 − Traktandenliste Sommergemeindever- sammlung mit Kurzbericht 04 − Alarmierung Feuerwehr 06 − Erteilte Baubewilligungen 10 − Infos der Technischen Betriebe 11 − Infos Tagesstrukturen 11 − Infos Jugendarbeit 11 − Schulnachrichten 15 Auf www.birmenstorf.ch immer informiert oder bei Fragen [email protected] Bulletin 02/2012, 06. Mai 2013 Seite 3 − Constantin Zehnder Gesamterneuerungswahlen kommunale Be- − Gabriela Zehnder hörden für die Amtsperiode 2014/2017 − 3 Mitglieder Steuerkommission Am 31.12.2013 endet die aktuelle 4-jährige − Cornelia Biland Amtsperiode der kommunalen Behörden und − André Jucker Kommissionen. 1 Vakanz (Rücktritt von Felix Meyer) Der Regierungsrat hat für das Durchführen der kommunalen Gesamterneuerungswahlen für die − 1 Ersatzmitglied Steuerkommission Amtsperiode 2014/2017 ein Zeitfenster vom − Entscheid über erneute Kandidatur von 09.06. bis 22.12.2013 festgelegt. Martin Jakob ist noch offen − 4 Mitglieder Wahlbüro 1. Wahlgang am 22.09.2013 − Oliver Brack − Michel Jobin Der Gemeinderat hat entschieden, den ersten − Yvonne Schmid Wahlgang über das Wochenende vom − Erika Tschümmy 22.09.2013 und einen allfälligen zweiten über das Wochenende vom 24.11.2013 durchzu- führen Anmeldefrist