Streitkultur
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Word-Of-God Conflict in the Lutheran Church Missouri Synod in the 20Th Century
Luther Seminary Digital Commons @ Luther Seminary Master of Theology Theses Student Theses Spring 2018 The Word-of-God Conflict in the utherL an Church Missouri Synod in the 20th Century Donn Wilson Luther Seminary Follow this and additional works at: https://digitalcommons.luthersem.edu/mth_theses Part of the Christian Denominations and Sects Commons, and the History of Christianity Commons Recommended Citation Wilson, Donn, "The Word-of-God Conflict in the utherL an Church Missouri Synod in the 20th Century" (2018). Master of Theology Theses. 10. https://digitalcommons.luthersem.edu/mth_theses/10 This Thesis is brought to you for free and open access by the Student Theses at Digital Commons @ Luther Seminary. It has been accepted for inclusion in Master of Theology Theses by an authorized administrator of Digital Commons @ Luther Seminary. For more information, please contact [email protected], [email protected]. THE WORD-OF-GOD CONFLICT IN THE LUTHERAN CHURCH MISSOURI SYNOD IN THE 20TH CENTURY by DONN WILSON A Thesis Submitted to the Faculty of Luther Seminary In Partial Fulfillment, of The Requirements for the Degree of MASTER OF THEOLOGY THESIS ADVISER: DR. MARY JANE HAEMIG ST. PAUL, MINNESOTA 2018 ACKNOWLEDGMENTS Dr. Mary Jane Haemig has been very helpful in providing input on the writing of my thesis and posing critical questions. Several years ago, she guided my independent study of “Lutheran Orthodoxy 1580-1675,” which was my first introduction to this material. The two trips to Wittenberg over the January terms (2014 and 2016) and course on “Luther as Pastor” were very good introductions to Luther on-site. -

HISTORY of the STUDY of THEOLOGY [Pt
HISTOEY OF THE STUDY OF THEOLOGY BY CHARLES AUGUSTUS gRIGGS D.D., D.LITT. Prepared for Publication by his Daughter EMILIE GRACE BRIGGS, B.D. VOL. II. NEW YORK CHARLES SCRIBNER'S SONS 1916 Published igt6 All rights reserved CONTENTS PART I THE STUDY OF THEOLOGY IN THE MIDDLE AGES CHAP. PA01 I. THE STUDY OF THEOLOOT IN THE NINTH AND TENTH .1 CENTURIES ...... 1 II. THE STUDY OF THEOLOGY IN THE ELEVENTH AND TWELFTH CENTURIES . .17 III. THE ORIGIN AND GROWTH OF THE UNIVERSITIES IN THE TWELFTH AND THIRTEENTH CENTURIES . 40 IV. THE DECLINE OF SCHOLASTICISM IN THE FOURTEENTH AND FIFTEENTH CENTURIES . .61 PART II THE MODERN AGE L THE REVIVAL OF LEARNING . .82 IL THE REFORMATION ..... 105 III. THE STUDY OF THEOLOGY IN THE SEVENTEENTH AND EIGHTEENTH CENTURIES .... 143 IV. THB STUDY OF THEOLOGY IN THE NINETEENTH CENTURY ...... 184 BIBLIOGRAPHY ...... 213 INDEX ....... 219 PART I THE STUDY OF THEOLOGY IN THE MIDDLE AGES CHAPTER I THE STUDY OF THEOLOGY IN THE NINTH AND TENTH CENTURIES 1. A palace school was established by the Franks for the training of princes and nobles ; when Charlemagne ap pointed Alcuin as its superintendent, it rapidly became a great centre of learning. The palace school was founded by one of the pre decessors of Charlemagne for the training of the sons of princes and nobles. As a court school it moved about with the monarch from place to place. Charlemagne himself was trained there.1 He had some knowledge of Greek as well as Latin, and studied with the grammarian, Peter of Pisa ; possibly also with Paul the Deacon (t 797), a Benedictine monk and noted Lombard scholar, who taught Greek at his court for a time, and afterwards wrote a history of the Lombards. -

Moses Mendelssohn on Hebrew As a Language of Action Avi Lifschitz
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by UCL Discovery 1 A natural yet providential tongue: Moses Mendelssohn on Hebrew as a language of action Avi Lifschitz (UCL) Abstract: How did Moses Mendelssohn reconcile a naturalistic theory of language, advocating the contingent development of all tongues, with the belief that Hebrew was a divine language that did not change ever since its inception? The seeming contradiction was resolved by employing the contemporary notion of the language of action – a primordial means of communication, where gesture and melody were as significant as words. Mendelssohn’s view of Hebrew as the language closest to this idiom was accompanied by his suggestion that the Jewish ceremonial law is a living script which can be properly understood only through oral instruction. He employed both ideas to counter the notions that the Hebrew vowel points were a late invention and that some loci in the Hebrew Bible had been subject to textual corruption. For Mendelssohn, the allegedly supernatural aspects of spoken Hebrew could be naturalised through constant and lively human conversation across the ages. The appropriation of contemporary critiques of the arbitrariness of language allowed Mendelssohn to forge an original synthesis that could simultaneously accommodate naturalism and providentialism. If this essay starts with Heinrich Heine’s well-known comparison between Moses Mendelssohn and Martin Luther, it is only in order to question this nineteenth-century commentary on Mendelssohn. Heine saw the Jewish philosopher and the Christian reformer as the intellectual pioneers of a return to the Bible which involved, respectively, the undermining of rabbinical literature and Catholic scholasticism. -

AF Büsching and the Place of Geographical Knowledge
A.F. Büsching and the Place of Geographical Knowledge in the German Enlightenment, c.1740–1800 by Dean W. Bond A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of Geography University of Toronto © Copyright by Dean W. Bond 2016 A.F. Büsching and the Place of Geographical Knowledge in the German Enlightenment, c.1740–1800 Dean W. Bond Doctor of Philosophy Department of Geography University of Toronto 2016 Abstract This dissertation places geographical knowledge and practice in the German Enlightenment (Aufklärung). I illustrate something of geography’s constitutive sites and practical making by discussing the life and work of Anton Friedrich Büsching (1724–93), who made his name as one of the foremost geographers in the German lands and Europe through his Neue Erdbeschreibung (Hamburg, 1754–92), and through his geographical periodicals. I consider Büsching’s geographical project and its social, political and scientific contexts in three articles. The first concerns the making of geographical knowledge ‘at home’ in the context of Büsching’s geography of Asia (Hamburg, 1768) and the Royal Danish Expedition to Arabia (1761–67) organised by Johann David Michaelis. I illustrate how Büsching and Michaelis sought to integrate knowledge of the study and the field in ways that allowed them to produce more accurate knowledge of Asia’s geography, and to legitimate the credibility of textual critique in the study. I argue that understanding the relations between the constitution of the study as an analytic site and the evaluation of knowledge from the field is crucial for understanding the making of Enlightenment geography. -

Jews and Protestants
Jews and Protestants Jews and Protestants From the Reformation to the Present Edited by Irene Aue-Ben-David, Aya Elyada, Moshe Sluhovsky and Christian Wiese Supported by the I-CORE Program of the Planning and Budgeting Committee and The Israel Science Foundation (grant No. 1798/12) Die freie Verfügbarkeit der E-Book-Ausgabe dieser Publikation wurde ermöglicht durch den Fachinformationsdienst Jüdische Studien an der Universitätsbibliothek J. C. Senckenberg Frankfurt am Main und 18 wissenschaftliche Bibliotheken, die die Open-Access-Transformation in den Jüdischen Studien unterstützen. ISBN 978-3-11-066108-8 e-ISBN (PDF) 978-3-11-066471-3 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-066486-7 Despite careful production of our books, sometimes mistakes happen. Unfortunately, the CC license was not included in the original publication. This has been corrected. We apologize for the mistake. Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution 4.0 International Lizenz. Weitere Informationen finden Sie unter http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Das E-Book ist als Open-Access-Publikation verfügbar über www.degruyter.com, https://www.doabooks.org und https://www.oapen.org. Library of Congress Control Number: 2019955542 Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available on the Internet at http://dnb.dnb.de. © 2020, Aue-Ben-David et al., published by Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston Cover image: ulimi / DigitalVision Vectors / gettyimages.de Printing and binding: CPI books GmbH, Leck www.degruyter.com Open-Access-Transformation in den Jüdischen Studien Open Access für exzellente Publikationen aus den Jüdischen Studien: Dies ist das Ziel der gemeinsamen Initiative des Fachinformationsdiensts Jüdische Studien an der Universitäts- bibliothek J. -

Culture and Exchange: the Jews of Königsberg, 1700-1820
Washington University in St. Louis Washington University Open Scholarship All Theses and Dissertations (ETDs) 1-1-2010 Culture and Exchange: The ewJ s of Königsberg, 1700-1820 Jill Storm Washington University in St. Louis Follow this and additional works at: https://openscholarship.wustl.edu/etd Part of the European History Commons Recommended Citation Storm, Jill, "Culture and Exchange: The eJ ws of Königsberg, 1700-1820" (2010). All Theses and Dissertations (ETDs). 335. https://openscholarship.wustl.edu/etd/335 This Dissertation is brought to you for free and open access by Washington University Open Scholarship. It has been accepted for inclusion in All Theses and Dissertations (ETDs) by an authorized administrator of Washington University Open Scholarship. For more information, please contact [email protected]. WASHINGTON UNIVERSITY IN ST. LOUIS Department of History Dissertation Examination Committee: Hillel Kieval, Chair Matthew Erlin Martin Jacobs Christine Johnson Corinna Treitel CULTURE AND EXCHANGE: THE JEWS OF KÖNIGSBERG, 1700-1820 by Jill Anita Storm A dissertation presented to the Graduate School of Arts and Sciences of Washington University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy May 2010 Saint Louis, Missouri Contents Acknowledgments ii Introduction 1 Part One: Politics and Economics 1 The Founding of the Community 18 2 “A Watchful Eye”: Synagogue Surveillance 45 3 “Corner Synagogues” and State Control 81 4 Jewish Commercial Life 115 5 Cross-Cultural Exchange 145 Part Two: Culture 6 “A Learned Siberia”: Königsberg’s Place in Historiography 186 7 Ha-Measef and the Königsberg Haskalah 209 8 Maskil vs. Rabbi: Jewish Education and Communal Conflict 232 9 The Edict of 1812 272 Conclusion 293 Bibliography 302 Acknowledgments Many people and organizations have supported me during this dissertation. -

Cosmopolitanism and the German Enlightenment
CHAPTER 6 COSMOPOLITANISM AND THE GERMAN ENLIGHTENMENT FRANZ LEANDER FILLAFER AND )URGEN OSTERHAMMEL THE European Enlightenment has long been regarded as a host of disembodied, self-perpetuating ideas typically emanating from France and inspiring apprentices at the various European peripheries. Historians have demonstrated the. scope and depth of the Enlightenment's reach and have painted a variegated picture of a decentralized intellectual system with fulcrums as remote as Lima, Calcutta, and Batavia. There clearly was a set of overarching purposes of emancipation and improvement, but elaborating and pursuing 'the Enlightenment' also involved a 'sense of place.' We encounter sentimentalist empiricists, atheist republican hacks, Leibnizian metaphysicians, Kantian defenders of enlightened kingship, and Anglican Newtonians. Enlightened premises were reconfigured by translation, showing the disparities of audience and purpose. The German translators of Adam Ferguson's Essay on the History of Civil Society, for example, diluted his civic humanism and praise of commerce and placed it in the service of an advocacy of spiritual freedom and aesthetic inwardness. Civic participation was in this way transmuted into the striving for individual perfection.L By its very nature, the Enlightenment imposed identifiable modes of thought on those who used it, while it always remained an expression of particular desires and meanings, and a response to particular condi tions. What difference did the Enlightenment make? It maintained that human reason was able to understand nature unaided by divine revelation, but attuned to its truths; 120 FRANZ LEANDER FILLA FER AND f0RGEN OSTEJUIAMMEL COSMOPOLITANISM AND THE c;ERMAN ENI.TC:HTENMENT 121 many En lighteners agreed that God, like Newlon's divine clockrnaker, had created the Moser in his Of Gerrnan National Spirit (Vmn deutschen Nationalgeisl, t765) tended to universe, but thereafter intervened no more. -
Anti-Semitism, and Christian Duty U.S
Jews and Protestants Jews and Protestants From the Reformation to the Present Edited by Irene Aue-Ben-David, Aya Elyada, Moshe Sluhovsky and Christian Wiese Supported by the I-CORE Program of the Planning and Budgeting Committee and The Israel Science Foundation (grant No. 1798/12) ISBN 978-3-11-066108-8 e-ISBN (PDF) 978-3-11-066471-3 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-066486-7 Library of Congress Control Number: 2019955542 Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available on the Internet at http://dnb.dnb.de. © 2020 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston Cover image: ulimi / DigitalVision Vectors / gettyimages.de Printing and binding: CPI books GmbH, Leck www.degruyter.com Acknowledgements It is our great pleasure to thankall the institutions that contributed to the Refor- mationConference at the Leo Baeck Institute Jerusalem in February 2017,includ- ing the Hebrew University of Jerusalem, the Martin Buber Chair in Jewish Thought and Philosophyatthe Goethe University in Frankfurt,the Evangelical Church in Germany, the Center for the StudyofChristianityatthe Hebrew Uni- versity, the Institute for the History of the German Jews in Hamburg, the Stephen Roth Institute for the StudyofContemporary Antisemitism and Racism in Tel Aviv University,and the Minerva Institute for German History,Tel Aviv University. We are grateful to SaraTropperfor the professional copy-editing,toJoel Swanson for preparingthe -
Johann Jacob Reiske – Leben Und Wirkung
Beiträge zur Leipziger Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte (BLUWiG) Reihe B, Band 6 Johann Jacob Reiske – Leben und Wirkung Ein Leipziger Byzantinist und Begründer der Orientalistik im 18. Jahrhundert Herausgegeben von Hans-Georg Ebert und Thoralf Hanstein Stefan Heidemann: Die Entwicklung der Methoden in der Islamischen Numismatik im 18. Jahrhundert – War Johann Jacob Reiske ihr Begründer? 147-202. EVANGELISCHE VERLAGSANSTALT Leipzig 2005 (ISBN 3-374-02327-4) Inhaltsverzeichnis Vorwort der Reihenherausgeber 5 Vorwort 7 Hans Georg Ebert: 11 Johann Jacob Reiske: Geist und Verständnis Holger Preißler: 19 Orientalische Studien in Leipzig vor Reiske Jan Loop: 45 Kontroverse Bemühungen um den Orient. Johann Jacob Reiske und die deutsche Orientalistik seiner Zeit Sebastian Kolditz: 87 Johann Jacob Reiske und die byzantinistischen Studien Detlef Döring: 117 Johann Jacob Reiskes Verbindungen zum wissenschaftlichen und literarischen Leben in Leipzig Gotthard Strohmaier: 141 Johann Jacob Reiske, ein Orientalist ohne Orientalismus Stefan Heidemann: 147 Die Entwicklung der Methoden in der Islamischen Numismatik im 18. Jahrhundert – War Johann Jacob Reiske ihr Begründer? Auswahlbibliographie gedruckter Schriften von und über Reiske 203 Personenregister 215 Autoren und Herausgeber 221 STEFAN HEIDEMANN Die Entwicklung der Methoden in der Islamischen Numismatik im 18. Jahrhundert – War Johann Jacob Reiske ihr Begründer? 1. EINLEITUNG „Wer zuerst einen Weg bähnet, der muß sich nothwendig verirren. Glücklich werde ich seyn, wenn solches von mir nicht zu oft geschiehet“1. Mit der Behauptung ‚keinen Vorgänger’2 gehabt zu haben, setzte sich Johann Jacob Reiske (1716-1774)3 selbst an den Beginn der Orientalischen Münzkunde. Auf der letzten Tagung vor 27 Jahren, die sich mit J. J. Reiske beschäftigte, folgte ihm Hermann Simon, damals Mitarbeiter am Münzkabinett in Berlin, und bestimmte ihn zum ‚Begründer der orien- talischen Numismatik’4. -
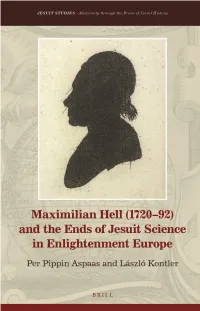
And the Ends of Jesuit Science in Enlightenment Europe
Maximilian Hell (1720–92) and the Ends of Jesuit Science in Enlightenment Europe <UN> Jesuit Studies Modernity through the Prism of Jesuit History Editor Robert A. Maryks (Independent Scholar) Editorial Board James Bernauer, S.J. (Boston College) Louis Caruana, S.J. (Pontificia Università Gregoriana, Rome) Emanuele Colombo (DePaul University) Paul Grendler (University of Toronto, emeritus) Yasmin Haskell (University of Western Australia) Ronnie Po-chia Hsia (Pennsylvania State University) Thomas M. McCoog, S.J. (Loyola University Maryland) Mia Mochizuki (Independent Scholar) Sabina Pavone (Università degli Studi di Macerata) Moshe Sluhovsky (The Hebrew University of Jerusalem) Jeffrey Chipps Smith (The University of Texas at Austin) volume 27 The titles published in this series are listed at brill.com/js <UN> Maximilian Hell (1720–92) and the Ends of Jesuit Science in Enlightenment Europe By Per Pippin Aspaas László Kontler leiden | boston <UN> This is an open access title distributed under the terms of the CC-BY-NC-Nd 4.0 License, which permits any non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. The publication of this book in Open Access has been made possible with the support of the Central European University and the publication fund of UiT The Arctic University of Norway. Cover illustration: Silhouette of Maximilian Hell by unknown artist, probably dating from the early 1780s. (In a letter to Johann III Bernoulli in Berlin, dated Vienna March 25, 1780, Hell states that he is trying to have his silhouette made by “a person who is proficient in this.” The silhouette reproduced here is probably the outcome.) © Österreichische Nationalbibliothek. -

Jews and Christians in Denmark the Brill Reference Library of Judaism
Jews and Christians in Denmark The Brill Reference Library of Judaism Editors Alan J. Avery-Peck (College of the Holy Cross) William Scott Green (University of Rochester) Editorial Board David Aaron (Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion, Cincinnati) Herbert Basser (Queen’s University) Bruce D. Chilton (Bard College) José Faur (Netanya College) Neil Gillman (Jewish Theological Seminary of America) Mayer I. Gruber (Ben-Gurion University of the Negev) Ithamar Gruenweld (Tel Aviv University) Maurice-Ruben Hayoun (University of Strasbourg and Hochschule fuer Juedische Studien Heidelberg) Arkady Kovelman (Moscow State University) David Kraemer (Jewish Theological Seminary of America) Baruch A. Levine (New York University) Alan Nadler (Drew University) Jacob Neusner (Bard College) Maren Niehoff (Hebrew University of Jerusalem) Gary G. Porton (University of Illinois) Aviezer Ravitzky (Hebrew University of Jerusalem) Dov Schwartz (Bar Ilan University) Günter Stemberger (University of Vienna) Michael E. Stone (Hebrew University of Jerusalem) Elliot R. Wolfson (University of California, Santa Barbara) VOLUME 48 The titles published in this series are listed at brill.com/brlj Jews and Christians in Denmark From the Middle Ages to Recent Times, ca. 1100–1948 By Martin Schwarz Lausten Translated by Margaret Ryan Hellman LEIDEN | BOSTON Cover illustration: The motif is called in Latin, “Ecclesia et Synagoga” (Church and Synagogue), from the church of Spentrup, Denmark (about 1200). The woman to the left represents Judaism. The woman to the right represents the Christian church. In short, the wall-painting wants to show that the Jews killed Jesus but it was a victory for the Christians. Christianity has conquered Judaism. Reprinted with permission from the Danish National Museum. -

Download Journal
UNION WITH CHRIST Valuing the Text Vol. 2, No. 1 / April 2016 April 1 / No. 2, Vol. for All Its Worth Westminster International Theological Reformed Seminary Evangelical Philadelphia Seminary uniocc.com Vol. 2, No. 1 / April 2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF REFORMED THEOLOGY AND LIFE Editorial Board Members Africa Flip Buys, North-West University, Potchefstroom, South Africa Henk Stoker, North-West University, Potchefstroom, South Africa Philip Tachin, National Open University of Nigeria, Lagos, Nigeria Cephas Tushima, ECWA Theological Seminary, Jos, Nigeria Asia In-Sub Ahn, Chong Shin University and Seminary, Seoul, Korea UNION WITH CHRIST Wilson W. Chow, China Graduate School of Theology, Hong Kong Matthew Ebenezer, Presbyterian Theological Seminary, Dehra Dun, India Editorial Committee and Staff Benyamin F. Intan, International Reformed Evangelical Seminary, Jakarta, Indonesia Editor in Chief: Paul Wells Kevin Woongsan Kang, Chongshin Theological Seminary, Seoul, Korea Senior Editors: Peter A. Lillback and Benyamin F. Intan In Whan Kim, Daeshin University, Gyeongsan, Gyeongbuk, Korea Associate Editor: Jeffrey K. Jue Billy Kristanto, International Reformed Evangelical Seminary, Jakarta, Indonesia Managing Editor: Bernard Aubert Jong Yun Lee, Academia Christiana of Korea, Seoul, Korea Book Review Editor: Brandon D. Crowe Sang Gyoo Lee, Kosin University, Busan, Korea Subscription Managers: Audy Santoso and Andrew Colpitts Deok Kyo Oh, Ulaanbaatar University, Ulaanbaatar, Mongolia Assistant: Abbie Daise Moses Wong, China Reformed Theological Seminary, Taipei, Taiwan Copy Editor: Henry Whitney Typesetter: Janice Van Eck Australia Allan M. Harman, Presbyterian Theological College, Victoria, Australia Mission Statement Peter Hastie, Presbyterian Theological College, Victoria, Australia Mark D. Thompson, Moore Theological College, Newtown, Australia Unio cum Christo celebrates and encourages the visible union believers possess in Christ when they confess the faith of the one holy catholic and apostolic Europe church, the body of Christ.