Eugen Gerstenmaier
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Central Europe
Central Europe West Germany FOREIGN POLICY wTHEN CHANCELLOR Ludwig Erhard's coalition government sud- denly collapsed in October 1966, none of the Federal Republic's major for- eign policy goals, such as the reunification of Germany and the improvement of relations with its Eastern neighbors, with France, NATO, the Arab coun- tries, and with the new African nations had as yet been achieved. Relations with the United States What actually brought the political and economic crisis into the open and hastened Erhard's downfall was that he returned empty-handed from his Sep- tember visit to President Lyndon B. Johnson. Erhard appealed to Johnson for an extension of the date when payment of $3 billion was due for military equipment which West Germany had bought from the United States to bal- ance dollar expenses for keeping American troops in West Germany. (By the end of 1966, Germany paid DM2.9 billion of the total DM5.4 billion, provided in the agreements between the United States government and the Germans late in 1965. The remaining DM2.5 billion were to be paid in 1967.) During these talks Erhard also expressed his government's wish that American troops in West Germany remain at their present strength. Al- though Erhard's reception in Washington and Texas was friendly, he gained no major concessions. Late in October the United States and the United Kingdom began talks with the Federal Republic on major economic and military problems. Relations with France When Erhard visited France in February, President Charles de Gaulle gave reassurances that France would not recognize the East German regime, that he would advocate the cause of Germany in Moscow, and that he would 349 350 / AMERICAN JEWISH YEAR BOOK, 1967 approve intensified political and cultural cooperation between the six Com- mon Market powers—France, Germany, Italy, Belgium, the Netherlands, and Luxembourg. -

Beyond Social Democracy in West Germany?
BEYOND SOCIAL DEMOCRACY IN WEST GERMANY? William Graf I The theme of transcending, bypassing, revising, reinvigorating or otherwise raising German Social Democracy to a higher level recurs throughout the party's century-and-a-quarter history. Figures such as Luxemburg, Hilferding, Liebknecht-as well as Lassalle, Kautsky and Bernstein-recall prolonged, intensive intra-party debates about the desirable relationship between the party and the capitalist state, the sources of its mass support, and the strategy and tactics best suited to accomplishing socialism. Although the post-1945 SPD has in many ways replicated these controversies surrounding the limits and prospects of Social Democracy, it has not reproduced the Left-Right dimension, the fundamental lines of political discourse that characterised the party before 1933 and indeed, in exile or underground during the Third Reich. The crucial difference between then and now is that during the Second Reich and Weimar Republic, any significant shift to the right on the part of the SPD leader- ship,' such as the parliamentary party's approval of war credits in 1914, its truck under Ebert with the reactionary forces, its periodic lapses into 'parliamentary opportunism' or the right rump's acceptance of Hitler's Enabling Law in 1933, would be countered and challenged at every step by the Left. The success of the USPD, the rise of the Spartacus move- ment, and the consistent increase in the KPD's mass following throughout the Weimar era were all concrete and determined reactions to deficiences or revisions in Social Democratic praxis. Since 1945, however, the dynamics of Social Democracy have changed considerably. -

Bbm:978-3-322-95484-8/1.Pdf
Anmerkungen Vgl. hierzu: Winfried Steffani, Monistische oder pluralistische Demokratie?, in: Günter Doeker, Winfried Steffani (Hrsg.), Klassenjustiz und Pluralismus. Festschrift ftir Ernst Fraenkel, Ham burg 1973, S. 482-514, insb. S. 503. 2 Da es im folgenden um die Untersuchung eines speziellen Ausschnittes des bundesdeutschen Regierungssystems geht, kann unter dem Aspekt arbeitsteiliger Wissenschaft auf die Entwick lung eines eigenständigen ausgewiesenen Konzepts parlamentarischer Herrschaft verzichtet werden. Grundlegend ftir diese Untersuchung ist die von Winfried Steffani entwickelte Parla mentarismustheorie, vgl. zuletzt: ders., Parlamentarische und präsidentielle Demokratie, Opla den 1979, S. 160-163. 3 Steffani, Parlamentarische und präsidenticlle Demokratie, a.a.O., S. 92f. 4 Theodor Eschenburg, Zur politischen Praxis in der Bundesrepublik, Bd. 1, 2. überarbeitete und mit Nachträgen versehene Auflage, München 1967, Vorwort, S. 10. 5 Zur Bedeutung des Amtsgedankens für die politische Theorie vgl. Wilhelm Hennis, Amtsgedanke und Demokratiebegriff, in: ders., Die mißverstandene Demokratie, Freiburg im Breisgau 1973, S.9-25. 6 Ein Amtseid für Parlamentspräsidenten, so wie er von Wolfgang Härth gefordert wird, würde dieser Verpflichtung des Bundestagspräsidenten öffentlichen Ausdruck verleihen und sie damit zusätzlich unterstreichen. Eine Vereidigung des Bundestagspräsidenten wäre schon allein aus diesem Grunde sinnvoll und erforderlich. Vgl. Wolfgang Härth, Parlamentspräsidenten und Amtseid, in: Zeitschrift ftir Parlamentsfragen, Jg. 11 (1980), S. 497·503. 7 Vgl. Aristoteles, Nikomachische Ethik, übersetzt und herausgegeben von Franz Dirlmeier, 5. Aufl. Berlin (Akademie-Verlag) 1969, 1094b (S. 6f): "Die Darlegung wird dann befriedigen, wenn sie jenen Klarheitsgrad erreicht, den der gegebene Stoff gestattet. Der Exaktheitsanspruch darf nämlich nicht bei allen wissenschaftlichen Problemen in gleicher Weise erhoben werden " 8 Vgl. als Kritik aus neuerer Zeit z. -

Adenauer SPD - PV, Bestand Erich Ollenhauer
Quellen und Literatur A) Quellen: Archiv für Christlich-Demokratische Politik (ACDP) Dörpinghaus, Bruno 1-009 Ehlers, Hermann 1-369 Fricke, Otto 1-248 Gottaut, Hermann 1-351 Gottesleben, Leo 1-359 Hermes, Andreas 1-090 Hilpert, Werner 1-021 Hofmeister, Werner 1-395 Kather, Linus 1-377 Kiesinger, Kurt Georg 1-226 Küster, Otto 1-084 Laforet, Wilhelm 1-122 Lenz, Otto 1-172 Merkatz, Joachim von 1-148 Meyers, Franz 1-032 Strickrodt, Georg 1-085 Wuermeling, Franz-Josef 1-221 CDU-Landesverband Hamburg III-010 CDU-Landesverband Schleswig-Holstein III-006 CDU-Landesverband Westfalen-Lippe III-002 Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) IV-006 Arbeitsgemeinschaft Demokratischer Kreise (ADK) VI-010 CDU-Bundespartei - Bundesvorstand VII-001 - Vorsitzende VII-002 - Wahlen VII-003 - Bundesgeschäftsstelle VII-004 Nouvelles Equipes Internationales (NEI) IX-002 Archiv der sozialen Demokratie (AdsD) Korrespondenz Ollenhauer - Adenauer SPD - PV, Bestand Erich Ollenhauer 665 Quellen und Literatur Archiv des Liberalismus (AdL) A 15 Bundesparteitag 1953 A 1-53 Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus (StBKAH) 05.05 06.09 12.12 12.29 12.32 II/4 111/47 Bundesarchiv Koblenz (BA) Bestand Bundeskanzleramt: B 136/1881 NL Friedrich Holzapfel NL Jakob Kaiser Bundestag, Parlamentsarchiv (BT PA) Ges.Dok. I 398 Bundesgesetzblatt, Gesetz- und Verordnungsblätter der Länder, Verhandlungen und Drucksachen des Deutschen Bundestages und dgl. sind nicht eigens aufgeführt. B) Literatur: ABGEORDNETE DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES. Aufzeichnungen und Erinnerungen. Hrsg. vom Deutschen Bundestag. 3 Bde. Boppard 1982-1985. Zit.: ABGEORD- NETE. ABS, Hermann J.: Konrad Adenauer und die Wirtschaftspolitik der fünfziger Jahre. In: KONRAD ADENAUER 1 S. 229-245. Zit.: ABS: Konrad Adenauer. -

1 Introduction
Notes 1 Introduction 1. What belongs together will now grow together (JK). 2. The well-known statement from Brandt is often wrongly attributed to the speech he gave one day after the fall of the Berlin Wall at the West Berlin City Hall, Rathaus Schöneberg. This error is understandable since it was added later to the publicized version of the speech with the consent of Brandt himself (Rother, 2001, p. 43). By that time it was already a well known phrase since it featured prominently on a SPD poster with a picture of Brandt in front of the partying masses at the Berlin Wall. The original statement was made by Brandt during a radio interview on 10 November for SFP-Mittagecho where he stated: ‘Jetzt sind wir in einer Situation, in der wieder zusammenwächst, was zusammengehört’ (‘Now we are in a situation in which again will grow together what belongs together’). 3. The Treaty of Prague with Czechoslovakia, signed 11 December 1973, finalized the Eastern Treaties. 4. By doing this, I aim to contribute to both theory formation concerning inter- national politics and foreign policy and add to the historiography of the German question and reunification policy. Not only is it important to com- pare theoretical assumptions against empirical data, by making the theoretical assumptions that guide the historical research explicit, other scholars are enabled to better judge the quality of the research. In the words of King et al. (1994, p. 8): ‘If the method and logic of a researcher’s observations and infer- ences are left implicit, the scholarly community has no way of judging the validity of what was done.’ This does not mean that the historical research itself only serves theory formation. -

Fraktionssitzung: 19
SPD – 04. WP Fraktionssitzung: 19. 01. 1965 101 19. Januar 195: Fraktionssitzung AdsD, SPD-BT-Fraktion 4. WP, Ord. 23.6. 1964 – 16.2. 1965 (alt 1036, neu 16). Über- schrift: »Fraktion der SPD im Bundestag. Kurzprotokoll der Fraktionssitzung vom 19. Januar 1965«. Anwesend: 162 Abgeordnete; Fraktionsassistenten: Bartholomäi, Ber- meitinger, Goller, Jäger, John, Laabs, List, Niemeyer, Scheele, Scheja, P. Schmidt, Schubart; PV: Castrup, Dingels, Nelke; SPD-Pressedienst: Dux, Exler. Prot.: Hofer. Zeit: 15.10 – 17.05 Uhr. Tagesordnung: 1.) Vorbereitung der Plenarsitzungen 2.) Ergänzung der Geschäftsordnung 3.) Termine 4.) Verschiedenes Fritz Erler eröffnet die Sitzung um 15.10 Uhr. Vor Eintritt in die Tagesordnung macht Fritz Erler folgende Mitteilungen: Peter Blachstein wird wegen Erkrankung vor März seine parlamentarische Arbeit nicht wieder aufnehmen können. Auch Alwin Kulawig leidet noch an den Folgen eines Un- falls.1 Fritz Erler begrüßt Heinrich Ritzel in der Fraktion.2 Der Vorsitzende unterrichtet die Fraktion über die Verhandlungen des Bundesminis- ters des Innern mit den Ländern über einen geeigneten Termin für die Bundestagswah- len. Minister Höcherl habe als günstigsten Termin den 19. September 1965 vorgeschla- gen.3 – Die Fraktion ist mit diesem Termin einverstanden. Fritz Erler unterrichtet die Fraktion von dem Inhalt seiner Ausführungen in Berlin, die zu Fehlinterpretationen über seine Auffassung zum deutsch-polnischen Verhältnis geführt haben.4 Er macht auf seine Pressekonferenz vom 18. Jan. 1965 in Bonn auf- merksam und weist darauf hin, daß der Text seiner Ausführungen in Berlin und in 1 Blachstein nahm erst ab 11. 5. 1965 und Kulawig ab 29. 6. 1965 wieder an Fraktionssitzungen teil. 2 Heinrich Georg Ritzel gehörte dem Bundestag in der gesamten 4. -

Stunde Null: the End and the Beginning Fifty Years Ago." Their Contributions Are Presented in This Booklet
STUNDE NULL: The End and the Beginning Fifty Years Ago Occasional Paper No. 20 Edited by Geoffrey J. Giles GERMAN HISTORICAL INSTITUTE WASHINGTON, D.C. STUNDE NULL The End and the Beginning Fifty Years Ago Edited by Geoffrey J. Giles Occasional Paper No. 20 Series editors: Detlef Junker Petra Marquardt-Bigman Janine S. Micunek © 1997. All rights reserved. GERMAN HISTORICAL INSTITUTE 1607 New Hampshire Ave., NW Washington, DC 20009 Tel. (202) 387–3355 Contents Introduction 5 Geoffrey J. Giles 1945 and the Continuities of German History: 9 Reflections on Memory, Historiography, and Politics Konrad H. Jarausch Stunde Null in German Politics? 25 Confessional Culture, Realpolitik, and the Organization of Christian Democracy Maria D. Mitchell American Sociology and German 39 Re-education after World War II Uta Gerhardt German Literature, Year Zero: 59 Writers and Politics, 1945–1953 Stephen Brockmann Stunde Null der Frauen? 75 Renegotiating Women‘s Place in Postwar Germany Maria Höhn The New City: German Urban 89 Planning and the Zero Hour Jeffry M. Diefendorf Stunde Null at the Ground Level: 105 1945 as a Social and Political Ausgangspunkt in Three Cities in the U.S. Zone of Occupation Rebecca Boehling Introduction Half a century after the collapse of National Socialism, many historians are now taking stock of the difficult transition that faced Germans in 1945. The Friends of the German Historical Institute in Washington chose that momentous year as the focus of their 1995 annual symposium, assembling a number of scholars to discuss the topic "Stunde Null: The End and the Beginning Fifty Years Ago." Their contributions are presented in this booklet. -

When Architecture and Politics Meet
Housing a Legislature: When Architecture and Politics Meet Russell L. Cope Introduction By their very nature parliamentary buildings are meant to attract notice; the grander the structure, the stronger the public and national interest and reaction to them. Parliamentary buildings represent tradition, stability and authority; they embody an image, or the commanding presence, of the state. They often evoke ideals of national identity, pride and what Ivor Indyk calls ‘the discourse of power’.1 In notable cases they may also come to incorporate aspects of national memory. Consequently, the destruction of a parliamentary building has an impact going beyond the destruction of most other public buildings. The burning of the Reichstag building in 1933 is an historical instance, with ominous consequences for the German State.2 Splendour and command, even majesty, are clearly projected in the grandest of parliamentary buildings, especially those of the Nineteenth Century in Europe and South America. Just as the Byzantine emperors aimed to awe and even overwhelm the barbarian embassies visiting their courts by the effects of architectural splendour and 1 Indyk, I. ‘The Semiotics of the New Parliament House’, in Parliament House, Canberra: a Building for the Nation, ed. by Haig Beck, pp. 42–47. Sydney, Collins, 1988. 2 Contrary to general belief, the Reichstag building was not destroyed in the 1933 fire. The chamber was destroyed, but other parts of the building were left unaffected and the very large library continued to operate as usual. A lot of manipulated publicity by the Nazis surrounded the event. Full details can be found in Gerhard Hahn’s work cited at footnote 27. -

Erdverbunden Und Einfallsreich Lebenserinnerungen Des Sozialdemokraten Hans „Lumpi“ Lemp
Erdverbunden und einfallsreich Lebenserinnerungen des Sozialdemokraten Hans „Lumpi“ Lemp Lebenserinnerungen des Sozialdemokraten Hans „Lumpi“ Lemp ISBN 978-3-95861-499-4 Reihe Gesprächskreis Geschichte ISSN 0941-6862 und einfallsreich Erdverbunden Heft 106 Erdverbunden und einfallsreich Lebenserinnerungen des Sozialdemokraten Hans „Lumpi“ Lemp Gesprächskreis Geschichte Heft 106 Friedrich-Ebert-Stiftung Archiv der sozialen Demokratie GESPRÄCHSKREIS GESCHICHTE | HEFT 106 Herausgegeben von Anja Kruke und Meik Woyke Archiv der sozialen Demokratie Kostenloser Bezug beim Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung Email: [email protected] <http://library.fes.de/history/pub-history.html> © 2017 by Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn Eine gewerbliche Nutzung der von der Friedrich-Ebert-Stiftung herausgegebenen Medien ist ohne schriftliche Zustimmung der Herausgeberin nicht gestattet. Redaktion: Jens Hettmann, Patrick Böhm unter Mitarbeit von Helmut Herles Gestaltung und Satz: PAPYRUS – Lektorat + Textdesign, Buxtehude Umschlag: Pellens Kommunikationsdesign GmbH Druck: bub Bonner Universitäts-Buchdruckerei Bildmaterial: Soweit nicht anders vermerkt, stammen die hier verwendeten Fotos aus dem Familienbesitz Lemp; die Coverabbildung und die Abbildung auf S. 40 wurden uns von Volker Ernsting freundlicherweise kostenlos zur Verfügung gestellt; das Foto auf S. 22 haben wir unentgelt- lich von der Rechteinhaberin Nordphoto Vechta (Ferdinand Kokenge) erhalten. Eventuelle Rechte weiterer Dritter konnten nicht ermittelt werden. Für aufklärende -

Literaturverzeichnis
Literaturverzeichnis Jürgen Peter Schmied Sebastian Haffner Eine Biographie 683 Seiten, Gebunden ISBN: 978-3-406-60585-7 © Verlag C.H.Beck oHG, München Quellen- und Literaturverzeichnis I. Quellen A Ungedruckte Quellen 1. Akten Archiv der Humboldt Universität zu Berlin. Matrikelbuch, Rektorat, 600/116. Jur. Fak., Bd. 309. BBC Written Archive Centre, Reading. RCont 1, Sebastian Haffner File 1. Bundesarchiv. Personalakte Raimund Pretzel, R 3001, 71184. Personalakte Raimund Pretzel, ehemals BDC, RKK 2101, Box 0963, File 09. Bundesbehörde für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, Berlin. ZA, MfS – HA IX/11. AF Pressemappe. ZA, MfS – HA IX/11. AF Z I, Bd. 3. ZA, MfS – HA IX/11. AF N-II, Bd. 1, Bd. 2. ZA, MfS – F 16/HVA. ZA, MfS – F 22/HVA. National Archives, Kew. FO 371/24424 FO 371/26554 FO 371/106085 HO 334/219 INF 1/119 KV 2/1129 KV 2/1130 PREM 11/3357 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Berlin. B 8, Bd. 1498. B 11, Bd. 1019. 2 2. Nachlässe NL Konrad Adenauer Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus, Rhöndorf. NL Raymond Aron École des hautes études en sciences sociales, Paris. Centre de recherches politiques Raymond Aron. NL David Astor Privatbesitz. NL Margret Boveri Staatsbibliothek zu Berlin, Handschriftenabteilung. NL Willy Brandt Archiv der sozialen Demokratie. Friedrich-Ebert- Stiftung, Bonn. NL Eugen Brehm Institut für Zeitgeschichte, München. NL William Clark Bodleian Library, Oxford. Department of Special Col- lections and Western Manuscripts. NL Arthur Creech Jones Rhodes House Library, Oxford. NL Isaac Deutscher International Institute of Social History, Amsterdam. NL Sebastian Haffner Bundesarchiv. -

Archivbericht Quellen Zur Planung Des Verteidigungsbeitrages Der
Archivbericht Dieter Krüger / Dorothe Ganser Quellen zur Planung des Verteidigungsbeitrages der Bundesrepublik Deutschland 1950 bis 1955 in westdeutschen Archiven' Seit etwa 15 Jahren wendet sich die Zeitgeschichtsschreibung verstärkt der Frühphase der Bundesrepublik im Kontext der zeitgenössischen internationalen Entwicklung zu. Zwangs- läufig standen in diesen Jahren infolge des Krieges sozial-, wirtschafts- und finanzpolitische Fragen gegenüber der Sicherheitspolitik im Vordergrund der innenpolitischen Debatten und des Interesses der Bürger. Gleichwohl wurde nicht nur die Außen-, sondern auch die Innen- politik und die politische Kultur der frühen Bundesrepublik von der Auseinandersetzung um einen westdeutschen Verteidigungsbeitrag nachhaltig geprägt. So in etwa lautet die Quint- essenz der beiden ersten Bände der vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt herausgege- benen Reihe »Anfänge westdeutscher Sicherheitspolitik«'. Im Gegensatz zu diesen den aktuellen Forschungsstand wiedergebenden Bänden schöpften die nach wie vor wichtigen älteren Studien von Gerhard Wettig, Arnulf Baring, Edward Furs- don, Paul Noack, Gunther Mai und Klaus v. Schubert vorwiegend aus publizierten Quellen^. Von den jüngst erschienenen Arbeiten von Armand Glesse, Montecue Lowry und Rolf Stei- ninger führt eigentlich nur der letzte über den gegenwärtigen Stand hinaus^. Die nicht nur in der Bundesrepublik übliche Dreißig-Jahre-Sperrfrist für die Benutzung amt- licher Unterlagen"* erlaubt freilich mittlerweile die Benutzung und nicht zuletzt das Zitie- ren der -
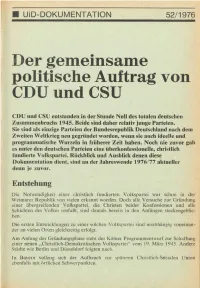
UID 1976 Nr. 52 Beilage
UiD-DOKUMENTATION 52/1976 Der gemeinsame politische Auftrag von CDU und CSU CDU und CSU entstanden in der Stunde Null des totalen deutschen Zusammenbruchs 1945. Beide sind daher relativ junge Parteien. Sie sind als einzige Parteien der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg neu gegründet worden, wenn sie auch ideelle und programmatische Wurzeln in früherer Zeit haben. Noch nie zuvor gab es unter den deutschen Parteien eine überkonfessionelle, christlich fundierte Volkspartei. Rückblick und Ausblick denen diese Dokumentation dient, sind an der Jahreswende 1976/77 aktueller denn je zuvor. Entstehung Die Notwendigkeit einer christlich fundierten Volkspartei war schon in der Weimarer Republik von vielen erkannt worden. Doch alle Versuche zur Gründung einer übergreifenden Volkspartei, die Christen beider Konfessionen und alle Schichten des Volkes umfaßt, sind damals bereits in den Anfängen steckengeblie- ben. Die ersten Entwicklungen zu einer solchen Volkspartei sind unabhängig voneinan- der an vielen Orten gleichzeitig erfolgt. Am Anfang der Gründungsphase steht der Kölner Programmentwurf zur Schaffung einerneuen „Christlich-Demokratischen Volkspartei"' vom 19. März 1945. Andere Städte wie Berlin und Düsseldorf folgten nach. In Bayern vollzog sich der Aufbruch zur späteren Christiich-Sozialen Union ebenfalls mit örtlichen Schwerpunkten. UiD-Dokumentation 52/76 Die Tatsache, daß es nicht zur Bildung einer einheitlichen Christlich Demokrati- schen Union gekommen ist, sondern in Bayern eine Schwesterpartei der CDU, die CSU, entstand, hat ihren Grund im starken bayerischen Traditionsbewußtsein. Schon in der Weimarer Republik gab es in Bayern eine eigene, politisch sehr bedeutende katholische Partei, die Bayerische Volkspartei. Deren Tradition setzt die CSU weitgehend fort. Überall in den deutschen Ländern vollzogen sich in den Sommermonaten des Jahres 1945 die Gründungen der neuen christlichen Partei.