Arbeitsmarktverwaltung in Der „Ostmark“ Von 1938 Bis 1945
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Vier Prinzen Zu Schaumburg-Lippe Und Das Parallele Unrechtssystem
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Institutional Repository of the Freie Universität Berlin Vier Prinzen zu Schaumburg-Lippe und das parallele Unrechtssystem Alexander vom Hofe Rechtsanwalt/Abogado VIERPRINZEN, S. L. Madrid, 2006 PEDIDOS/BESTELLUNGEN/ORDER: VIERPRINZEN, S. L. Avenida América, 8 www.vierprinzen.es E-28002 MADRID fax (0034)912354150 SPAIN email: [email protected] Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejem- plares de ella mediante alquiler o préstamo público. Título original:Vier Prinzen zu Schaumburg-Lippe und das parallele Unrechtssystem © Alexander vom Hofe © Esta edición VIERPRINZEN S. L.,Avenida América, 8, Madrid, E-28002 (España) Editado por VIERPRINZEN S.L.,Avenida América, 8, Madrid, E-28002 (España) © De la cubierta:Alexander vom Hofe Primera Edición Abril de 2006 Bibliographic information published by Die Deutsche Bibliothek Die Deutsche Bibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed biblio- graphic data are available in the Internet at http://dnb.ddb.de. Printed in Spain - Impreso en España ISBN: 84-609-8523-7 Depósito legal: M. 7.474-2006 Fotocomposición: INFORTEX,S.L. Impresión: CLOSAS-ORCOYEN,S.L. Polígono Igarsa. Paracuellos de Jarama (Madrid) "Es gibt keine Freiheit ohne Gerechtigkeit und keine Gerechtigkeit ohne Wahrheit." Simon Wiesenthal “Die gerechte Ordnung der Gesellschaft und des Staates ist zentraler Auftrag der Politik. Ein Staat, der nicht durch Gerechtigkeit definiert wäre, wäre nur eine große Räuberbande, wie Augustinus einmal sagte: Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia?” Aus der Enzyklika Deus Caritas Est von Papst Benedikt XVI. -
Verwaltungsreformen Im 18. Und 19. Jahrhundert
BEZIRKSVERWALTUNG in der Steiermark Viertel, Kreise und Bezirke Die Wurzeln der regionalen Verwaltung des Herzogtums bzw. Bundeslandes Steiermark reichen bis in das Mittelalter zurück. Die Grafschaften und Marken, die Landgerichte und Burg- friede der Städte und Märkte waren jedoch hauptsächlich Gerichtssprengel des Landesfürsten. Grundlage für eine politische Einteilung des Landes wurden im 15. Jahrhundert die räumlich genau abgrenzbaren Pfarren. Angesichts drohender Osmaneneinfälle und mangelnder Verteidigungsmaßnah- men seitens des Landesfürsten Kaiser Friedrich III. beschlossen die steirischen Landstände 1462 auf Basis der Seelsor- Viertelgrenzen und kirchliche Einteilung gesprengel eine neue militärische wie um 1500. HISTOR. ATLAS D. STMK. steuerliche Einteilung des Landes. Dieses Kaiser Friedrich III. wurde in vier Viertel geteilt, deren Gren- (1415–1493) zen sich allerdings noch mehrmals ändern sollten. 1516 folgte ein fünftes Viertel, so dass das Herzogtum die Viertel Judenburg, Enns- und Mürztal, Vorau, zwischen Mur und Drau (einschließlich des größten Teiles der Weststeiermark) sowie jenseits der Drau (Cillier Viertel) umfasste. An ihrer Spitze standen Hauptleute für das militärische Aufgebot und Viertelmeister zur Einhebung der Steuern. Verwaltungsreformen im 18. und 19. Jahrhundert Im Zuge der Verwaltungsreform unter Maria Theresia wurden 1748 in der Kreisgrenzen 1748–1848 und kirchliche Steiermark fünf Kreisämter einge- Einteilung um 1770. HISTOR. ATLAS D. STMK. richtet: Judenburg, Bruck, Graz (zuvor kurzfristig Hartberg), -

Ernst Langthaler – Publications and Lectures Before 2016*
Ernst Langthaler – publications and lectures before 2016* Monographs 1. Niederösterreich. Vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart, Innsbruck 2013, 220 pp. (with Stefan Eminger). 2. Zwangsarbeit in der Landwirtschaft in Niederösterreich und dem nördlichen Burgenland (Ver- öffentlichungen der Österreichischen Historikerkommission, vol. 26/3), Munich / Vienna 2004, 469 pp. (with Ela Hornung and Sabine Schweitzer). * Publications and lectures since 2016 are available at https://www.jku.at/institut-fuer-sozial-und- wirtschaftsgeschichte/institut/team/langthaler/ 1 Edited volumes 1. Kulinarische „Heimat“ und „Fremde“. Migration und Ernährung im 19. und 20. Jahrhundert (Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes 10), Innsbruck / Vienna / Bolzano 2014, 215 pp. (ed. with Lars Amenda). 2. Im Kleinen das Große suchen. Mikrogeschichte in Theorie und Praxis (Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes 9), Innsbruck / Vienna / Bolzano 2012, 290 pp. (ed. with Ewald Hiebl). 3. Globalgeschichte 1800-2010, Vienna / Cologne / Weimar 2010, 588 pp. (ed. with Reinhard Sieder). 2 4. Land-Arbeit. Arbeitsbeziehungen in ländlichen Gesellschaften Europas (17.-20. Jahrhundert) (Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes 5), Innsbruck / Vienna / Bozen 2010, 286 pp. (ed. with Rita Garstenauer and Erich Landsteiner). 5. Agrosystems and Labour Relations in European Rural Societies, Middle Ages - Twentieth Century (Rural History in Europe 3), Turnhout 2010, 218 pp. (ed. with Erich Landsteiner). 6. Niederösterreich im 20. Jahrhundert, vol. 1: Politik, Vienna / Cologne / Weimar 2008, 820 pp. (ed. with Stefan Eminger). 3 7. Niederösterreich im 20. Jahrhundert, vol. 2: Wirtschaft, Vienna / Cologne / Weimar 2008, 855 pp. (ed. with Peter Melichar and Stefan Eminger). 8. Niederösterreich im 20. Jahrhundert, vol. 3: Kultur, Vienna / Cologne / Weimar 2008, 659 pp. -

Wien NSDAP Und Staatliche Verwaltung
25 E‘ 3 Die NSDAP.- Gaule'itung Wien Sitz der Gauleitung: Wien I]1, Gauhaus, Joseph-Biirckel-Ring 3, Ruf 5 05 60. 10 Kreise, 315 Ortsgruppen. Gauleiter: Reichsleiter Baldur von Schirach, Ill, Gauhans, Joseph-Biimkel-Ring 3, Rui 'R5 05 60. Adjutant: Reichshauptstellenleiter Franz W i e s h 0 f e r, I/ 1, Gauhaus, Joseph-Biirckel-Ring 3, Ruf R 5 05 60. Stellvertretender Gauleiter: H-Brigadefiihrer Karl S e h a r i z e r, Ill, Gauhaus, Joseph-Biirckel-Ring 3, Ruf R 5 0'5 60. Adjutant: Gauhauptstellenleite'r Franz ‘E m h 0 f e r, Ill, Gauhaus, Joseph-Biirckel-Ring 3, Ruf R 5 05 60. Gauiimter: Amt fiir Kriegsopfer der NSDAP. (NSKOV.): Dr. Albrecht M a i e r. , Gaugeschaftsfiihrer: Heinrich L a u b e, I/1, Gauhaus, NSD.-Studentenbund: Hubert F r e i s l e b e n, Iii/66, Kolin- Rut R 5 05 60. _ ‘ - gasse 19, Ruf A 1 85 30. Gauins ektion I nnd H: Erich Rothe, Ill, Gauhaus, NSD.-D0zentenbnnd: Dr. Kurt K n 0 ll, Ill, Universitiit, Ru R 5 05 60. Ruf A 2 00 72. Gauorganis'ationsamt: Dr. Raimund GruB, I/1, Ganhaus, Ruf R 5 05 60. Amt fiir Technik (NS.-Bund Deutscher Technik):,Ingenieur Gaupersonalamt: mit der Leitung beauftragt: Emil Wilhelm A n s elm, I/1, Eschenbachgasse 9, Rut B 2 35 50. V 01k m e r, Ill, Gauhaus, Ruf R 5 05 60. Gaugericht: Dr. Karl N 0 s k 0, Ill, Gauhaus, Ruf R 5 05 60. -

Alpen Und Donau-Reichsgaue
leensuVonatkKeikhIgaue Das Gesetz vom 14. April 1939, R. G.Bl. 1 S. 777, führt als neue Verwaltungseinheit die Reichsgaue ein, an deren spitze die Reichsstatthalter stehen. Die Reichsgaue, die vorläufig nur in der Ostmark, 1m Sudeten- rebiet und den neu angegliederten Gebieten im Osten des Reiches bestehen, stellen die Verwirklichung des Grundsatzes von der Einheit in der Verwaltung dar, wodurch eine straffe Verwaltungsführung am besten gewährleistet ist. Sie sind auch die Verkörperung der Einheit von Partei und staat, da sie mit den Gauen der NSDAR territorial übereinstimmen und der Reichsstatthalter zugleich auch Gauleiter ist. Mit der Bildung der Reichsgaue fiel das Land Osterteich mit seiner Landesregierung endgültig weg- Aus der Ostmark wurden sieben Reichsgaue gebildet: Wien, Kärnten, Niederdonau, Oberdonau, Salzburg, Steier- mark und Tirol. Vorarlberg ist kein Reichsgau, bildet aber einen besonderen Verwaltungsbezirk und wird zusammen mit dem ReichsgauTirol verwaltet-. Jeder Reichsgau ist zugleich staatlicher Verwaltungsbezirk und selbstverwaltungsliorpeix Der an der Spitze stehende Reichsstatthalter führt nach fachlichen Weisungen der Reichsminister die staatliche Verwaltung und unter Aufsicht des Reichsmjnisters des lnnern die Selbstverwaltung in seinem Reichsgau; sein allgemeiner Vertreter in der staatlichen Verwaltung ist der Regierungspråisident, in der selbstverwaltung der Gauhauptmann. Der Reichsstatthalter ist jedoch nicht nur Beherdenleiter seiner eigenen Behörde, sondern auch Chef der ein- und angegliederten Sonder- verwaltungen und hat auch ein Informatious-, Initiativ- und Anweisungsrecht gegenüber den anderen nicht angeglie- derten Sonderverwaltungen und gegenüber allen öffentlich-rechtlichen Korporsehaften in seinem Reichsgau. Die Behörde des Itcichsstatthalters gliedert sieh in den Reichsgauen (mit Ausnahme von Wien) wie folgt: l. Abteilung für allgemeine und innere Verwaltung; Il. Abteilung für Erziehung, -Volksbild1mg, Kultur-— und Gemeinschaftspflegez Ill. -

Wolfgang Form / Ursula Schwarz Österreichische Opfer Der NS-Justiz
www.doew.at Namentliche Erfassung der Opfer politischer Verfolgung 1938–1945 Wolfgang Form / Ursula Schwarz Österreichische Opfer der NS-Justiz Seit den späten 1990er-Jahren erfolgten in Kooperation des Dokumentationsar- chivs des österreichischen Widerstandes und der Philipps-Universität Marburg erste ausführliche systematische Forschungen auf dem Gebiet NS-Justiz in Ös- terreich. Durch Gesamtdarstellungen der ÖsterreicherInnen betreffenden Urtei- le des Volksgerichtshofes, des Oberlandesgerichts Wien und, bedingt durch eine sehr dünne Quellenlage in geringerem Umfang, des Oberlandesgerichts Graz konnte erstmals für das „angeschlossene“ Österreich das Ausmaß sichtbar gemacht werden, das die NS-Justiz im Kampf gegen politische GegnerInnen beigetragen hatte.1 Zwischen 1938 und Kriegsende kamen mehr als 6300 Frau- en und Männer in die Mühlen der politischen Strafjustiz. Nach dem „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich im März 1938 organisierte das NS-Regime Teile des bestehenden Justizsystems neu. Dabei konnten die neuen Machthaber auf schon vor 1938 weit verbreitete großdeut- sche bzw. nationalsozialistische Sympathien von vielen Richtern und Staatsan- wälten zurückgreifen. Zur Durchsetzung der nationalsozialistischen Rechts- vorstellungen auf dem Gebiet des ehemaligen Österreich wurde auf bereits im „Altreich“ bewährte Methoden zurückgegriffen: personelle Säuberungen bzw. Durchsetzung der Justiz mit Parteigängern, politische Druckausübung und Beeinflussung der Richter, Eingriffe in die Rechtsprechung seitens der NSDAP sowie die Ausgrenzung ganzer Gruppen wie z. B. Jüdinnen und Juden aus Rechtsprechung und Justizverwaltung.2 Darüber hinaus wurde die deutsche Gerichtsorganisation übernommen, d. h. der Volksgerichtshof, die Besonderen Senate beim Oberlandesgericht, die Sondergerichte bei den Landgerichten, die 1 Wolfgang Form / Wolfgang Neugebauer / Theo Schiller (Hrsg.), NS-Justiz und politische Verfolgung in Österreich 1938 bis 1945. Analysen zu den Verfahren vor dem Volksgerichts- hof und vor dem Oberlandesgericht Wien, München 2006; dies. -

Die Ausstellung
2. Die Ausstellung Inhaltlicher Schwerpunkt der Ausstellung ist das Kulturleben und die Kulturpolitik in Oberösterreich in der NS-Zeit (1938-1945) in Betrachtung der Kontinuitäten respektive Brüche zur Zeit davor und Zeit danach. Die Ausstellung ist in zwei, auch räumlich voneinander getrennte, Teile strukturiert: Im ersten Teil der Ausstellung wird ein kulturpolitischer/ zeitgeschichtlicher Hintergrund geboten, im zweiten Teil auf das konkrete künstlerische Leben im „Gau Oberdonau “ in den Bereichen der bildenden Kunst, der Literatur, der Musik und des Theaters fokussiert. Ausstellungsteil I: Kulturpolitik/Zeitgeschichte „In Erwartung des Führers“ Gezeigt wird die Situation vor dem „Anschluss“ 1938: – Was verbindet Adolf Hitler mit Linz bzw. Oberösterreich? – Wie zeigt sich die (kultur-)politische Situation in Linz bzw. Oberösterreich vor 1938? – Welche Pläne hat der jugendliche Hitler mit seiner „Heimatstadt“? – Wie verändert sich die (Kultur-)politik in Deutschland seit Hitlers Machtergreifung? „Anschluss“ Gezeigt wird die (kultur-)politische Situation in Linz und Oberösterreich nach dem „Anschluss“ 1938. Dargestellt werden das Selbstbild des Gaus als „Heimatgau“ und der Stadt Linz als „Patenstadt“ des Führers. Dargestellt werden auch die konkreten Folgen des „Anschlusses“ auf das lokale Kulturleben, sowie die im „Abseits“ liegenden Facetten, Gegenüberstellung von „Schein“ und „Sein“, von Propaganda und Realität („Vorderseite“ – „Rückseite“). „Hitlers Linz“ Dargestellt werden die (architektonischen) Planungen, die Hitler für Linz in -

Stefan Eminger Ausländische Zwangsarbeit in Niederdonau Ein Überblick1
www.doew.at – Heinz Arnberger / Claudia Kuretsidis-Haider (Hg.): Gedenken und Mahnen in Niederösterreich. www.doew.at – Heinz Arnberger / Claudia Kuretsidis-Haider (Hg.): Gedenken und Mahnen in Niederösterreich. Erinnerungszeichen zu Widerstand, Verfolgung, Exil und Befreiung, mandelbaum verlag 2011 Erinnerungszeichen zu Widerstand, Verfolgung, Exil und Befreiung, mandelbaum verlag 2011 164 Ausländische Zwangsarbeit in Niederdonau 165 Stefan Eminger Ausländische Zwangsarbeit in Niederdonau Ein Überblick1 Vorbemerkung Vor einigen Jahren erwähnte ich im Rahmen einer Ausstellungseröffnung gegenüber einem Besucher meine berufsbedingte Einbindung in die Frage der „Entschädigung“ von Zwangs- arbeit. Sein fast reflexartig vorgebrachter Kommentar dazu lautete sinngemäß, dass es zwar auch im landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern Ausländer gegeben hätte, diese aber genauso wie die einheimischen Arbeitskräfte behandelt worden wären. Zumindest für den ländlichen Bereich schien meinem Gesprächspartner die Rede von „Zwangsarbeit“ überzo- gen. Etwa zur selben Zeit wurden damals in verschiedenen Medien immer wieder Berichte veröffentlicht, in denen die ausländischen Arbeitskräfte des NS-Staates pauschal als ge- schundene, ausgemergelte Häftlinge ins Bild gesetzt wurden. Beide Sichtweisen sind nicht zuletzt im Kontext der damals virulenten „Entschädigungsdebatte“ zu sehen2 und sie neh- men – relativierend im einen, legitimierend im anderen Fall – Bezug darauf. Darüber hin- aus verweisen sie auf die Endpunkte jenes breiten Spektrums des ausländischen „Arbeits- einsatzes“ während der NS-Zeit, das zwischen „Gastarbeit“ (privater Diskurs) und „Sklaven- arbeit“ (öffentlicher Diskurs) angesiedelt ist. Einleitung Der ehemalige Reichsgau Niederdonau hat im Vergleich zu den anderen Landesteilen der „Ostmark“ vom AusländerInneneinsatz überdurchschnittlich stark profitiert. An der Ge- samtzahl aller zivilen in- und ausländischen Beschäftigten in Niederdonau betrug der Anteil ziviler ausländischer Arbeitskräfte im Mai 1944 rund 30 %; das waren mehr als 144.000 Per- sonen. -
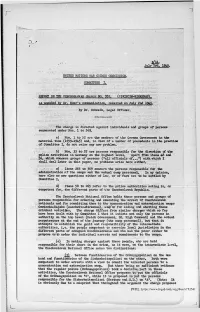
The Charge Is Directed Against Individuals and Groups of Persons Enumerated Under Nos
UNITED NATIONS VfAR CRUffiS COMMISSION. COMMITTEE I. REPORT ON THE CZECHOSLOVAK CHARGE NO. 952. (CS7IECIM~BIRKENAU). as amended by Dr. Ecei^s communication. received on July 2nd 1945. By Dr. Schwelb, Legal Officer. : The charge is directed against individuals and groups of persons enumerated under Nos. 1 to 369. a) Nos. 1 to3 2are the members of th e German Government in the material time (1939-1945) and, in view of a number of precedents in the practice of Conmittee I, do not raise any new problem. b) Nos. 33 to 57 are persons responsible for the direction of the police activities in Germany on the highest level. Apart from items 48 and 56, which concern groups of persons ("all officials of.,.") withwhich I shall deal later in this paper, no problems arise here either, o) Items 266 to 369 concern the persons responsible for the administration of the camps and the actual camp personnel. In my opinion, here also no new questions either of law, or of fact are to be settled by Committee I , d) Items 58 to 265 refer to the police authorities acting in, or oompetent for, the different parts of t he Czechoslovak Republic. The Czechoslovak National Office holds these persons and groups of persons responsible for ordering and executing the arrest of Czechoslovak n ation als and fo r committing them to the concentration and exterm ination camps Oswiecim-Rajsko (Auschwitz-Birkenau), awi/or for aiding and abetting these criminal activities. The charge differs from similar charges which so far have been dealt with by Cannittee I that it indicts not only the persons in authority on the top level (Reich Government, SS. -

Die Landesbühne Oberdonau in Braunau Am Inn
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OTHES DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Die Landesbühne Oberdonau in Braunau am Inn Ein Beitrag zur Stadt/Theater-Geschichte und Theaterpraxis im Nationalsozialismus Verfasserin Gertrude Elisabeth Stipschitz Angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2011 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 317 Studienrichtung lt. Studienblatt: Theater-, Film- und Medienwissenschaft Betreuerin Dr. Birgit Peter Meinem „Familienclan“ und posthum für Hans Inhaltsverzeichnis Vorwort 3 1 Einleitung 5 1.1 Material- und Quellenproblematik........................................................................... 15 1.2 „Reichsrechtliche“ Begrifflichkeiten und Terminologie.......................................... 25 2 Rechts- und Verwaltungsangleichung nach März 1938 31 2.1 Umgestaltungsprozesse und Zwangsmaßnahmen in der „ostmärkischen“ Theaterlandschaft ..................................................................................................... 32 2.2 Vorhaben und Planungen zur „Entprovinzialisierung der Provinz“ ........................ 36 2.3 „Selbstgleichschaltung“ am Vorabend des „Einmarsches“ ..................................... 39 2.4 „Gleichschaltung“ im Kulturbereich, eine Art „Machtergreifung von unten“......... 43 2.5 Verwaltungsstruktur im Kulturbereich auf Gauebene ............................................. 45 2.6 Ideologisch-theoretische Positionierungen auf Reichsebene ................................... 50 -

Ländliche Gesellschaft Im Nationalsozialismus Als »Lebenswelt« – Am Beispiel
Ernst Langthaler Ländliche Gesellschaft im Nationalsozialismus als »Lebenswelt« – am Beispiel der Erbhofgerichtsbarkeit St. Pölten 2013 Rural History Working Papers 17 Papers Working RuralHistory Publikationsort dieses Aufsatzes: Dietmar von Reeken/Malte Thießen (Hg.), "Volksgemeinschaft" vor Ort? Neue Forschungen zur sozialen Praxis im Nationalsozialismus, Paderborn 2013. Herausgeber: Institut für Geschichte des ländlichen Raumes (IGLR) Kulturbezirk 4, 3109 St. Pölten, Österreich Telefon: +43-(0)2742-9005-12987 Fax: +43-(0)2742-9005-16275 E-Mail: [email protected] Website: www.ruralhistory.at Ländliche Gesellschaft im Nationalsozialismus als »Lebenswelt« – am Beispiel der Erbhofgerichtsbarkeit Von Ernst Langthaler Forschungsparadigmen zwischen »System« und »Lebenswelt« Wenn wir uns vergegenwärtigen, wie sich die Geschichtswissenschaft in den vergangenen Jahrzehnten die Agrarpolitik, Landwirtschaft, ländliche Gesellschaft und dörfliche Kultur im Nationalsozialismus angeeignet hat, lassen sich drei – oder, präziser, zweieinhalb – Paradigmen der Forschung unterscheiden. Das erste, für die 1970er und 1980er Jahre charakteristische, im Kontext der Strukturgeschichte gebildete Paradigma, hob ab auf die nationalsozialistische Durchdringung von Agrarpolitik und Landwirtschaft auf nationaler und internationaler Ebene und deren Auswirkungen auf die ländliche Gesellschaft; ich nenne es das Nazifizierungs- Paradigma. Bevorzugte Forschungsgegenstände bildeten etwa die »Blut und Boden«-Ideologie, der Reichsnährstand, die Marktordnung, die -

NS-Gaue 07-2-578 Die NS-Gaue
NS-Gaue AUFSATZSAMMLUNGEN 07-2-578 Die NS-Gaue : regionale Mittelinstanzen im zentralistischen "Führerstaat" / hrsg. von Jürgen John ; Horst Möller ; Thomas Schaarschmidt. - München : Oldenbourg, 2007. - 483 S. : Ill., gr. Darst., Kt. : 24 cm. - (Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte : Sondernummer). - ISBN 978-3-486-58086-0 : EUR 69.80 [9419] Der Begriff „NS-Gaue“ im Haupttitel des Buches wirkt auf den ersten Blick unverfänglich, auf den zweiten aber nicht mehr, denn spätestens dann stellt sich die Frage, was mit NS-Gauen eigentlich genau gemeint ist. Die Her- ausgeber bzw. Autoren des anzuzeigenden Sammelbandes wollen mit dem Begriff NS-Gaue offenkundig den Versuch unternehmen, eine Vielzahl von komplizierten, sich teils überlappenden und überschneidenden organisatori- schen und (staats)rechtlichen Sachverhalten terminologisch zu bündeln und auf einen Nenner zu bringen. Der Gau war zunächst eine höhere regionale Gliederung („Hoheitsgebiet“) der NSDAP, die im Zuschnitt in etwa den Reichstagswahlkreisen im Altreich entsprach. Die Gebietserweiterungen 1938 (Österreich, Sudetenland) und 1939 (Ostgebiete) wurden als soge- nannte Reichsgaue organisiert, in denen der NSDAP-Parteigau und der staatliche Verwaltungsbezirk räumlich identisch waren und in aller Regel auch in Personalunion vom Gauleiter und Reichstatthalter geführt wurden. Das Reichsgaukonstrukt kam im Altreich de jure in der Westmark und de facto auch in Hamburg zur Anwendung. 1942 schließlich wurden sämtliche NSDAP-Gaue zugleich Reichsverteidigungsbezirke, ferner entsprachen die Gaugebiete mehrheitlich auch den Wirtschaftsbezirken. Für die drei räum- lich identischen, aber inhaltlich wohl zu unterscheidenden Gebilde Partei- gau, Reichsgau als staatlicher Verwaltungsbezirk und Reichsverteidigungs- bezirk ist „NS-Gau“ als umfassendes Kürzel keine schlechte Idee, sofern es denn tatsächlich nur in diesem umfassenden Sinne verwendet wird.