Das Weltwährungssystem Bis 1945
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

"Justiz Und Erinnerung" 4 / Mai 2001
Verein Verein zur Erforschung zur Förderung nationalsozialistischer justizgeschichtlicher Gewaltverbrechen und Forschungen ihrer Aufarbeitung A-1013 Wien, Pf. 298 A-1013 Wien, Pf. 298 Tel. 270 68 99, Fax 317 21 12 Tel. 315 4949, Fax 317 21 12 E-Mail: [email protected] oder E-Mail: [email protected] [email protected] Bankverbindung: Bank Austria 660 502 303 Bankverbindung: Bank Austria 660 501 909 JUSTIZ UND ERINNERUNG Hrsg. v. Verein zur Förderung justizgeschichtlicher Forschungen und Verein zur Erforschung nationalsozialistischer Gewaltverbrechen und ihrer Aufarbeitung vormals »Rundbrief« Nr. 4 / Mai 2001 Beiträge Gedenken an die Opfer von Engerau Claudia Kuretsidis-Haider Claudia Kuretsidis-Haider Am 25. Mai 1945 erging bei der Polizei im 3. Wiener Gedenken an die Opfer von Engerau .......... 1 Gemeindebezirk nachstehende »Anzeige gegen An- gehörige der SA im Judenlager Engerau«: Peter Gstettner »Als die SA das Judenlager in Engerau errich- Das KZ in der Lendorfer Kaserne tete, wurden ca. 2000 Juden (ungarische) in vor den Toren der Stadt Klagenfurt. das genannte Lager aufgenommen. An den Ju- Ein Vorschlag zur Geschichts- den wurden folgende Gewalttaten verübt: An- aufarbeitung und Erinnerung ................ 3 lässlich des Abmarsches Ende April 1945 aus dem Lager in der Richtung nach Deutsch Al- tenburg wurde ich als Wegführer bestimmt und Meinhard Brunner ging an der Spitze des Zuges. Hinter mir fand Ermittlungs- und Prozessakten eine wüste Schießerei statt bei der 102 Juden britischer Militärgerichte in Österreich den Tod fanden.« im Public Record Office ................... 12 Ein weiterer SA-Mann präzisierte diese Angaben: »Vom Ortskommandanten erhielt ich den Be- Sabine Loitfellner fehl alle Juden welche den Marsch nicht Arisierungen während der NS-Zeit durchhalten zu erschießen. -

Schweigen Und Erinnern Das Problem Nationalsozialismus Nach 1945
Alexander Pinwinkler und Thomas Weidenholzer (Hg.) Schweigen und erinnern Das Problem Nationalsozialismus nach 1945 Die Stadt Salzburg im Nationalsozialismus Herausgegeben von Peter F. Kramml, Sabine Veits-Falk, Thomas Weidenholzer und Ernst Hanisch Band 7 Schriftenreihe des Archivs der Stadt Salzburg 45 Peter F. Kramml Stadtplan der Stadt Salzburg aus 1 dem Jahr 1940. Ausschnitt mit nachträglicher Adolf-Hitler-Platz, Imberg, Kennzeichnung von NS-Namengut Gaismair-Hof . (Original und Repro: AStS). Um- und Neubenennungen öffentlicher Räume 2 im Zeichen der NS-Ideologie 1) Straße der SA 3 2) Imberg 3) Trompeter-Schlößl 4) Langemarck-Ufer 5) Hofstallgasse 6) Karl-Thomas-Burg 4 7) Georg-von- Zwei Jahre nach dem „Anschluß“ und ein Jahr nach der Durchführung Schönerer-Platz der zweiten großen Eingemeindung erschien im Jahr 1940 ein neuer, 5 vom Stadtbauamt herausgegebener Stadtplan der Gauhauptstadt Salz- 6 burg1, der jene Veränderungen des Namenguts dokumentiert, die die 7 neuen Machthaber bis dahin vollzogen hatten. Ein Blick auf diese Karte vermittelt Namen von Straßenzügen und auch Objektbezeichnungen, die sich von den heutigen deutlich unterscheiden. Namen wie das Kapuziner- Inhalte (Deutschtum im Ausland) besonders an. Auch vereinnahmte his- kloster und der Kapuzinerberg oder die Edmundsburg am Mönchsberg torische Gestalten, wie Paracelsus oder die „Helden“ des Bauernkriegs, waren ebenso verschwunden wie einige alte Straßennamen, darunter die wurden bemüht. Es erfolgte aber – wie auch in anderen Städten des Deut- Franziskanergasse, der Giselakai oder die Auerspergstraße. Neue waren schen Reiches – keine „ausschließliche Straßenstürmerei“ (M. Weidner) an ihre Stelle getreten, wie eine „Straße der SA“ oder das Langemarck- und zahlreichen Neubenennungen fehlt jeglicher NS-Bezug4. Es wurde Ufer. -

Peter Black Odilo Globocnik, Nazi Eastern Policy, and the Implementation of the Final Solution
www.doew.at – Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Hrsg.), Forschungen zum Natio- nalsozialismus und dessen Nachwirkungen in Österreich. Festschrift für Brigitte Bailer, Wien 2012 91 Peter Black Odilo Globocnik, Nazi Eastern Policy, and the Implementation of the Final Solution During the spring of 1943, while on an inspection tour of occupied Poland that included a briefing on the annihilation of the Polish Jews, SS Personnel Main Office chief Maximilian von Herff characterized Lublin District SS and Police Leader and SS-Gruppenführer Odilo Globocnik, in the following way: “A man fully charged with all possible light and dark sides. Little concerned with ap- pearances, fanatically obsessed with the task, [he] engages himself to the limit without concern for health or superficial recognition. His energy drives him of- ten to breach existing boundaries and to forget the boundaries established for him within the [SS-] Order – not out of personal ambition, but much more for the sake of his obsession with the matter at hand. His success speaks unconditionally for him.”1 Von Herff’s analysis of Globocnik’s reflected a consistent pattern in the ca- reer of the Nazi Party organizer and SS officer, who characteristically atoned for his transgressions of the National Socialist code of behavior by fanatical pursuit and implementation of core Nazi goals.2 Globocnik was born to Austro-Croat parents on April 21, 1904 in multina- tional Trieste, then the principal seaport of the Habsburg Monarchy. His father’s family had come from Neumarkt (Tržič), in Slovenia. Franz Globocnik served as a Habsburg cavalry lieutenant and later a senior postal official; he died of pneumonia on December 1, 1919. -
Verwaltungsreformen Im 18. Und 19. Jahrhundert
BEZIRKSVERWALTUNG in der Steiermark Viertel, Kreise und Bezirke Die Wurzeln der regionalen Verwaltung des Herzogtums bzw. Bundeslandes Steiermark reichen bis in das Mittelalter zurück. Die Grafschaften und Marken, die Landgerichte und Burg- friede der Städte und Märkte waren jedoch hauptsächlich Gerichtssprengel des Landesfürsten. Grundlage für eine politische Einteilung des Landes wurden im 15. Jahrhundert die räumlich genau abgrenzbaren Pfarren. Angesichts drohender Osmaneneinfälle und mangelnder Verteidigungsmaßnah- men seitens des Landesfürsten Kaiser Friedrich III. beschlossen die steirischen Landstände 1462 auf Basis der Seelsor- Viertelgrenzen und kirchliche Einteilung gesprengel eine neue militärische wie um 1500. HISTOR. ATLAS D. STMK. steuerliche Einteilung des Landes. Dieses Kaiser Friedrich III. wurde in vier Viertel geteilt, deren Gren- (1415–1493) zen sich allerdings noch mehrmals ändern sollten. 1516 folgte ein fünftes Viertel, so dass das Herzogtum die Viertel Judenburg, Enns- und Mürztal, Vorau, zwischen Mur und Drau (einschließlich des größten Teiles der Weststeiermark) sowie jenseits der Drau (Cillier Viertel) umfasste. An ihrer Spitze standen Hauptleute für das militärische Aufgebot und Viertelmeister zur Einhebung der Steuern. Verwaltungsreformen im 18. und 19. Jahrhundert Im Zuge der Verwaltungsreform unter Maria Theresia wurden 1748 in der Kreisgrenzen 1748–1848 und kirchliche Steiermark fünf Kreisämter einge- Einteilung um 1770. HISTOR. ATLAS D. STMK. richtet: Judenburg, Bruck, Graz (zuvor kurzfristig Hartberg), -

Arthur Seyß-Inquart Und Die Deutsche Besatzungspolitik in Den Niederlanden (1940-1945)
Arthur Seyß-Inquart und die deutsche Besatzungspolitik in den Niederlanden (1940-1945) Bearbeitet von Johannes Koll 1. Auflage 2015. Buch. 691 S. Hardcover ISBN 978 3 205 79660 2 Format (B x L): 17 x 24 cm Weitere Fachgebiete > Geschichte > Geschichtswissenschaft Allgemein > Biographien & Autobiographien: Historisch, Politisch, Militärisch Zu Inhaltsverzeichnis schnell und portofrei erhältlich bei Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte. Johannes Koll Arthur Seyß-Inquart und die deutsche Besatzungspolitik in den Niederlanden (1940–1945) 2015 BÖHLAU VERLAG · WIEN · KÖLN · WEIMAR Gedruckt mit Unterstützung durch die Gerda Henkel Stiftung, Düsseldorf das Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Wirtschaftsuniversität Wien Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://portal.dnb.de abrufbar. © 2015 by Böhlau Verlag GesmbH & Co.KG, Wien Köln Weimar Wiesingerstraße 1, A-1010 Wien, www.boehlau-verlag.com Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig. Korrektorat: Michael Suppanz, Klagenfurt Einbandgestaltung: Michael Haderer, Wien Satz: Bettina Waringer, Wien Druck und Bindung: Theiss, St. Stefan im Lavanttal Gedruckt auf chlor- und säurefreiem Papier Printed in the EU ISBN 978-3-205-79660-2 Inhalt Kapitel 1: Einleitung 13 1.1 Zielsetzung und Fragestellungen . 13 1.2 Forschungslage . 18 1.3 Quellenlage . -

Alpen Und Donau-Reichsgaue
leensuVonatkKeikhIgaue Das Gesetz vom 14. April 1939, R. G.Bl. 1 S. 777, führt als neue Verwaltungseinheit die Reichsgaue ein, an deren spitze die Reichsstatthalter stehen. Die Reichsgaue, die vorläufig nur in der Ostmark, 1m Sudeten- rebiet und den neu angegliederten Gebieten im Osten des Reiches bestehen, stellen die Verwirklichung des Grundsatzes von der Einheit in der Verwaltung dar, wodurch eine straffe Verwaltungsführung am besten gewährleistet ist. Sie sind auch die Verkörperung der Einheit von Partei und staat, da sie mit den Gauen der NSDAR territorial übereinstimmen und der Reichsstatthalter zugleich auch Gauleiter ist. Mit der Bildung der Reichsgaue fiel das Land Osterteich mit seiner Landesregierung endgültig weg- Aus der Ostmark wurden sieben Reichsgaue gebildet: Wien, Kärnten, Niederdonau, Oberdonau, Salzburg, Steier- mark und Tirol. Vorarlberg ist kein Reichsgau, bildet aber einen besonderen Verwaltungsbezirk und wird zusammen mit dem ReichsgauTirol verwaltet-. Jeder Reichsgau ist zugleich staatlicher Verwaltungsbezirk und selbstverwaltungsliorpeix Der an der Spitze stehende Reichsstatthalter führt nach fachlichen Weisungen der Reichsminister die staatliche Verwaltung und unter Aufsicht des Reichsmjnisters des lnnern die Selbstverwaltung in seinem Reichsgau; sein allgemeiner Vertreter in der staatlichen Verwaltung ist der Regierungspråisident, in der selbstverwaltung der Gauhauptmann. Der Reichsstatthalter ist jedoch nicht nur Beherdenleiter seiner eigenen Behörde, sondern auch Chef der ein- und angegliederten Sonder- verwaltungen und hat auch ein Informatious-, Initiativ- und Anweisungsrecht gegenüber den anderen nicht angeglie- derten Sonderverwaltungen und gegenüber allen öffentlich-rechtlichen Korporsehaften in seinem Reichsgau. Die Behörde des Itcichsstatthalters gliedert sieh in den Reichsgauen (mit Ausnahme von Wien) wie folgt: l. Abteilung für allgemeine und innere Verwaltung; Il. Abteilung für Erziehung, -Volksbild1mg, Kultur-— und Gemeinschaftspflegez Ill. -
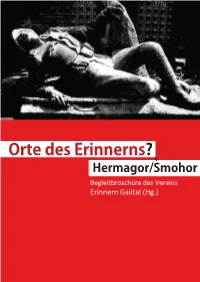
Im PDF-Format Lesen
Orte des Erinnerns? Hermagor/Smohor Begleitbroschüre des Vereins Erinnern Gailtal (Hg.) Orte des Erinnerns? Hermagor/Šmohor Inhalt und Gestaltung: Daniel Jamritsch, Bernhard Gitschtaler Wien-Hermagor, 2013 Online: www.erinnern-gailtal.at Kontakt und Anmeldungen für Führungen: [email protected] Dauer der Führung: ca. 1,5-2 Stunden Gedruckt mit Mitteln des Zukunftsfonds der Republik Österreich Einleitung Die herrschende Erinnerungskultur im Raum Hermagor/Šmohor und dem Gailtal ist geprägt von einer Schräglage, die die Opfer des Nationalsozialismus aus dem kollektiven Gedächtnis ausklammert, während den gefallenen Wehrmachts- und SS-Soldaten seit jeher viel Platz im kollektiven Gedächtnis eingeräumt wird. In beinahe jedem Ort des Gailtales findet der/die BesucherIn ein Kriegerdenkmal, das nicht nur den Soldaten des Ersten Weltkrieges gedenkt, sondern auch jenen des sogenannten „Kärntner Abwehrkampfes“ sowie des Zweiten Weltkrieges – eine kritisch-historische Aufarbeitung von Nationalsozialismus und Deutschnationalismus existiert in der Gailtaler Denkmallandschaft nicht. Damit einher geht nicht nur das Ausradieren der zahlreichen NS-Opfer aus der regionalen Gedenkkultur, sondern auch die bewusste Bagatellisierung oder Verleugnung der nationalsozialistischen und deutschnationalen Verbrechen in der jüngsten Vergangenheit Kärntens. Mit dem Erinnern-Stadtspaziergang möchten wir interessierten Stadt- und TalbesucherInnen Hinweise für einen kritischen Blick auf die Gailtaler Denkmallandschaft und Impulse zur Etablierung einer anderen Erinnerungskultur -

Stefan Eminger Ausländische Zwangsarbeit in Niederdonau Ein Überblick1
www.doew.at – Heinz Arnberger / Claudia Kuretsidis-Haider (Hg.): Gedenken und Mahnen in Niederösterreich. www.doew.at – Heinz Arnberger / Claudia Kuretsidis-Haider (Hg.): Gedenken und Mahnen in Niederösterreich. Erinnerungszeichen zu Widerstand, Verfolgung, Exil und Befreiung, mandelbaum verlag 2011 Erinnerungszeichen zu Widerstand, Verfolgung, Exil und Befreiung, mandelbaum verlag 2011 164 Ausländische Zwangsarbeit in Niederdonau 165 Stefan Eminger Ausländische Zwangsarbeit in Niederdonau Ein Überblick1 Vorbemerkung Vor einigen Jahren erwähnte ich im Rahmen einer Ausstellungseröffnung gegenüber einem Besucher meine berufsbedingte Einbindung in die Frage der „Entschädigung“ von Zwangs- arbeit. Sein fast reflexartig vorgebrachter Kommentar dazu lautete sinngemäß, dass es zwar auch im landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern Ausländer gegeben hätte, diese aber genauso wie die einheimischen Arbeitskräfte behandelt worden wären. Zumindest für den ländlichen Bereich schien meinem Gesprächspartner die Rede von „Zwangsarbeit“ überzo- gen. Etwa zur selben Zeit wurden damals in verschiedenen Medien immer wieder Berichte veröffentlicht, in denen die ausländischen Arbeitskräfte des NS-Staates pauschal als ge- schundene, ausgemergelte Häftlinge ins Bild gesetzt wurden. Beide Sichtweisen sind nicht zuletzt im Kontext der damals virulenten „Entschädigungsdebatte“ zu sehen2 und sie neh- men – relativierend im einen, legitimierend im anderen Fall – Bezug darauf. Darüber hin- aus verweisen sie auf die Endpunkte jenes breiten Spektrums des ausländischen „Arbeits- einsatzes“ während der NS-Zeit, das zwischen „Gastarbeit“ (privater Diskurs) und „Sklaven- arbeit“ (öffentlicher Diskurs) angesiedelt ist. Einleitung Der ehemalige Reichsgau Niederdonau hat im Vergleich zu den anderen Landesteilen der „Ostmark“ vom AusländerInneneinsatz überdurchschnittlich stark profitiert. An der Ge- samtzahl aller zivilen in- und ausländischen Beschäftigten in Niederdonau betrug der Anteil ziviler ausländischer Arbeitskräfte im Mai 1944 rund 30 %; das waren mehr als 144.000 Per- sonen. -

Le Serment De Fidélité À Hitler Selon Ernst Kaltenbrunner, Un Nazi Autrichien « Illégal » Devenu Chef Du Reichssicherheitshauptamt (1943-1945)
Le serment de fidélité à Hitler selon Ernst Kaltenbrunner, un nazi autrichien « illégal » devenu chef du Reichssicherheitshauptamt (1943-1945) Marie-Bénédicte Vincent L’auteur Marie-Bénédicte Vincent est maître de conférences en histoire contemporaine à l’École normale supérieure (Paris). Chercheuse à l’Institut d’histoire moderne et contemporaine (IHMC), ses travaux récents portent sur l’histoire de la dénazification en Allemagne après 1945. Elle a notamment co-dirigé en 2019 : Marc Bergère, Jonas Campion, Emmanuel Droit, Dominik Rigoll, Marie-Bénédicte Vincent (dir.), Pour une histoire connectée et transnationale des épurations en Europe après 1945 (Bruxelles, Peter Lang, 2019) ; Corine Defrance, Sébastien Chauffour, Stefan Martens, Marie- Bénédicte Vincent (dir.), La France et la dénazification de l’Allemagne après 1945 (Bruxelles, Peter Lang, 2019). Résumé L’article analyse la conception du serment de fidélité du nazi autrichien Ernst Kaltenbrunner (1903-1946), qui fut le successeur de Heydrich à la tête du Reichssicherheitshauptamt à partir du 30 janvier 1943. Ce haut dignitaire du régime, condamné à mort en 1946 lors du procès de Nuremberg, est moins étudié que d’autres criminels nazis. L’article examine dans un premier temps la manière dont Kaltenbrunner érige le serment de fidélité au Führer en valeur suprême du combattant nazi, dans ses rapports secrets consacrés à l’enquête de police diligentée après l’attentat manqué contre Hitler du 20 juillet 1944. Dans un second temps, l’article revient sur la trajectoire en amont de Kaltenbrunner au sein du parti nazi autrichien, notamment durant la période « illégale » où celui-ci fut interdit entre le 19 juin 1933 et l’Anschluss du 12 mars 1938. -

Univerzita Karlova Disertační Práce Mgr. Jan Zumr Analýza Činnosti Allgemeine-SS V Dolních Rakousích V Letech 1932-1945 A
Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav světových dějin Historické vědy Historie – Obecné dějiny Disertační práce Mgr. Jan Zumr Analýza činnosti Allgemeine-SS v Dolních Rakousích v letech 1932-1945 Analysis of the activities of Allgemeine-SS in Lower Austria in the years 1932-1945 Vedoucí práce: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. 2017 Prohlašuji, že jsem disertační práci napsal samostatně s využitím pouze uvedených a řádně citovaných pramenů a literatury a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu. V Sobotce, dne 28. června 2017 Mgr. Jan Zumr 2 Abstrakt Disertační práce se zabývá zkoumáním role, jakou sehrála SS, resp. Allgemeine- SS, v Dolních Rakousích a v Říšské župě Dolní Podunají od svého vzniku na počátku třicátých let až po konec druhé světové války. Cílem je zanalyzování její činnosti, struktury a personálního obsazení. Její historie vykazovala řadu shodných rysů s dějinami SS v ostatních rakouských spolkových zemích i v samotném Německu, zároveň se zde ale objevovala místní specifika. V Dolních Rakousích/Dolním Podunají měla SS, v závislosti na konkrétním roce, druhý nejvyšší nebo vůbec nejvyšší počet příslušníků v celém Rakousku. Při přepočtu na obyvatele tomu ale bylo přesně naopak. Při srovnání se situací ve „staré říši“ vykazovala taktéž podprůměrné počty esesmanů. Tento fakt spočíval v geografickém charakteru a sociální sktruktuře obyvatel země, jehož převážně katolicky konzervativní obyvatelstvo žijící na nížinatém venkově vykazovala vyšší rezistenci vůči vstupu do SS než evangelíci či katolíci žijící v horách. Specifická byla situace na jižní Moravě a jihovýchodním cípu Čech, připojených k Dolnímu Podunají v říjnu 1938. Zde, stejně jako v celém bývalém československém pohraničí, byl počet příslušníků Allgemeine-SS v přepočtu na obyvatele třikrát větší, než kolik činil průměr. -
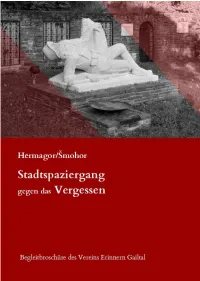
Im PDF-Format Lesen
1 Verein Erinnern Gailtal „Stadtspaziergang gegen das Vergessen“ 2 Verein Erinnern Gailtal www.erinnern-gailtal.at 3 Hermagor/Šmohor: Orte des Erinnerns? Die herrschende Erinnerungskultur im Raum Hermagor/Šmohor ist geprägt von einer Schräglage. Während den gefallenen Wehrmachts- und SS-Soldaten seit jeher viel Platz im kollektiven Gedächtnis eingeräumt wird, existiert eine kritisch-historische Aufarbeitung über die regionale Mitverantwortung an den NS-Verbrechen – von denen es auch im Gailtal unzählige gab – nicht. Ein Denkmal für die NS-Opfer im und aus dem Gailtal sucht man nach wie vor vergebens. Aber in beinahe jedem Ort des Gailtales findet der/die BesucherIn ein Kriegerdenkmal, welches nicht nur den Soldaten des Ersten Weltkrieges gedenkt, sondern auch jenen des sogenannten „Kärntner Abwehrkampfes“ sowie des Zweiten Weltkrieges, als man nicht für Österreich, sondern für Hitlerdeutschland kämpfte und starb. Damit einher geht nicht nur das Ausradieren der zahlreichen NS-Opfer aus der regionalen Gedenkkultur, sondern auch die bewusste Bagatellisierung oder Verleugnung der nationalsozialistischen und deutschnationalen Verbrechen. Mit den 2013 ins Leben gerufenen Stadtspaziergängen gegen das Vergessen wird ein kritischer Blick auf die Gailtaler Denkmallandschaft und ein Impuls zur Etablierung einer anderen, ausgewogenen Erinnerungskultur geboten. Es ist eine unbequeme Tatsache, dass sich NS-Gräuel nicht in fernab gelegenen Gebieten und Städten des „Dritten Reiches“ zugetragen haben, sondern auch in unserer kleinen Bezirkshauptstadt. Eine kritisch-historische Betrachtung Hermagors verlangt nicht nur eine Auseinandersetzung mit der Geschichte alleine um der Geschichte willen, sondern sie muss vor allem ein Licht auf problematische Kontinuitäten und aktuelle Missstände werfen, welche mit der nicht-aufgearbeiteten Regionalgeschichte unmittelbar verbunden sind. Erinnern bedeutet auch Handeln. -

NS-Gaue 07-2-578 Die NS-Gaue
NS-Gaue AUFSATZSAMMLUNGEN 07-2-578 Die NS-Gaue : regionale Mittelinstanzen im zentralistischen "Führerstaat" / hrsg. von Jürgen John ; Horst Möller ; Thomas Schaarschmidt. - München : Oldenbourg, 2007. - 483 S. : Ill., gr. Darst., Kt. : 24 cm. - (Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte : Sondernummer). - ISBN 978-3-486-58086-0 : EUR 69.80 [9419] Der Begriff „NS-Gaue“ im Haupttitel des Buches wirkt auf den ersten Blick unverfänglich, auf den zweiten aber nicht mehr, denn spätestens dann stellt sich die Frage, was mit NS-Gauen eigentlich genau gemeint ist. Die Her- ausgeber bzw. Autoren des anzuzeigenden Sammelbandes wollen mit dem Begriff NS-Gaue offenkundig den Versuch unternehmen, eine Vielzahl von komplizierten, sich teils überlappenden und überschneidenden organisatori- schen und (staats)rechtlichen Sachverhalten terminologisch zu bündeln und auf einen Nenner zu bringen. Der Gau war zunächst eine höhere regionale Gliederung („Hoheitsgebiet“) der NSDAP, die im Zuschnitt in etwa den Reichstagswahlkreisen im Altreich entsprach. Die Gebietserweiterungen 1938 (Österreich, Sudetenland) und 1939 (Ostgebiete) wurden als soge- nannte Reichsgaue organisiert, in denen der NSDAP-Parteigau und der staatliche Verwaltungsbezirk räumlich identisch waren und in aller Regel auch in Personalunion vom Gauleiter und Reichstatthalter geführt wurden. Das Reichsgaukonstrukt kam im Altreich de jure in der Westmark und de facto auch in Hamburg zur Anwendung. 1942 schließlich wurden sämtliche NSDAP-Gaue zugleich Reichsverteidigungsbezirke, ferner entsprachen die Gaugebiete mehrheitlich auch den Wirtschaftsbezirken. Für die drei räum- lich identischen, aber inhaltlich wohl zu unterscheidenden Gebilde Partei- gau, Reichsgau als staatlicher Verwaltungsbezirk und Reichsverteidigungs- bezirk ist „NS-Gau“ als umfassendes Kürzel keine schlechte Idee, sofern es denn tatsächlich nur in diesem umfassenden Sinne verwendet wird.