Schweigen Und Erinnern Das Problem Nationalsozialismus Nach 1945
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

"Justiz Und Erinnerung" 4 / Mai 2001
Verein Verein zur Erforschung zur Förderung nationalsozialistischer justizgeschichtlicher Gewaltverbrechen und Forschungen ihrer Aufarbeitung A-1013 Wien, Pf. 298 A-1013 Wien, Pf. 298 Tel. 270 68 99, Fax 317 21 12 Tel. 315 4949, Fax 317 21 12 E-Mail: [email protected] oder E-Mail: [email protected] [email protected] Bankverbindung: Bank Austria 660 502 303 Bankverbindung: Bank Austria 660 501 909 JUSTIZ UND ERINNERUNG Hrsg. v. Verein zur Förderung justizgeschichtlicher Forschungen und Verein zur Erforschung nationalsozialistischer Gewaltverbrechen und ihrer Aufarbeitung vormals »Rundbrief« Nr. 4 / Mai 2001 Beiträge Gedenken an die Opfer von Engerau Claudia Kuretsidis-Haider Claudia Kuretsidis-Haider Am 25. Mai 1945 erging bei der Polizei im 3. Wiener Gedenken an die Opfer von Engerau .......... 1 Gemeindebezirk nachstehende »Anzeige gegen An- gehörige der SA im Judenlager Engerau«: Peter Gstettner »Als die SA das Judenlager in Engerau errich- Das KZ in der Lendorfer Kaserne tete, wurden ca. 2000 Juden (ungarische) in vor den Toren der Stadt Klagenfurt. das genannte Lager aufgenommen. An den Ju- Ein Vorschlag zur Geschichts- den wurden folgende Gewalttaten verübt: An- aufarbeitung und Erinnerung ................ 3 lässlich des Abmarsches Ende April 1945 aus dem Lager in der Richtung nach Deutsch Al- tenburg wurde ich als Wegführer bestimmt und Meinhard Brunner ging an der Spitze des Zuges. Hinter mir fand Ermittlungs- und Prozessakten eine wüste Schießerei statt bei der 102 Juden britischer Militärgerichte in Österreich den Tod fanden.« im Public Record Office ................... 12 Ein weiterer SA-Mann präzisierte diese Angaben: »Vom Ortskommandanten erhielt ich den Be- Sabine Loitfellner fehl alle Juden welche den Marsch nicht Arisierungen während der NS-Zeit durchhalten zu erschießen. -

Camilla Da Dalt, the Case of Morpurgo De Nilma's Art Collection in Trieste
STUDI DI MEMOFONTE Rivista on-line semestrale Numero 22/2019 FONDAZIONE MEMOFONTE Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche www.memofonte.it COMITATO REDAZIONALE Proprietario Fondazione Memofonte onlus Fondatrice Paola Barocchi Direzione scientifica Donata Levi Comitato scientifico Francesco Caglioti, Barbara Cinelli, Flavio Fergonzi, Margaret Haines, Donata Levi, Nicoletta Maraschio, Carmelo Occhipinti Cura scientifica Daria Brasca, Christian Fuhrmeister, Emanuele Pellegrini Cura redazionale Martina Nastasi, Laurence Connell Segreteria di redazione Fondazione Memofonte onlus, via de’ Coverelli 2/4, 50125 Firenze [email protected] ISSN 2038-0488 INDICE The Transfer of Jewish-owned Cultural Objects in the Alpe Adria Region DARIA BRASCA, CHRISTIAN FUHRMEISTER, EMANUELE PELLEGRINI Introduction p. 1 VICTORIA REED Museum Acquisitions in the Era of the Washington Principles: Porcelain from the Emma Budge Estate p. 9 GISÈLE LÉVY Looting Jewish Heritage in the Alpe Adria Region. Findings from the Union of the Italian Jewish Communities (UCEI) Historical Archives p. 28 IVA PASINI TRŽEC Contentious Musealisation Process(es) of Jewish Art Collections in Croatia p. 41 DARIJA ALUJEVIĆ Jewish-owned Art Collections in Zagreb: The Destiny of the Robert Deutsch Maceljski Collection p. 50 ANTONIJA MLIKOTA The Destiny of the Tilla Durieux Collection after its Transfer from Berlin to Zagreb p. 64 DARIA BRASCA The Dispossession of Italian Jews: the Fate of Cultural Property in the Alpe Adria Region during Second World War p. 79 CAMILLA DA DALT The Case of Morpurgo De Nilma’s Art Collection in Trieste: from a Jewish Legacy to a ‘German Donation’ p. 107 CRISTINA CUDICIO The Dissolution of a Jewish Collection: the Pincherle Family in Trieste p. -

Die Stadt Salzburg 1939
Die Stadt Salzburg im Jahr 1939 Zeitungsdokumentation von S. Göllner Die Stadt Salzburg 1939 Zeitungsdokumentation zusammengestellt auf Basis zeitgenössischer Tageszeitungen von Siegfried Göllner Berücksichtigte Tageszeitungen: Salzburger Volksblatt: SVB Salzburger Landeszeitung: SLZ 1 Die Stadt Salzburg im Jahr 1939 Zeitungsdokumentation von S. Göllner Berichte zum Dezember 1938 und Statistiken 1938 31.12.1938 Empfang beim Oberbürgermeister. Unter Führung von Magistratsdirektor Emanuel Jenal finden sich alle städtischen Amtsleiter bei Oberbürgermeister Giger ein, der eine Neujahrsansprache hält. (Teilweiser Abdruck im SVB). SVB, 2.1.1939, S. 7. SLZ, 2.1.1939, S. 6. 31.12.1938 Studenten-Reisegruppe. 84 Studenten aus verschiedenen Ländern besuchen Salzburg im Rahmen ihres Aufenthaltes in Berchtesgaden. SVB, 2.1.1939, S. 8. SLZ, 2.1.1939, S. 7. 31.12.1938 Bilanz Brandschadenversicherung. Die Salzburger Landes-Brandschaden-Versicherungs-Anstalt legt ihre Jahresbilanz 1938 vor. SLZ, 10.11.1939, S. 7. 31.12.1938 Scheidungen zweites Halbjahr. Das neue Eherecht brachte einen sprunghaften Anstieg der Scheidungen im Land Salzburg. Im zweiten Halbjahr 1938 wurden beim Salzburger Landesgericht 313 Ehescheidungsklagen eingebracht (1937: 71). Juli 26 (1937: 11), August 30 (3), September 56 (9), Oktober 88 (16), November 55 (16), Dezember 57 (16). SVB, 10.1.1939, S. 8. SLZ, 9.1.1939, S. 7. 31.12.1938 Bevölkerungsentwicklung viertes Quartal. Das SVB veröffentlicht eine Statistik über die Bevölkerungsentwicklung von Oktober- Dezember 1938 in der Stadt Salzburg. 347 Todesfällen stehen 291 Geburten (davon 64 unehelich) gegenüber. Im gesamten Jahr 1938 gab es 1.327 Todesfälle und 1.036 Geburten. SVB, 22.2.1939, S. 5. 2 Die Stadt Salzburg im Jahr 1939 Zeitungsdokumentation von S. -

Berger ENG Einseitig Künstlerisch
„One-sidedly Artistic“ Georg Kolbe in the Nazi Era By Ursel Berger 0 One of the most discussed topics concerning Georg Kolbe involves his work and his stance during the Nazi era. These questions have also been at the core of all my research on Kolbe and I have frequently dealt with them in a variety of publications 1 and lectures. Kolbe’s early work and his artistic output from the nineteen twenties are admired and respected. Today, however, a widely held position asserts that his later works lack their innovative power. This view, which I also ascribe to, was not held by most of Kolbe’s contemporaries. In order to comprehend the position of this sculptor as well as his overall historical legacy, it is necessary, indeed crucial, to examine his œuvre from the Nazi era. It is an issue that also extends over and beyond the scope of a single artistic existence and poses the overriding question concerning the role of the artist in a dictatorship. Georg Kolbe was born in 1877 and died in 1947. He lived through 70 years of German history, a time characterized by the gravest of political developments, catastrophes and turning points. He grew up in the German Empire, celebrating his first artistic successes around 1910. While still quite young, he was active (with an artistic mission) in World War I. He enjoyed his greatest successes in the Weimar Republic, especially in the latter half of the nineteen twenties—between hyperinflation and the Great Depression. He was 56 years old when the Nazis came to power in 1933 and 68 years old when World War II ended in 1945. -

Peter Black Odilo Globocnik, Nazi Eastern Policy, and the Implementation of the Final Solution
www.doew.at – Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Hrsg.), Forschungen zum Natio- nalsozialismus und dessen Nachwirkungen in Österreich. Festschrift für Brigitte Bailer, Wien 2012 91 Peter Black Odilo Globocnik, Nazi Eastern Policy, and the Implementation of the Final Solution During the spring of 1943, while on an inspection tour of occupied Poland that included a briefing on the annihilation of the Polish Jews, SS Personnel Main Office chief Maximilian von Herff characterized Lublin District SS and Police Leader and SS-Gruppenführer Odilo Globocnik, in the following way: “A man fully charged with all possible light and dark sides. Little concerned with ap- pearances, fanatically obsessed with the task, [he] engages himself to the limit without concern for health or superficial recognition. His energy drives him of- ten to breach existing boundaries and to forget the boundaries established for him within the [SS-] Order – not out of personal ambition, but much more for the sake of his obsession with the matter at hand. His success speaks unconditionally for him.”1 Von Herff’s analysis of Globocnik’s reflected a consistent pattern in the ca- reer of the Nazi Party organizer and SS officer, who characteristically atoned for his transgressions of the National Socialist code of behavior by fanatical pursuit and implementation of core Nazi goals.2 Globocnik was born to Austro-Croat parents on April 21, 1904 in multina- tional Trieste, then the principal seaport of the Habsburg Monarchy. His father’s family had come from Neumarkt (Tržič), in Slovenia. Franz Globocnik served as a Habsburg cavalry lieutenant and later a senior postal official; he died of pneumonia on December 1, 1919. -

Arthur Seyß-Inquart Und Die Deutsche Besatzungspolitik in Den Niederlanden (1940-1945)
Arthur Seyß-Inquart und die deutsche Besatzungspolitik in den Niederlanden (1940-1945) Bearbeitet von Johannes Koll 1. Auflage 2015. Buch. 691 S. Hardcover ISBN 978 3 205 79660 2 Format (B x L): 17 x 24 cm Weitere Fachgebiete > Geschichte > Geschichtswissenschaft Allgemein > Biographien & Autobiographien: Historisch, Politisch, Militärisch Zu Inhaltsverzeichnis schnell und portofrei erhältlich bei Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte. Johannes Koll Arthur Seyß-Inquart und die deutsche Besatzungspolitik in den Niederlanden (1940–1945) 2015 BÖHLAU VERLAG · WIEN · KÖLN · WEIMAR Gedruckt mit Unterstützung durch die Gerda Henkel Stiftung, Düsseldorf das Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Wirtschaftsuniversität Wien Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://portal.dnb.de abrufbar. © 2015 by Böhlau Verlag GesmbH & Co.KG, Wien Köln Weimar Wiesingerstraße 1, A-1010 Wien, www.boehlau-verlag.com Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig. Korrektorat: Michael Suppanz, Klagenfurt Einbandgestaltung: Michael Haderer, Wien Satz: Bettina Waringer, Wien Druck und Bindung: Theiss, St. Stefan im Lavanttal Gedruckt auf chlor- und säurefreiem Papier Printed in the EU ISBN 978-3-205-79660-2 Inhalt Kapitel 1: Einleitung 13 1.1 Zielsetzung und Fragestellungen . 13 1.2 Forschungslage . 18 1.3 Quellenlage . -
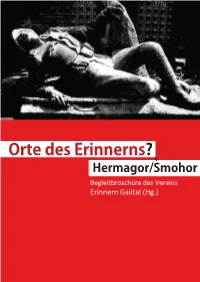
Im PDF-Format Lesen
Orte des Erinnerns? Hermagor/Smohor Begleitbroschüre des Vereins Erinnern Gailtal (Hg.) Orte des Erinnerns? Hermagor/Šmohor Inhalt und Gestaltung: Daniel Jamritsch, Bernhard Gitschtaler Wien-Hermagor, 2013 Online: www.erinnern-gailtal.at Kontakt und Anmeldungen für Führungen: [email protected] Dauer der Führung: ca. 1,5-2 Stunden Gedruckt mit Mitteln des Zukunftsfonds der Republik Österreich Einleitung Die herrschende Erinnerungskultur im Raum Hermagor/Šmohor und dem Gailtal ist geprägt von einer Schräglage, die die Opfer des Nationalsozialismus aus dem kollektiven Gedächtnis ausklammert, während den gefallenen Wehrmachts- und SS-Soldaten seit jeher viel Platz im kollektiven Gedächtnis eingeräumt wird. In beinahe jedem Ort des Gailtales findet der/die BesucherIn ein Kriegerdenkmal, das nicht nur den Soldaten des Ersten Weltkrieges gedenkt, sondern auch jenen des sogenannten „Kärntner Abwehrkampfes“ sowie des Zweiten Weltkrieges – eine kritisch-historische Aufarbeitung von Nationalsozialismus und Deutschnationalismus existiert in der Gailtaler Denkmallandschaft nicht. Damit einher geht nicht nur das Ausradieren der zahlreichen NS-Opfer aus der regionalen Gedenkkultur, sondern auch die bewusste Bagatellisierung oder Verleugnung der nationalsozialistischen und deutschnationalen Verbrechen in der jüngsten Vergangenheit Kärntens. Mit dem Erinnern-Stadtspaziergang möchten wir interessierten Stadt- und TalbesucherInnen Hinweise für einen kritischen Blick auf die Gailtaler Denkmallandschaft und Impulse zur Etablierung einer anderen Erinnerungskultur -

Filming the End of the Holocaust War, Culture and Society
Filming the End of the Holocaust War, Culture and Society Series Editor: Stephen McVeigh, Associate Professor, Swansea University, UK Editorial Board: Paul Preston LSE, UK Joanna Bourke Birkbeck, University of London, UK Debra Kelly University of Westminster, UK Patricia Rae Queen’s University, Ontario, Canada James J. Weingartner Southern Illimois University, USA (Emeritus) Kurt Piehler Florida State University, USA Ian Scott University of Manchester, UK War, Culture and Society is a multi- and interdisciplinary series which encourages the parallel and complementary military, historical and sociocultural investigation of 20th- and 21st-century war and conflict. Published: The British Imperial Army in the Middle East, James Kitchen (2014) The Testimonies of Indian Soldiers and the Two World Wars, Gajendra Singh (2014) South Africa’s “Border War,” Gary Baines (2014) Forthcoming: Cultural Responses to Occupation in Japan, Adam Broinowski (2015) 9/11 and the American Western, Stephen McVeigh (2015) Jewish Volunteers, the International Brigades and the Spanish Civil War, Gerben Zaagsma (2015) Military Law, the State, and Citizenship in the Modern Age, Gerard Oram (2015) The Japanese Comfort Women and Sexual Slavery During the China and Pacific Wars, Caroline Norma (2015) The Lost Cause of the Confederacy and American Civil War Memory, David J. Anderson (2015) Filming the End of the Holocaust Allied Documentaries, Nuremberg and the Liberation of the Concentration Camps John J. Michalczyk Bloomsbury Academic An Imprint of Bloomsbury Publishing Plc LONDON • OXFORD • NEW YORK • NEW DELHI • SYDNEY Bloomsbury Academic An imprint of Bloomsbury Publishing Plc 50 Bedford Square 1385 Broadway London New York WC1B 3DP NY 10018 UK USA www.bloomsbury.com BLOOMSBURY and the Diana logo are trademarks of Bloomsbury Publishing Plc First published 2014 Paperback edition fi rst published 2016 © John J. -

Nude in a Classroom: the Contemporary World of Life Modelling
City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works All Dissertations, Theses, and Capstone Projects Dissertations, Theses, and Capstone Projects 2-2019 Nude in a Classroom: The Contemporary World of Life Modelling Kannaki Bharali The Graduate Center, City University of New York How does access to this work benefit ou?y Let us know! More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/3019 Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY). Contact: [email protected] NUDE IN A CLASSROOM: THE CONTEMPORARY WORLD OF LIFE MODELLING by KANNAKI BHARALI A dissertation submitted to the Graduate Faculty in Sociology in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, The City University of New York 2019 © 2019 KANNAKI BHARALI All Rights Reserved ii Nude in a Classroom: The Contemporary World of Life Modelling by Kannaki Bharali This manuscript has been read and accepted for the Graduate Faculty in Sociology in satisfaction of the dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy. Date Philip Kasinitz Chair of Examining Committee Date Lynn Chancer Executive Officer Supervisory Committee: Cynthia Epstein David Halle Elizabeth Wissinger THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK iii ABSTRACT Nude in a classroom: The Contemporary World of Life Modelling by Kannaki Bharali Advisor: Dr. Phillip Kasinitz Throughout the history of Western art, drawing from live nude models has been considered one of the most efficient way to develop artistic skills. While drawing live nudes used to be something one had to enroll in an art school to do, life drawing has now transformed to a leisure practice across widely diverse cultural groups. -

Le Serment De Fidélité À Hitler Selon Ernst Kaltenbrunner, Un Nazi Autrichien « Illégal » Devenu Chef Du Reichssicherheitshauptamt (1943-1945)
Le serment de fidélité à Hitler selon Ernst Kaltenbrunner, un nazi autrichien « illégal » devenu chef du Reichssicherheitshauptamt (1943-1945) Marie-Bénédicte Vincent L’auteur Marie-Bénédicte Vincent est maître de conférences en histoire contemporaine à l’École normale supérieure (Paris). Chercheuse à l’Institut d’histoire moderne et contemporaine (IHMC), ses travaux récents portent sur l’histoire de la dénazification en Allemagne après 1945. Elle a notamment co-dirigé en 2019 : Marc Bergère, Jonas Campion, Emmanuel Droit, Dominik Rigoll, Marie-Bénédicte Vincent (dir.), Pour une histoire connectée et transnationale des épurations en Europe après 1945 (Bruxelles, Peter Lang, 2019) ; Corine Defrance, Sébastien Chauffour, Stefan Martens, Marie- Bénédicte Vincent (dir.), La France et la dénazification de l’Allemagne après 1945 (Bruxelles, Peter Lang, 2019). Résumé L’article analyse la conception du serment de fidélité du nazi autrichien Ernst Kaltenbrunner (1903-1946), qui fut le successeur de Heydrich à la tête du Reichssicherheitshauptamt à partir du 30 janvier 1943. Ce haut dignitaire du régime, condamné à mort en 1946 lors du procès de Nuremberg, est moins étudié que d’autres criminels nazis. L’article examine dans un premier temps la manière dont Kaltenbrunner érige le serment de fidélité au Führer en valeur suprême du combattant nazi, dans ses rapports secrets consacrés à l’enquête de police diligentée après l’attentat manqué contre Hitler du 20 juillet 1944. Dans un second temps, l’article revient sur la trajectoire en amont de Kaltenbrunner au sein du parti nazi autrichien, notamment durant la période « illégale » où celui-ci fut interdit entre le 19 juin 1933 et l’Anschluss du 12 mars 1938. -

Univerzita Karlova Disertační Práce Mgr. Jan Zumr Analýza Činnosti Allgemeine-SS V Dolních Rakousích V Letech 1932-1945 A
Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav světových dějin Historické vědy Historie – Obecné dějiny Disertační práce Mgr. Jan Zumr Analýza činnosti Allgemeine-SS v Dolních Rakousích v letech 1932-1945 Analysis of the activities of Allgemeine-SS in Lower Austria in the years 1932-1945 Vedoucí práce: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. 2017 Prohlašuji, že jsem disertační práci napsal samostatně s využitím pouze uvedených a řádně citovaných pramenů a literatury a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu. V Sobotce, dne 28. června 2017 Mgr. Jan Zumr 2 Abstrakt Disertační práce se zabývá zkoumáním role, jakou sehrála SS, resp. Allgemeine- SS, v Dolních Rakousích a v Říšské župě Dolní Podunají od svého vzniku na počátku třicátých let až po konec druhé světové války. Cílem je zanalyzování její činnosti, struktury a personálního obsazení. Její historie vykazovala řadu shodných rysů s dějinami SS v ostatních rakouských spolkových zemích i v samotném Německu, zároveň se zde ale objevovala místní specifika. V Dolních Rakousích/Dolním Podunají měla SS, v závislosti na konkrétním roce, druhý nejvyšší nebo vůbec nejvyšší počet příslušníků v celém Rakousku. Při přepočtu na obyvatele tomu ale bylo přesně naopak. Při srovnání se situací ve „staré říši“ vykazovala taktéž podprůměrné počty esesmanů. Tento fakt spočíval v geografickém charakteru a sociální sktruktuře obyvatel země, jehož převážně katolicky konzervativní obyvatelstvo žijící na nížinatém venkově vykazovala vyšší rezistenci vůči vstupu do SS než evangelíci či katolíci žijící v horách. Specifická byla situace na jižní Moravě a jihovýchodním cípu Čech, připojených k Dolnímu Podunají v říjnu 1938. Zde, stejně jako v celém bývalém československém pohraničí, byl počet příslušníků Allgemeine-SS v přepočtu na obyvatele třikrát větší, než kolik činil průměr. -

5989 Turcica 35 05 Berksoy
Funda BERKSOY 165 RUDOLF BELLING AND HIS CONTRIBUTION TO TURKISH SCULPTURE During the years following the World War I Rudolf Belling (1886- 1972), a pioneer of abstract sculpture, became one of the most celebrated artists in Germany (Fig.1). His fame was based primarily on works such as his Triad (1919) and Sculpture 23 (1923), in which he strove toward a synthesis of Russian revolutionary art with the current modernist trends. As a member of the Arbeitsrat für Kunst (Workers’ Council on Art) and a cofounder of the Novembergruppe, he also sought a closer relationship between sculpture and architecture, successfully collaborat- ing on many occasions with architects. In the German literature on mod- ern art of the period, Belling was highly praised and embraced as one of the spokesmen of the new art1. When the National Socialists came to power in 1933 and started their campaign against avant-garde art, like many other artists, Belling too sought refuge abroad∞; accepting an invitation from the Turkish govern- ment he left Berlin for Istanbul in 1937. When his professorship at the Kunstakademie (Berlin-Charlottenburg Academy of Art) was interrupted Funda BERKSOY is associate professor, Uludag University, Department of art history, Görükle Kampüsü, Bursa, Turkey. * Unless otherwise indicated, translations are mine. 1 Carl EINSTEIN, «∞Die Kunst des 20 Jahrhunderts∞», Propyläen Kunstgeschichte 16, Berlin, 2nd ed., 1928, p. 228-29∞; Paul Ortwin RAWE, Deutsche Bildnerkunst von Schadow bis zur Gegenwart, Berlin, 1929, p. 223-25. For a list of publications with state- ments by Belling, see J.A. SCHMOLL gen. EISENWERTH, Rudolf Belling, vol.