Special Editions; Institute for Balkan Studies SASA
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
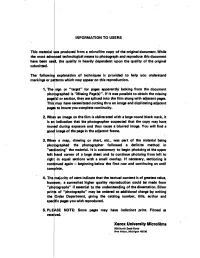
Xerox University Microfilms
INFORMATION TO USERS This material was produced from a microfilm copy o f the original document. While the most advai peed technological meant to photograph and reproduce this document have been useJ the quality is heavily dependent upon the quality of the original submitted. The followini explanation o f techniques is provided to help you understand markings or pattei“ims which may appear on this reproduction. 1. The sign or “ target" for pages apparently lacking from die document phoiographed is “Missing Page(s)". If it was possible to obtain the missing page(s) or section, they are spliced into the film along with adjacent pages. This| may have necessitated cutting thru an image and duplicating adjacent pages to insure you complete continuity. 2. Wheji an image on the film is obliterated with a large round black mark, it is ar indication that the photographer suspected that the copy may have mo1vad during exposure and thus cause a blurred image. You will find a good image of the page in the adjacent frame. 3. Wheh a map, drawing or chart, etc., was part of the material being photographed the photographer followed a definite method in 'sectioning" the material. It is customary to begin photoing at the upper left hand corner of a large sheet and to continue photoing from left to righj in equal sections with a small overlap. If necessary, sectioning is continued again - beginning below the first row and continuing on until com alete. 4. The majority of users indicate that the textual content is of greatest value, ho we ver, a somewhat higher quality reproduction could be made from "ph btographs" if essential to the understanding of the dissertation. -

Księżna Milica
POZNA ŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE PSS NR 5/2013 ISSN 2084-3011 Data przesłania tekstu do redakcji: 23.11.201 2 Zofia Brzozowska Data przyj ęcia tekstu do druku: 28.02.2013 [email protected] Ksi ęż na Milica – mi ędzy sakralizacj ą władzy monarszej, oficjalnym kultem cerkiewnym i narodowym mitem ABSTRACT. Brzozowska Zofia, Ksi ęż na Milica – mi ędzy sakralizacj ą władzy monarszej, oficjalnym kultem cerkiewnym i narodowym mitem (Princess Milica – the Sacralisation of Queenship, Official Sanctity and National Myth). „Pozna ńskie Studia Slawistyczne” 5. Pozna ń 2013. Adam Mickiewicz University Press, pp. 59–73. ISBN 978-83-232-2636-9. ISSN 2084-3011. This article is devoted to the one of the best known female rulers of medieval Serbia – prin- cess Milica, wife of the prince Lazar Hrebeljanovi ć, who had lost his live during the famous Battle of Kosovo Field in 1389. After the death of her husband, Milica founded the Ljubo- stinja monastery and became the nun Jevgenija. She was a close friend to the famous Serbian poet Jefimija, who accompanied princess Milica in the diplomatic mission to the Sultan’s court in 1398/1399. She died in 1405. She was canonized by the Serbian Orthodox Church. She appears also – as „tsaritsa Milica” – in Serbian folklore (epic poetry). Keywords: Milica; Lazar Hlebeljanovi ć; Serbia; Battle of Kosovo Field; holy ruler; hagio- graphy Sakralny status władców, wywodz ących si ę ze „ świ ętej dynastii” Nemanjiciów, jest jednym z najbardziej charakterystycznych fenomenów średniowiecznej kultury serbskiej, rozwijaj ącej si ę w XIII–XVII wieku pod przemo żnym i wieloaspektowym wpływem cywilizacji bizanty ńskiej. -

600 Jaar Later: De Slag Bij Kosovo in De Hedendaagse, Servische Literatuur
Universiteit Gent Faculteit Letteren & Wijsbegeerte Academiejaar 2008-2009 600 jaar later: De slag bij Kosovo in de hedendaagse, Servische literatuur Verhandeling ingediend tot het behalen van de graad van Master in de Oost-Europese Talen en Culturen Promotor: Dr. S. Vervaet door: Laurens Strobbe 2 Voor de literatuur, overgevlogen uit het verre zuiden, in de handen van mijn promotor, Ik dank Aan de goden van de wereldlijke panthea, voor spirituele begeleiding, Ik dank Aan alle geliefden in mijn leven, voor hun energie, Ik dank ≈ 3 4 Inhoudsopgave 1. Inleiding ................................................................................................................................................. 7 2. De veldslag bij Kosovo: De evolutie van een nationale legende ........................................... 9 3. Kosovo Polje door de ogen van de huidige schrijvers ............................................................ 13 4. In het spoor van de legendarische personages ......................................................................... 17 4.1 Lazar, prins van Servië ............................................................................................................ 17 4.1.1 De christelijke aura van Lazar ......................................................................................... 19 4.2 Miloš Obilić, de eeuwige held ................................................................................................. 23 4.2.1 De twist met Vuk Branković ........................................................................................... -

Des Pays Yougoslaves Au Moyen-Age
BOŠKO I. BOJOVIĆ LA littérature autochtone des pays yougoslaves au Moyen Age parvenues uniquement dans leur traduction ou dans leur version slave (Vie de Constantin-Cyrille), et enfin celles cumulant les deux caractéristiques (Vie de st. Jean de Ryla par Georges Skylitzès). Cette imbrication des hagiographies slaves et grecques (les auteurs grecs ont utilisé les prototypes slaves lors de la composition de LA LITTÉRATURE AUTOCHTONE ces Vies), est un phénomène dont la portée socio-culturelle n’a (HAGIOGRAPHIQUE ET HISTORIOGRAPHIQUE) sans doute pas encore été évaluée à sa juste mesure. Un phéno- DES PAYS YOUGOSLavES AU MOYEN AGE mène transcendant les frontières linguistiques, culturelles et ins- titutionnelles dans un domaine où l’exclusivisme idéologico-re- ligieux byzantin allait souvent au détriment de l’universalisme L’analyse des textes narratifs appartenant au genre désigné romano-chrétien. Il suffit, en effet, de rappeler que la hiérarchie comme “hagio-biographie dynastique” révèle leur teneur en idées byzantine s’était montrée bien peu empressée d’inclure les saints politiques. Elaborée généralement par des ecclésiastiques ou des slaves dans le calendrier de l’Eglise œcuménique311. moines, souvent par des personnages plus ou moins proches de la 312 Il est impossible d’exposer en quelques pages toute la ri- cour royale, cette philosophie politique , tout en ayant un carac- chesse de la littérature vieux-bulgare et la complexité de son in- tère essentiellement théorique, eut une incidence importante sur terdépendance avec la littérature -

Zograf 42 10 Matic.Indd
Ktetor portraits of church dignitaries in Serbian Post–Byzantine painting (part one) Miljana М. Matić* Museum of the Serbian Orthodox Church, Belgrade UDC 75.041.5:271.22-725.1/.2](497.11)”15/16” 338.246.027:34 DOI https://doi.org/10.2298/ZOG1842181M Оригиналан научни рад Church dignitaries were often represented as ktetors in Serbian nitaries, portraits are the most reliable and sometimes the painting of the sixteenth and seventeenth centuries, primarily only testimonies for the research of individual person- in wall paintings and on icons. The first part of this paper dis- alities, clothing, and insignia, giving information on the cusses twelve ktetor representations of Serbian patriarchs and appearance of the depicted archpriests and their rank in metropolitans. By analyzing the ktetoric projects of Orthodox 2 Serbs within the Ottoman Empire, the historical framework society. Thanks to the inscriptions accompanying ktetor and description of every portrait, it explores the questions re- portraits, they are considered to be a unique epigraphic garding not only the self-referentiality of the ktetors from the treasury and an important source for studying the titles of highest circles of the clergy under the Patriarchate of Peć, the Orthodox clergy, as well as for the history of some church patterns and ways they wanted to be represented and remem- monuments and icons.3 Portraits also provide valuable bered, but also the ideological and program context as well. testimonies of fundamental ideological, political and reli- Finally, this two-part study attempts to examine the question gious views of the depicted personalities and the environ- of individual and collective identity, imagery and ideas con- structing the visual culture of clerical ktetorship in Serbian ment in which they lived. -

Serbische Heldenlieder
Marburger Abhandlungen ∙ Band 37 (eBook - Digi20-Retro) Hans-Bernd Harder Hans Lemberg (Hrsg.) Serbische Heldenlieder Verlag Otto Sagner München ∙ Berlin ∙ Washington D.C. Digitalisiert im Rahmen der Kooperation mit dem DFG-Projekt „Digi20“ der Bayerischen Staatsbibliothek, München. OCR-Bearbeitung und Erstellung des eBooks durch den Verlag Otto Sagner: http://verlag.kubon-sagner.de © bei Verlag Otto Sagner. Eine Verwertung oder Weitergabe der Texte und Abbildungen, insbesondere durch Vervielfältigung, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verlages unzulässig. «Verlag Otto Sagner» ist ein Imprint der KubonHans-Bernd & Sagner Harder GmbH and Hans. Lemberg - 9783954794461 Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:04:44AM via free access ОООБО697 Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen Reihe II Marburger Abhandlungen zur Geschichte und Kultur Osteuropas Im Auftrag der Philipps-Universität Marburg herausgegeben von Hans-Bernd Harder und Hans Lemberg Band 37 Verlag Otto Sagner M ü n ch e n Hans-Bernd Harder and Hans Lemberg - 9783954794461 Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:04:44AM via free access 000Б0697 Serbische Heldenlieder • • Übersetzt von Stefan Schlotzer M it einem Kommentar von Erika Beermann Verlag Otto Sagner • München 1996 Hans-Bernd Harder and Hans Lemberg - 9783954794461 Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:04:44AM via free access ОООБО697 f Bayerische Л I Staatsbibliothek I I München I ISBN 3-87690-627-X C op yrigh t by Verlag O tto Sagner, München 1996 Abteilung der Firma Kubon und Sagner, -

The Development Path of the Serbian Language and Script Matica Srpska – Members’ Society of Montenegro Department of Serbian Language and Literature
Jelica Stojanović THE DEVELOPMENT PATH OF THE SERBIAN LANGUAGE AND SCRIPT MATICA SRPSKA – MEMBERS’ SOCIETY OF MONTENEGRO DEPARTMENT OF SERBIAN LANGUAGE AND LITERATURE Title of the original Serbian Edition: Jelica Stojanović, Put srpskog jezika i pisma, Belgrade, Srpska književna zadruga, 2017, The Blue Edition series For the publisher JELICA STOJANOVIĆ Editor DRAGO PEROVIĆ Translation NOVICA PETROVIĆ ©Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Подгорица, 2020. Jelica Stojanović THE DEVELOPMENT PATH OF THE SERBIAN LANGUAGE AND SCRIPT Podgorica 2020 MILOš KOVAčEVIć THE DEVELOPMENT PATH OF THE SERBIAN LANGUAGE AND SCRIPT, MADE UP OF STRAY PATHS Only two years have passed from the two hundredth anni- versary of the beginning of Vuk Karadžić’s struggle for “intro- ducing the folk language in literature”, that is to say, from the introduction of the Serbian folk language in the Serbian literary language, or to put it in the more modern phrasing of today: the standard language. The beginning of that struggle is connected to the year 1814, when, in the royal city of Vienna, Vuk’s first grammar book came out: The Orthography of the Serbian Lan- guage Based on the Speech of the Common Folk, which dealt with resolving the three most important standard-related issues: a) the issue of the Serbian orthography, b) the issue of the morpho- logical structure of the Serbian language, and c) the issue of the name of the language and its national boundaries. Rare are the languages, if, indeed, there are any, which have had such a turbulent history of two hundred years. The histor- ical development of a language can be followed at two histor- ical levels: that of its internal and that of its external history. -

HIL ENICH PATM 1.Pdf
/-;0 .fL---I7~ .~-<.') - /137-/15"0 //-J q I I ~ 11:)2 (}f\ ~ p~ ~ ~?1 /~10·-1907 .Aa~/!~-d-- ~ I~~~ /15"0-058' - £~ ~r' ~ e~_ ~ ~ cl..u- 6- ~l/~ .A8- 3S fi z/{Uvrz.cu--d.- / '1 30 - 3 7 - J.j a.,...; ~-"-teft- ~~~o...- ~~~ v 44- tf'i II ~~..e-TY ~~1'UV-c'<.. ,~h-6-!'~tl.-- 11z.:;,-- 174 9 .t/-r-5~ il ~~ Ifl-o-19:Jo -;-sTfl~~~'foo,-raJUJ..T :rLj - 5" S ., f:,,-.rf;~'.e-- ~'~-(r~___ / ~ 74-/ f ? I . 5(", "~ ,'1~ .. /'6'/:>.- / Y(,/ 5'-5 (1 /1 ~ ~a...4~~' /1t,J./- Jf70 59- (Po rr $~ - f'~cr#~ llwu.!o ~. -;e~'~ .. ~~ ~ OJ- .j!h~.J:t/~ ~5 ~- ¥ ~ t:L Pcd-, .. r. du M~?~. I?-~ ~ ~ .. -~J ~ ~ ~ 1 I~~~~ .~.~.~ Pd. ~l-We...~ ~~~. -l-I.-v ~1'-!J(}~ 3~ .~ ~-c~ ~ .~~. ~ ~~ L-rm?U"~UlA.'-~ r bJurz - H - Co d-~-~ 0; ~2. a.t-jJk- ~ ~~ ~ ~ #LJL~.I' &'1-(,3 •• ,4t. ~ - 4-fh~ ~ - ~ {~ ~~ .. ~ fJ :,; 61.-(,,1 .• l(tuJ ~ ~'6-7{) •• 4J ~ Y- .j..l~n:.k - fa ~~ -7': . 1 ~ ~ .31S-" ~ ~~ 7~~n--~ 7/- 73 •• ~~ !(~~ ~ 117~. -137/- ~~ . -P~~r'- ~ ~ - ~ jJti~~ v 7;./-7(" •.. ~~ ~l ~~ "- 77~F -' .Ihff) 1ft;1 ·~~1~Gd.) 77-7'1k~ C4+ 'l7~ -13S1 «. ~~- .. ~ a~ - ~ f(k+ nUk/~ eJ 'to .. ~ ~ -/,3 7- ~ f~· ~l- ~ .. ~Cv~,~ ! ..;.. '2.. IJ\A... "-4t-!ted •_________~~' ,.~ _~ _~'._, c ',~ ,~~ -' ••-,,- , JUBILARNA SLIKA NJ. SV. PATRIJARHA GERMANA -povodom 25-godisnjice patrijaraske sluzbe- Ovu sluku uradio je protodjakon Marko Ilic, akademski slikar iz Beograda po porudzbini beogradskog svestenstva, koje je istu poklonilo Nj. Sv. Patrijarhu srpskom Germanu povodom 25-go disnjice nj:!gove patrijaraske sluzbe. -

Přehled Vývoje
1 PŘEHLED VÝVOJE JIHOSLOVANSKÝCH SPISOVNÝCH JAZYKŮ (od 9. do počátku 19. století) Pavel KREJČÍ Brno 2013 2 OBSAH: 1. Předmluva 2. Úvod 3. Jazyková mapa Evropy. Indoevropská jazyková rodina – slovanská jazyková skupina – jihoslovanská podskupina 4. Přehled a charakteristika současných jihoslovanských jazyků. Základní foneticko-fonologická, gramatická a lexikální charakteristika současných jihoslovanských spisovných jazyků 5. Nejstarší období jihoslovanského písemnictví. Praslovanština. Staroslověnština. Literární střediska v Preslavi a Ochridu. Nejstarší písemné památky. Hlaholice, cyrilice a další písma 6. Písemnictví slovanského jihu v období středověkých jihoslovanských státních útvarů. Církevní slovanština a její redakce. Trnovská škola, Evtimij Trnovský a Grigorij Camblak. Zetsko-chlumská, rašská a resavská škola, Konstantin Kostenecký. Chorvatské hlaholské písemnictví 7. Písemnictví slovanského jihu v 16. až 18./19. století. Počátky standardizace moderních jihoslovanských spisovných jazyků. Damaskiny; Paisij Chilendarski, Sofronij Vračanski a jejich pokračovatelé. Ruskoslovanský a slavenosrbský jazyk; Gavril Stefanović Venclović, Zaharije Orfelin, Jovan Rajić, Dositej Obradović. Renesance, baroko, reformace a protireformace u Chorvatů a Slovinců; ozaljský literární okruh; standardizace kajkavské a ikavskoštokavské chorvatštiny, mluvnické a slovníkové příručky; Bartol Kašić, Juraj Križanić, Pavao Ritter Vitezović, Matija Petar Katančić, Andrija Kačić Miošić; Primož Trubar, Adam Bohorič, Marko Pohlin 8. Literatura a internetové zdroje -
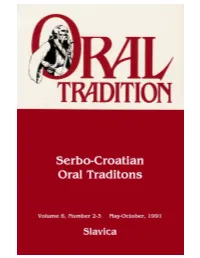
Complete Issue
_____________________________________________________________ Volume 6 May-October 1991 Number 2-3 _____________________________________________________________ Editor Editorial Assistants John Miles Foley David Henderson J. Chris Womack Whitney A. Womack Slavica Publishers, Inc. For a complete catalog of books from Slavica, with prices and ordering information, write to: Slavica Publishers, Inc. P.O. Box 14388 Columbus, Ohio 43214 ISSN: 0883-5365 Each contribution copyright (c) 1991 by its author. All rights reserved. The editor and the publisher assume no responsibility for statements of fact or opinion by the authors. Oral Tradition seeks to provide a comparative and interdisciplinary focus for studies in oral literature and related fields by publishing research and scholarship on the creation, transmission, and interpretation of all forms of oral traditional expression. As well as essays treating certifiably oral traditions, OT presents investigations of the relationships between oral and written traditions, as well as brief accounts of important fieldwork, a Symposium section (in which scholars may reply at some length to prior essays), review articles, occasional transcriptions and translations of oral texts, a digest of work in progress, and a regular column for notices of conferences and other matters of interest. In addition, occasional issues will include an ongoing annotated bibliography of relevant research and the annual Albert Lord and Milman Parry Lectures on Oral Tradition. OT welcomes contributions on all oral literatures, on all literatures directly influenced by oral traditions, and on non-literary oral traditions. Submissions must follow the list-of reference format (style sheet available on request) and must be accompanied by a stamped, self-addressed envelope for return or for mailing of proofs; all quotations of primary materials must be made in the original language(s) with following English translations. -

The Legend of Kosovo
Oral Tradition, 6/2 3 (1991):253-265 The Legend of Kosovo Jelka Ređep The two greatest legends of the Serbs are those about Kosovo and Marko Kraljević. Many different views have been advanced about the creation of the legend of Prince Lazar and Kosovo (Ređep 1976:161). The most noteworthy, however, are those of Dragutin Kostić (1936) and Nikola Banašević (1935). According to Banašević, the legends of Marko Kraljević and Kosovo sprang up under the infl uence of French chansons de geste. Kostić, however, takes a different stance. Rejecting Banašević’s interpretation along with the opinion that the legend of Kosovo arose and took poetic form in the western regions of Yugoslavia, which in the second half of the fi fteenth century had strong ties with western Europe and in which the struggle against the Turks was most intense, Kostić points out that Banašević does not distinguish between the legend and its poetic expression in the Kosovo poems. He states that “French chivalric epics did not affect the formation and even less the creation of the fi rst poem about Kosovo, not to mention the legend of Kosovo, but only modifi ed the already created and formed legend and its fi rst poetic manifestations” (1936:200; emphasis in original). It seems reasonable to accept Kostić’s opinion that the legend originated in the region in which the battle of Kosovo took place. The dramatic nature of the event itself, along with those that followed, could certainly have given rise to the beginnings of the legend soon after the Serbian defeat at Kosovo on June 15, 1389 (June 28 of the old calendar), and the canonization of Prince Lazar. -

Editing in a Sixteenth-Century Serbian Manuscript (HM.SMS. 280) a Lexical Analysis with Comparison to the Russian Original Diss
Editing in a Sixteenth-Century Serbian Manuscript (HM.SMS. 280) A Lexical Analysis with Comparison to the Russian Original Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By !ivojin Jakovljevi", M.A. Graduate Program in Slavic and East European Languages and Literatures The Ohio State University 2011 Dissertation Committee: Dr. Daniel E. Collins, Adviser Dr. Charles Gribble Dr. Predrag Mateji" Copyright by !ivojin Jakovljevi" 2011 ABSTRACT This study encompasses an analysis of the language found in the first Serbian copy of The History of the Jewish War (HM.SMS.280) compared to its Russian original (HM.SMS.281). This research follows the clues in the colophon written by the Serbian scribe, the hieromonk Grigorije Vasilije, in which he states that the Serbian people could not understand the Russian words of the original manuscript. For this reason, Grigorije Vasilije states, he had to “translate” the unknown words into Serbian. Since the Serbian manuscript consists of a large number of folia, 255 of them, a sampling approach was used, whereby eight folia from six sections were extracted and analyzed. The results of the findings identify a number of lexical variations which were distinctive in Serbian and the Russian recensions at the end of the sixteenth century. Some of the lexemes found in the Serbian manuscript are attested for the first time, and as such they make an addition to our knowledge of medieval Serbian lexicography. The findings of this research show that many of the hard-to-understand words were very specific technical terms from military vocabulary—not words that a monk (or most laymen) could be expected to know.