Der Aargauer Klosterstreit 1841 in Bildlichen Darstellungen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ortsregister
OrtsregIster Aachen—285 → heinrich slachtscaef – empfehlung luthers, besser bei altgläu- Aarau bigen zu kommunizieren—140 – tag—211 – stellungnahmen zu Bucers apologien— Aargau 142f., 157, 169, 187 – Freie Ämter—36 → gemeine herrschaften Ägypten, Ägypter—51 Kirchen und Klöster Alexandrien – heilig Kreuz als Wirkungsstätte Wolfgang – Bischof—97, 102, 141, 156 → cyrill Musculus’—129, 142, 157, 164, 187, 262, Altenburg 279 – Wirkungsort georg spalatins—7 – Pfarrzechhaus (Wohnung Wolfgang Altstätten im rheintal Musculus’)—164 → Johann heinrich – stadtammann—218 → hans vogler held Ansbach—8, 74 – st. anna als Wirkungsstätte Bonifatius – gutachten zum tag von schweinfurt—8 Wolfharts—279 – Kirchenordnung—179 – st. georg als Wirkungsstätte sebastian Assur, Assyrer—51 Maiers—143, 187 Athen—158 – st. ulrich als Wirkungsstätte Johann hein- Augsburg—157, 169, 290 rich helds—163 Briefe und Schriften Aufenthalt – abfassungsort—129, 163, 288 – Bartholomeo Fonzios—243, 291 – Publikationsort—157, 170 → heinrich steiner Baden (Aargau) – Drucker—170 → Philipp ulhart – Disputation (21.5. – 8.6.1526)—101 – Drohbrief auf der Perlachstiege—290 → Johannes eck – tagsatzung (28./29.9.1528)—35 Ereignisse – tagsatzung (8.4.1532)—59 – reichstag (1530)—5, 92, 126 → ambrosius – tagsatzung (10.6.1532)—48, 59 Blarer, gregor Brück, Karl v., Joachim – tagsatzung (23.7.1532)—48 vadian, huldrych zwingli – tagsatzung (4.9.1532)—48 – türkenhilfe—5 – tagsatzung (16.12.1532)—38, 106–108, 116 – causa religionis—38f. Baden (Grafschaft)—36, 58 – confessio augustana Bekenntnisse → Baden (Markgrafschaft)—181 → Pforz- – aufruhr—290 heim Institutionen – Markgraf—180, 282 → Philipp I. – rat—165, 289 – exilierung protestantischer geistlicher—11, – einführung der reformation—290 180, 282 → Michael hilspach, christoph – altgläubige—165, 289f. sigel – stadtarzt—186, 279, 288, 291 → ambro- Balkan—22 sius Jung d. -

Inhaltsübersicht
Inhaltsübersicht Erstes Buch. Das Interregnum der langen Tagsatzung 1813—1815. S. 1-402 I. Der Durchzug der Verbündeten 1813/1814 S. 3— 62 Lage im Beginn des Jahres 1813. Verschärfung der Zen sur und Kontinentalsperre 3. — Erhöhung des Rekrutentributs an Napoleon 4. — Mülinens Projekt einer Bewaffnung 5. — Ordentliche Tagsatzung in Zürich 6. — Außerordentliches Trup- , penbegehren Napoleons 7. — Landammann Reinhard 8. — Räumung des Tessin 9. — Außerordentliche Tagsatzung 10. — Verhinderung eines größeren Truppenaufgebots durch Napo- leon. Neutralitätserklärung 11. — Anerkennung der Neutralität durch Napoleon 12. — Kriegsplan der Verbündeten. Capo d'Jstria und Lebzeltern in Zürich 13. — Motive der schweiz. Neutralität 14. — Reaktionshoffnungen in Bern 15. — Besorg nisse der Demokraten 16. — Unzulänglichkeit der Grenzbesetzung 17. Unentschlossenheit Reinhards 18. — Vorrücken der Haupt armee gegen die Schweiz 19. — Befehle Schwarzenbergs für den Rheinübergang 21. — Kaiser Alexander, Laharpe, Jomini, Fräulein Mazelet21/22. — Reding und Escher in Frankfurt 22/23. — Anscheinende Anerkennung der Neutralität, Sistierung des Ein- Marsches 23. — Metternich, Schwarzenberg, Radetzky gegen die Neutralität 24. — Verbot der Neutralitätsproklamation durch die ->Berner Regierung. Sendung Zeerleders und Mills 26. — Lan desverrat der Berner Unbedingten 27. — Graf Johann von Salis-Soglio 28. — Das Waldshuter Komitee in Freiburg 29. — Entschluß des Kaisers Franz zum Einmarsch 31. — Metternich und die Schweizer Gesandten 32i — Kapitulation von Lörrach ' 33. — Rückzug der eidg. Armee 34. — Auflösung der eidg. Ar- mee 35. — Rheinübergang der Österreicher. Bubna in Bern 36. — Die Österreicher in Neuenburg und Biel 37. — In Schaff- .Hausen und Zürich 38. — Vormarsch der Hauptarmee nach Frankreich 39. — Bubna in Lausanne 40. — Genf unter fran zösischer Herrschaft 41. — Gärung in Genf 42. — Bubna in Genf. e Provisorische Regierung 44. -

Vorlage an Den Landrat: Formulierte Verfassungsinitiative "Für Die
Vorlage an den Landrat des Kantons Basel-Landschaft Titel: Formulierte Verfassungsinitiative "Für die Fusion der Kantone Basel- Stadt und Basel-Landschaft" Datum: 10. Dezember 2013 / 14. Januar 2014 Nummer: 2013-444 Bemerkungen: Verlauf dieses Geschäfts Links: - Übersicht Geschäfte des Landrats - Hinweise und Erklärungen zu den Geschäften des Landrats - Landrat / Parlament des Kantons Basel-Landschaft - Homepage des Kantons Basel-Landschaft 2013/444 Kanton Basel-Landschaft Regierungsrat Vorlage an den Landrat V om 10. Dezember 2013 / 14. Januar 2014 Formulierte Verfassungsinitiative "Für die Fusion der Kantone Basel-Stadt und Basel- Landschaft" 1 Zusammenfassung ......................................................................................................... 2 2 Initiative für die Fusion der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt .......................... 3 2.1 Wortlaut der Fusionsinitiative ........................................................................................... 3 2.2 Rechtsgültigkeit der Fusionsinitiative ............................................................................... 5 2.3 Verhältnis der Fusionsinitiative zu den „Regio-Initiativen“ ................................................ 5 3 Geschichtlicher Rückblick ............................................................................................... 7 3.1 Einleitung ........................................................................................................................ 7 3.2 Beitritt zur Eidgenossenschaft, Französische -
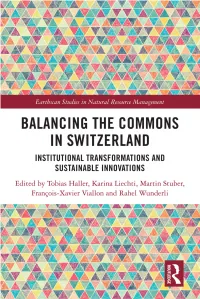
Balancing the Commons in Switzerland
Balancing the Commons in Switzerland Balancing the Commons in Switzerland outlines continuity and change in the management of common-pool resources such as pastures and forests in Switzerland. The book focuses on the differences and similarities between local institutions (rules and regulations) and forms of commoners’ organisations (corporations of citizens and corporations) which have managed common property for several centuries and have shaped the cultural landscapes of Switzerland. At the core of the book are fve case studies from the German, French and Italian speaking regions of Switzerland. Beginning in the Late Middle Ages and focusing on the transformative periods in the nineteenth and twentieth centuries, it traces the internal and external political, economic and societal changes and examines what impact these changes had on commoners. It goes beyond the work of Robert Netting and Elinor Ostrom, who discussed Swiss commons as a unique case of robustness, by analysing how local commoners reacted to, but also shaped, changes by adapting and transforming common property institutions. Thus, the volume highlights how institutional changes in the management of the commons at the local level are embedded in the public policies of the respective cantons, and the state, which generates a high heterogeneity and an actual laboratory situation. It shows the power relations and very different routes that local collective organisations and their members have followed in order to cope with the loss of value of the commons and the increased workload for maintaining common property management. Providing insightful case studies of commons management, this volume delivers theoretical contributions and lessons to be learned for the commons worldwide. -

Switzerland – a Model for Solving Nationality Conflicts?
PEACE RESEARCH INSTITUTE FRANKFURT Bruno Schoch Switzerland – A Model for Solving Nationality Conflicts? Translation: Margaret Clarke PRIF-Report No. 54/2000 © Peace Research Institute Frankfurt (PRIF) Summary Since the disintegration of the socialist camp and the Soviet Union, which triggered a new wave of state reorganization, nationalist mobilization, and minority conflict in Europe, possible alternatives to the homogeneous nation-state have once again become a major focus of attention for politicians and political scientists. Unquestionably, there are other instances of the successful "civilization" of linguistic strife and nationality conflicts; but the Swiss Confederation is rightly seen as an outstanding example of the successful politi- cal integration of differing ethnic affinities. In his oft-quoted address of 1882, "Qu’est-ce qu’une nation?", Ernest Renan had already cited the confederation as political proof that the nationality principle was far from being the quasi-natural primal ground of the modern nation, as a growing number of his contemporaries in Europe were beginning to believe: "Language", said Renan, "is an invitation to union, not a compulsion to it. Switzerland... which came into being by the consent of its different parts, has three or four languages. There is in man something that ranks above language, and that is will." Whether modern Switzerland is described as a multilingual "nation by will" or a multi- cultural polity, the fact is that suggestions about using the Swiss "model" to settle violent nationality-conflicts have been a recurrent phenomenon since 1848 – most recently, for example, in the proposals for bringing peace to Cyprus and Bosnia. However, remedies such as this are flawed by their erroneous belief that the confederate cantons are ethnic entities. -

The 1848 Conflicts and Their Significance in Swiss Historiography Thomas Maissen
1 The 1848 Conflicts and their Significance in Swiss Historiography Thomas Maissen Wha t does it take to make a revolution successful? How was it possible that, of all the countries concerned, Switzerland was the on ly one to see the success of its liberal and national movement in 1848? It was a success in a double sen se: firstly, there was no polit ical reaction and repression as elsewhere, th e achievements of 1848 were not seriously threatened either by foreign powers or by int ern al oppo ne nts; and second ly, it was a lasting success, for from 1848 until today th ere has been constitutiona l and institution al continuity, making it possible to celebrate the 150th anniversary of modern Switzerland. Such continuity, which in addition has been peaceful, might not much imp ress a British audience that traces its na tiona l roots as far back as 1066, 1215 or even 1689 and 1707. But one has to compa re mod ern Switzerland to th e fate of th e othe r contine ntal countries: non e of th em has been spared territ orial modi ficatio ns or institutiona l and constitutiona l struggles througho ut the last 150 years, an d most have suffered enormously from th ese changes. Only th e sma ll Alpine republic has somehow muddled through th e era of the nation state without too much harm. It has becom e more obvious over th e last few years, however, that thi s success story has its dark spots, too, and it is high tim e for th e Swiss to say goodb ye to an unrealistically heroic view of their past. -

Language Policy in Switzerland
STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RHETORIC 45 (58) 2016 DOI: 10.1515/slgr-2016-0020 Elżbieta Kużelewska University of Bialystok Poland LANGUAGE POLICY IN SWITZERLAND Abstract. Switzerland is often referred to as a success story for handling its linguistic and cultural diversity. Traditionally four languages have been spo- ken in relatively homogeneous territories: German, French, Italian and Rhaeto– Romanic (Romansh). The first three have been national languages since the foundation of the Confederation in 1848; the fourth became a national language in 1938. In effect, The Law on Languages, in effect since 2010, has regulated the use and promotion of languages and enhanced the status of Romansh as one of the official languages since 2010. While Swiss language policy is determined at the federal level, it is in the actual practice a matter for cantonal implementation. Article 70 of the Swiss Federal Constitution, titled “Languages”, enshrines the principle of mul- tilingualism. A recent project to create legislation to implement multilingual- ism across the cantons, however, has failed. Thus Switzerland remains de jure quadrilingual, but de facto bilingual at best, with only a handful of cantons recognizing more than one official language (Newman, 2006: 2). Cantonal bor- ders are not based on language: the French-German language border runs across cantons during most of its course from north to south, and such is also the case for Italian. Keywords: language, linguistic, policy, Switzerland Even though Switzerland takes pride in its multilingualism, it does not necessarily mean that the Swiss are multilingual. The use of the territoriality principle has resulted in the homogenization of the different cantons and a decreased language contact. -

Staatsarchiv Des Kantons Thurgau Beständeübersicht
Staatsarchiv des Kantons Thurgau Beständeübersicht Bearbeitet von André Salathé Frauenfeld 2015 2 Beständeübersicht Staatsarchiv des Kantons Thurgau Die vorliegende 2. Ausgabe der Beständeübersicht gibt den Stand vom 25. April 2015 wieder. Ihr beigelegt ist der Archivnetzplan „Zeitreisen zum Nulltarif“ von Urban Stäheli, Frauenfeld 2013. Zum Preis von Fr. 40.– zu beziehen beim: Staatsarchiv des Kantons Thurgau Zürcherstrasse 221 8510 Frauenfeld [email protected] www.staatsarchiv.tg.ch © 2015 Staatsarchiv des Kantons Thurgau, Frauenfeld Staatsarchiv des Kantons Thurgau Beständeübersicht 3 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis ............................................................................................................................ 3 Vorwort und Einführung ................................................................................................................. 7 Kurze Geschichte des Staatsarchivs .............................................................................................. 11 Hinweise zur Benützung des Staatsarchivs ................................................................................... 16 Abkürzungen ................................................................................................................................. 23 Archiv, Hauptabteilungen 0–9 ................................................................................................... 27 0 Landvogtei und Landgrafschaft 1460–1798 .......................................................................... 29 1 -

I. Al Li Eii Swiss Legal Culture
Marc Thommen Introduction to Swiss Law Edited by Daniel Hürlimann und Marc Thommen Volume 2 Marc Thommen Introduction to Swiss Law Editor: Prof. Dr. iur. Marc Thommen Zurich, Switzerland This work has been published as a graduate textbook in the book series sui generis, edited by Daniel Hürlimann and Marc Thommen (ISSN 2569-6629 Print, ISSN 2625-2910 Online). The German National Library (Deutsche Nationalbibliothek) lists this work in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data is available in the internet via http://dnb.d-nb.de. © 2018 Prof. Dr. Marc Thommen, Zurich (Switzerland) and the authors of the respective chapters. This work has been published under a Creative Commons license as Open Access which requires only the attribution of the authors when being reused. License type: CC-BY 4.0 – more information: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ DOI:10.24921/2018.94115924 Cover image credits: "5014 Gretzenbach" from the book Heimatland © 2018 Julian Salinas and Ursula Sprecher (http://www.juliansalinas.ch). Cover design: © 2018 Egbert Clement The font used for typesetting has been licensed under a SIL Open Font License, v 1.1. Printed in Germany and the Netherlands on acid-free paper with FSC certificate. The present work has been carefully prepared. Nevertheless, the authors and the publisher assume no liability for the accuracy of information and instructions as well as for any misprints. Lectorate: Chrissie Symington, Martina Jaussi Print and digital edition produced and published by: Carl Grossmann Publishers, Berlin, Bern www.carlgrossmann.com ISBN: 978-3-941159-23-5 (printed edition, paperback) ISBN: 978-3-941159-26-6 (printed edition, hardbound with jacket) ISBN: 978-3-941159-24-2 (e-Book, Open Access) v Preface A man picks an apple from a tree behind a bee house in Gretzenbach, a small village between Olten and Aarau. -

Die Tagsatzung Als Appellationsgericht
BRGÖ 2013 Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs THOMAS LAU, Fribourg Die Tagsatzung als Appellationsgericht Vertreter aller dreizehn eidgenössischen Orte von Tengen-Nellenburg, habe im Jahre 1529 waren am 11. Mai 1597 der Einladung des Vor- einen Reversbrief in seinen Unterlagen gefun- ortes Zürich gefolgt und in Baden zu einer Tag- den, aus dem hervorgehe, dass sein Vorfahr satzung erschienen. Je zwei Gesandte pro Ort Eberhard von Nellenburg im Jahre 1337 dem nahmen im Sitzungssaal des Rathauses Platz. Zu Heiliggeistspital in Schaffhausen das Dorf Me- ihnen gesellten sich Vertreter von fünf zuge- rishausen verpfändet habe. Das Dokument be- wandten – also mit der Eidgenossenschaft eng weise, dass der Pfandgeber das Dorf jederzeit verbundenen – Ständen.1 Das Programm, dem gegen Zahlung von 65 Mark Silber zurückkau- man sich zu widmen hatte, war vielfältig: Spani- fen könne. Als Nellenburg von dieser Möglich- sche und burgundische Gesandte wurden emp- keit habe Gebrauch machen wollen, sei er aller- fangen, der Rechtsstatus des zugewandten Ortes dings abgewiesen und – auf seinen fortgesetzten Mühlhausen analysiert, die Frage beraten, ob Protest hin – schließlich an das Ratsgericht ver- Kaiser Rudolf II. um die Konfirmation der eid- wiesen worden. Dies habe er nicht akzeptiert, da genössischen Privilegien gebeten werden sollte. die Richter dann zugleich die Beklagten gewe- Zudem widmete man sich Antragstellern, die sen wären. Im Jahre 1531 sei er daher zunächst juristische Entscheidungen erbaten. Unter ihnen an das Hofgericht zu Rottweil und, nachdem er befand sich Hilarius von Hornstein, der als dort abgewiesen worden sei, vor das Reichs- Rentmeister des Grafen Karl II. von Hohenzol- kammergericht gezogen. Speyer habe den Zita- lern-Sigmaringen im Auftrage seines Herrn er- tionsprozess gegen Schaffhausen eröffnet und schienen war.2 die Stadt zur Zahlung der Prozesskosten vor Der Graf, Reichserbkämmerer, österreichischer dem Hofgericht verurteilt.4 Als Erbe des Nellen- Rat und Sohn eines Reichshofratspräsidenten, burgers stehe Karl II. -

Der Bernische Aargau Und Die Grafschaft Baden
Inventare Aargauischer Archive I. Teil Repertorium des Aargauischen Staatsarchivs 1. Der bernische Aargau und die Grafschaft Baden bearbeitet von Walther Merz Aarau, 1935 H. R. Sauerländer & Co. Inhalt. Seite Vorwort . V Urkundenarchiv VII—VIII I. Ehemals bernischer Aargau 1—188 A. Oberamt Aarburg 1 —13 B. Oberamt Biberstein 14—22 C. Oberamt Königsfelden • • • 23—39 D. Oberamt Lenzburg 40—80 E. Oberamt Schenkenberg 81—108 F. Oberamt Kasteln 109—115 G. Zofingen Stift 116—133 H. Aargauische Städte 134—169 Aarau 134—151 Brugg 151—158 Lenzburg 158—167 Zofingen 167—169 I. Aargauische Herrschaften 170—186 Hallwil 170 Liebegg . 170—171 Rued 171-176 Schöftland 177-186 Schafisheim 186 Trostburg 186 Wildenstein 186 K. Ruralkapitel 187—188 Kapitel Aarau 187 Kapitel Brugg-Lenzburg 187—188 IL Grafschaft Baden 189-324 A. Alteidgenössisches Archiv 189—210 1. Register, Kopialbücher, Urbare und Rechtsquellen .... 189 - 192 2. Eidgenössische Abschiede 192—194 3. Verwaltung 194—196 4. Urbare bzw. Bereine 197-209 5. Kirchen und Klöster 209—210 B. Kanzleiarchiv •....' 210-251 C. Landvogtei Baden (Luzerner Akten) 251—256 IV Seite D. Untere Freie Ämter 256 E. Gemeine Herrschaften 256 — 258 F. Städte 258—259 G. Herrschaften 259—260 H. Bistum Konstanz 260—261 I. Johanniterkommende Klingnau 261 K. St. Blasianer Propsteien Klingnau und Wislikofen 262—276 L. Johanniterkommende Leuggern 276—285 M. Kloster Wettingen 285—308 Zürcher Archiv des Klosters 305—308 N. Stift Zurzach 308—324 Namen- und Sachregister 325—423 Berichtigungen 423 Vorwort. Seit dem Wechsel im Staatsarchivariat am 1. Februar 1929 ist das Aar gauische Staatsarchiv völlig neu organisiert worden. -

Die Mikwe Von Lengnau AG Peter Frey
SPM-Koll VIII_CoverWeb_SPM VIII – KOLL 14.11.18 09:22 Seite 1 AS – Archäologie Schweiz SAM – Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit SBV – Schweizerischer Burgenverein (Herausgeber) Die Schweiz von 1350 bis 1850 im Spiegel archäologischer Quellen SPM AS – Archéologie Suisse SAM – Groupe de travail suisse pour l’archéologie du Moyen Age et de l’époque moderne SBV – Association suisse Châteaux forts (éditeurs) La Suisse de 1350 à 1850 à travers les sources archéologiques Akten des Kolloquiums Actes du Colloque Die Schweiz von 1350 bis 1850 — La Suisse de à Kolloquium — colloque Bern 2018 Bern, 25.–26.1.2018 Verlag Archäologie Schweiz Basel 2018 ISBN 978-3-908006-48-0 SPM Umschlag: Dudelsackbläser vom so genannten Holbein-Brunnen. Werk eines unbekannten Künstlers, um 1545. Sandstein mit farbiger Fassung. Höhe 91 cm. Heute Basel, Historisches Museum, Inv. 1910.132. Umzeichnung Archäologie Baselland, S. Schäfer. Schellen-Under. Schaffhauser Spielkarte. Schaffhausen, um 1800. Holzschnitt, schablonenkoloriert. Drucker David Hurter; Bearbeitung I. D. Zeder. Couverture: Joueur de cornemuse de la fontaine dite de Holbein. Oeuvre d’un artiste inconnu, ver 1545. Grès avec décor polychrome. Hauteur 91 cm. Aujourd’hui à Bâle, Musée Historique, Inv. 1910.132. Dessin Archéologie Baselland, S. Schäfer. Schellen-Under (Under de grelot). Carte à jouer de Schaffhouse. Schaffheouse, vers 1800. Gravure sur bois peinte au pochoir. Imprimeur David Hurter. Infogra- phie I. D. Zeder. Wissenschaftliche Leitung / Direction scientifique: Steuerungsgruppe SPM VIII (s. S. 7), im Auftrag der Wissenschaft lichen Kommission der Archäologie Schweiz / sur mandat de la Commission Scientifique d’Archéologie Suisse. Die Umsetzung dieser Internet-Publikation wurde unterstützt durch die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozial- wissenschaften SAGW.