Feststellungsentwurf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

445-470 Register
Berichtigungen S. 29, Anm. 18, Z. 2: S. 17 → S. 11-59, dies S. 17 S. 37, Anm. 48, Z. 5: Achim Bonawitz → Alfred Cobbs S. 76, Anm. 285, Z. 2: Begabgung → Begabung S. 138, Anm. 17, Z. 20: eingenhändigen → eigenhändigen S. 172, Anm. 61, Z. 2: Wetteraukreis → Rheinhessen S. 241, Abs. 1, Z. 3: Schweickard → Schweikard S. 271, Anm. 125, Z. 4: Forstlehrinstitue → Forstlehrinstitute S. 274, Abs. 1, Z. 1: mit → mir S. 276, Abs. 2, Z. 2: Benz(t)el-Sternau → Ben(t)zel-Sternau S. 292, Abs. 1, Z. 2: Lehrer → als Lehrer S. 305, Anm. 93, Z. 5: Sager → Woerner S. 313, Anm. 2, Z. 6: Anm. 23 → Anm. 22 S. 367, Anm. 32, Z. 3: Steierbach → Steiermark S. 374, Anm. 14, Z. 2: Johann Friedrich → Joseph Friedrich S. 380, Anm. 53, Z. 1: Kaufmanns → Kauffmanns S. 393, Anm. 8, Z. 1: Wetteraukreis → Rheinhessen S. 430, Anm. 28: S. XXX → S. 431 445 Orts- und Personenregister Aachen: 9 150, 152-156, 158-161 f., 164-173, 182-185, 188, Aarau: 144 191-197, 200 f., 203-219, 221-224, 226-240, Abert, Joseph Friedrich: 442 278 ff., 282 ff., 287, 289, 292 f., 296 f., 299 f., Ägäis: 118 302, 304 ff., 308-313, 318 f., 321-326, 328, 330 f., Agripina → Köln 333 ff., 337-341, 343, 349-353, 355-358, 360 f., Ajaccio: 340 363, 366-372, 376, 378-387, 389, 392 ff., 396- Albini, Franz Joseph Freiherr von: 123 f., 130, 132, 405, 407-414, 418, 420-424, 426 ff., 430-444 334 f. -

1986L0465 — Fr — 13.03.1997 — 003.001 — 1
1986L0465 — FR — 13.03.1997 — 003.001 — 1 Ce document constitue un outil de documentation et n'engage pas la responsabilité des institutions ►BDIRECTIVE DU CONSEIL du 14 juillet 1986 concernant la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/ CEE (république fédérale d'Allemagne) (86/ /CEE) (JO L 273 du 24.9.1986, p. 1) Modifiée par: Journal officiel no page date ►M1 Directive 89/586/CEE du Conseil du 23 octobre 1989 L 330 1 15.11.1989 ►M2 Décision 91/26/CEE de laCommission du 18 décembre 1990 L 16 27 22.1.1991 ►M3 Directive 92/92/CEE du Conseil du 9 novembre 1992 L 338 1 23.11.1992 ►M4 modifiée par la décision 93/226/CEE de la Commission du 22 avril L 99 1 26.4.1993 1993 ►M5 modifiée par ladécision 97/172/CE de laCommission du 10 février L 72 1 13.3.1997 1997 ►M6 modifiée par ladécision 95/6/CE de laCommission du 13 janvier L 11 26 17.1.1995 1995 1986L0465 — FR — 13.03.1997 — 003.001 — 2 ▼B DIRECTIVE DU CONSEIL du 14 juillet 1986 concernant la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (république fédérale d'Allemagne) (86/ /CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agricul- ture de montagne et de certaines zones défavorisées (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 797/85 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2, vu laproposition de laCommission, vu l'avis de l'Assemblée (3), considérant que la directive 75/270/CEE -

Bebauungsplanaufstellung „Kai 6 / Westlich Limesstraße“ Marktgemeinde Stockstadt Am Main Bayernhafen Aschaffenburg
Bebauungsplanaufstellung „Kai 6 / Westlich Limesstraße“ Marktgemeinde Stockstadt am Main Bayernhafen Aschaffenburg Umweltbericht für die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB Im Auftrag von Bearbeitung durch herne ● münchen ● hannover ● berlin www.boschpartner.de Auftraggeber: Bayernhafen GmbH & Co. KG Hafenbahnhofstr. 27 bayernhafen Aschaffenburg 63741 Aschaffenburg Auftragnehmer: Bosch & Partner GmbH Pettenkoferstraße 24 80336 München Simon & Widdig GbR Luise-Berthold-Str. 24 35037 Marburg Projektleitung: Dipl.-Ing. Juliane Kurmann Bearbeiter: Dipl.-Ing. Klaus Müller-Pfannenstiel M. Sc. Andrea Eberhardt Dipl.-Geogr. Bernd Avermann Dipl.-Biol. Thomas Widdig München, den 28.01.2021 BPlan „Kai 6 / Westlich Limesstraße“ Marktgemeinde Stockstadt am Main Umweltbericht gemäß § 2 (4) BauGB Inhaltsverzeichnis Seite 0.1 Abbildungsverzeichnis ......................................................................................III 0.2 Tabellenverzeichnis .........................................................................................III 1 Allgemeinverständliche Zusammenfassung ................................................ 1 2 Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (Nr. 1 der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 BauGB)...................................................................... 4 2.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des BPlans ................... 4 2.2 Lage des Vorhabens und Bedarf an Grund und Boden .................................... 6 2.3 Ziele des Umweltschutzes -

Landkreis Aschaffenburg
KLEINOSTHEIM MESPELBRUNN SOMMERKAHL Mc Donalds Fränkischer Bei Verzehr eines Hauptgerichts Brandschutz & Feuer- 10 % auf das gesamte Sortiment 10 % Rabatt auf Feuerwehr-Geschenk- Lemke GmbH Landgasthof Elsavatal Kaffee oder Apfelbrand wehrbedarf Gries (außer Coupon-Aktionen) artikel und auf Feuerlöscher-Neukauf Saaläckerstr. 2b Schlossallee 2 (aus eigener Brennerei) gratis Spessartstr. 28 www.brandschutz-gries.de 63801 Kleinostheim 63875 Mespelbrunn www.1-otto.de 63825 Sommerkahl LANDKREIS Fußpfl ege + Wellness 3 % Rabatt 10 % Rabatt auf Schuhe Brückners Schuhhaus Fleckenstein Sabine Schnall (ausgenommen mobile Einsätze und Hartwaren (Einzelstücke Spezialitätenkeller 20 % Rabatt auf den Einkauf ASCHAFFENBURG Hauptstr. 65 Ludwigstr. 74 und Verkauf) und Restgrößen zum Hammerpreis) Am Eichenberg 16 63875 Mespelbrunn www.spezialitaetenkeller.de 63801 Kleinostheim www.schuhhaus-fl eckenstein.de 63825 Sommerkahl Schwind 10 % auf Brillen inkl. Gläser, Son- Top Speed 50 Euro Rabatt STOCKSTADT AM MAIN Sehen & Hören GmbH nenbrillen, Contactlinsen, Optische Fahrschule UG auf die Anmeldegebühr 50 % Nachlass auf den Eintrittspreis Mainparkstr. 6-10 Handelsware, Hörgeräte (ausgen. Hauptstr. 174 Markt Stockstadt www.top-speed.de zu gemeindlichen Veranstaltungen 63801 Kleinostheim Sonderangebote, Zubehör und Verträge) Hauptstr. 19-21 63875 Mespelbrunn bei Kauf der Eintrittskarte an Rathauskasse 63811 Stockstadt STEWA Touristik GmbH 5 % Rabatt bei Buchung einer MÖMBRIS www.stockstadt-am-main.de Lindigstr. 2 STEWA-Reise aus dem STEWA-Katalog 10 % Rabatt -

Mainaschaffer Nachrichten Mit Amtsblatt Der Gemeinde Mainaschaff Nr
Mainaschaffer Nachrichten MIT AMTSBLATT DER GEMEINDE MAINASCHAFF Nr. 10 12. März 2021 64. Jahrgang AMTSBLATT DER GEMEINDE MAINASCHAFF Altpapiersammlung am Samstag, 13. März 2021 Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wegen der aktuellen Corona-Lage mussten wir die für Januar 2021 geplante Altpapiersammlung mehrmals verschieben. Wir führen sie jetzt am Samstag, den 13. März 2021, durch. Stellen Sie Ihr gebündeltes Altpapier bitte wie immer bis 8.00 Uhr an die Straße! Sollte es wider Erwarten bis 11.00 Uhr nicht abgeholt sein, rufen Sie bitte nicht im Pfarrhaus an, sondern folgende Handy-Nummer des Verantwortlichen für die Altpapiersammlung: 0152-04960678. Danke! Ihre Ministranten Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Ihre Ministranten St. Margaretha Mainaschaff WICHTIGE TELEFONNUMMERN: (ohne Vorwahl) Notruf – RETTUNGSDIENst – FEUERWEHR – 112 Notruf Polizei – 110, Ärztlicher BereitschaftsdieNst – 116 117 (Vom Handy aus auch alle u.a. Nummern mit Vorwahl!) POLIZEIINSPEKTION Aschaffenburg – 857-0 FREIW. FEUERWEHR MAINASCHAFF, Feuerwehrgerätehaus, Robert-Koch-Str. – 78 04 07 1. Kdt. Matthias Grimm – 78 07 21; 2. Kdt. Christoph Schöffel – 8 62 26 14 www.feuerwehr-mainaschaff.de BAYERISCHES ROTES KREUZ, Bereitschaft Mainaschaff, Rot-Kreuz-Heim, Robert-Koch-Str. – 78 04 09 WASSERWACHT MAINPARKSEE, Paul-Männche-Haus – 7 46 80 ALLGEMEINÄRZTE Praxis Dr. Roza Motlagh / Dirk Jahr, Im Weichental 17 – 7 53 88 Dr. med. T.-D. Koch u. Dr. med. J. Klement, Jahnstr. 2 – 7 46 16, Rezepte: 7 56 66 KINDERÄRZTE Dr. Karla Rauschning-Sikora, Am Glockenturm 7 – 78 04 83 INTERNISTEN Spezialgebiet Herz u. Lunge (Gemeinschaftspraxis Kardiologie und Pneumologie) Dr. med. Wolfgang Kock, Dr. med. Wolfgang Pistner, Dr. med. Holger Klein, Dr. med. Carsten Brill, Am Glockenturm 7 – 79 72 13 ORTHOpäDEN Dr. -

1/98 Germany (Country Code +49) Communication of 5.V.2020: The
Germany (country code +49) Communication of 5.V.2020: The Bundesnetzagentur (BNetzA), the Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, Post and Railway, Mainz, announces the National Numbering Plan for Germany: Presentation of E.164 National Numbering Plan for country code +49 (Germany): a) General Survey: Minimum number length (excluding country code): 3 digits Maximum number length (excluding country code): 13 digits (Exceptions: IVPN (NDC 181): 14 digits Paging Services (NDC 168, 169): 14 digits) b) Detailed National Numbering Plan: (1) (2) (3) (4) NDC – National N(S)N Number Length Destination Code or leading digits of Maximum Minimum Usage of E.164 number Additional Information N(S)N – National Length Length Significant Number 115 3 3 Public Service Number for German administration 1160 6 6 Harmonised European Services of Social Value 1161 6 6 Harmonised European Services of Social Value 137 10 10 Mass-traffic services 15020 11 11 Mobile services (M2M only) Interactive digital media GmbH 15050 11 11 Mobile services NAKA AG 15080 11 11 Mobile services Easy World Call GmbH 1511 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1512 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1514 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1515 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1516 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1517 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1520 11 11 Mobile services Vodafone GmbH 1521 11 11 Mobile services Vodafone GmbH / MVNO Lycamobile Germany 1522 11 11 Mobile services Vodafone -

Besiedlung Seit 7.000 Jahren
Hügelgräber Besiedlung seit 7.000 Jahren Panoramafoto des größten Hügelgrabes im Hübnerwald nahe der Tafel. Hügelgräber standen bei ihrer Anlage frei von allen Seiten sichtbar und waren von einem kultisch genutzten Areal umgeben. Dies ist im heute dicht bewachsenen Hübnerwald kaum mehr vorstellbar. Die Vor- und Frühgeschichte in Stockstadt am Main 1950 wurden in der Flur „kleiner Sand“ aufgereihte Findlinge entdeckt, die Aus der Jungsteinzeit ist uns der erste Hinweis auf menschliches Wir- sich als ein angeschnittenes Hügelgrab herausstellten. In der ausgehobe- ken in Stockstadt überliefert. nen Grube zeigte sich eine dunkel verfärbte Sandschicht mit Holzkohlere- Auf der Gersprenzinsel fand sten sowie mit 13 kleineren und man ein Hirschgeweihstück einer größeren Gefäßscherbe. mit Bearbeitungsspuren, das Im Hübnerwald fanden sich in als Sichel oder Erntemesser mehreren Hügelgräbern Ge- genutzt wurde. Das Original wandnadeln, so genannte Bril- wurde im 2. Weltkrieg zer- lenspiralen, Bruchstücke von stört. Eine Nachbildung ist im Bronzeschmuck sowie Keramik- Heimatmuseum Stockstadt scherben. zu sehen. 1978 grub das hessische Denk- malamt Darmstadt direkt an der Von der Gersprenzinsel stam- bayerisch-hessischen Grenze men zahlreiche Steinbeile ein Hügelgrab aus, das der von Band- und Schnurkera- Hallstattzeit zuzuordnen ist. Es mikern aus der Jungsteinzeit, liegt in unmittelbarer Nähe der aus der Bronzezeit von den Grabhügelgruppe auf den Sand- Mittels der Technik des Airborne-Laser-Scans (ALS) kann das Bodenrelief unter der Waldbedeckung sicht- Glockenbecherleuten bis zur Im Heimatmuseum ist eine römische Brandbestat- dünen an der Papiermühle. Die bar gemacht werden. Ein Flugzeug sendet Laserstrah- Urnenfelderzeit. tung rekonstruiert. Funde kamen nach Darmstadt. Bei den Museen der Stadt Aschaffenburg hat sich len auf den Erdboden, der von dort relektiert wird. -
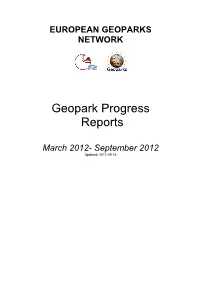
Geopark Progress Reports
EUROPEAN GEOPARKS NETWORK Geopark Progress Reports March 2012- September 2012 Updated: 2012-09-16 INDEX OF GEOPARKS Page Adamello Brenta – ITALY 3 Apuan Alps - ITALY 5 Arouca - PORTUGAL 7 Basque Coast – SPAIN 9 Bauges – FRANCE 11 Beigua - ITALY 13 Bergstrasse-Odenwald - GERMANY 15 Bohemian Paradise – CZECH REPUBLIC 17 Burren and Cliffs of Moher- REPUBLIC OF IRELAND 19 Cabo de Gata – Nijar Natural Park - SPAIN 21 Chelmos Vouraikos – GREECE 23 Copper Coast – IRELAND 24 English Riviera – UK 26 Fforest Fawr – Wales, UK 28 Gea Norvegica – NORWAY 30 GeoMon – Wales, UK 31 Harz Braunschweiger Land Ostfalen – GERMANY 33 Hateg Country Dinosaurs – ROMANIA 35 Katla – ICELAND 37 Madonie Geopark – ITALY 39 Maestrazgo Cultural Park – SPAIN 41 Magma – NORWAY 43 Marble Arch Caves– NORTHERN IRELAND and REP OF IRELAND 45 Muskau Arch – GERMANY and POLAND 47 Naturtejo – PORTUGAL 49 North Pennines AONB – ENGLAND UK 51 Novohrad-Nógrád - HUNGARY and SLOVAKIA 53 Papuk – CROATIA 55 Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Campania – ITALY 57 Park Naturel Régional du Luberon – FRANCE 59 Petrified Forest of Lesvos – GREECE 61 Psiloritis Natural Park – GREECE 63 Rocca di Cerere – ITALY 64 Rokua – FINLAND 66 Shetland – SCOTLAND UK 68 Sierra Norte de Sevilla Natural Park - SPAIN 70 Sierras Subbeticas Natural Park – SPAIN 72 Sobrarbe – SPAIN 74 Steirische Eisenwurzen – AUSTRIA 76 Swabian Alb – GERMANY 78 Terra.Vita Naturpark – GERMANY 80 Vikos Aoos – GREECE 82 Villuercas-Ibores-Jara – SPAIN 84 Vulkaneifel European – GERMANY 86 1 No report from: North West Highlands – SCOTLAND UK; Réserve Géologique de Haute - Provence – FRANCE, Sardenia Geominerario Park – ITALY and Tuskan Mining Geopark - ITALY. 2 Adamello Brenta Nature Park – ITALY Adamello Brenta Nature Park, consistently with its wider and more complex conservation strategy of the natural, historical and cultural heritage, has continued its work to improve the geological heritage conservation and geotouristic and popularization activities. -

Ahsgramerican Historical Society of Germans from Russia
AHSGR American Historical Society of Germans From Russia Germanic Origins Project Legend: BV=a German village near the Black Sea . FN= German family name. FSL= First Settlers’ List. GL= a locality in the Germanies. GS= one of the German states. ML= Marriage List. RN= the name of a researcher who has verified one or more German origins. UC= unconfirmed. VV= a German Volga village. A word in bold indicates there is another entry regarding that word or phrase. Click on the bold word or phrase to go to that other entry. Red text calls attention to information for which verification is completed or well underway. Push the back button on your browser to return to the Germanic Origins Project home page. Bre-Bzz updated Mar 2015 BrechtFN: said by the Kromm version of the Jagodnaja Poljana FSL to be fromUC Redmar, Brunswick Duchy, sent here as an 1812 prisoner of war (p.137). BrechtFN: also see Bracht. BrechenmacherFN: said by the 1816 Glueckstal census (KS:677, 674, 233) to be fromUC Weyer, Elsass, but the GCRA could not find them in those church records. The 1816 census also said they came after a stay in Torschau, Hungary; another source said that the place was Weyer, Hungary. However, the GCRA found evidence they actually may have been in Klein-Ker, Hungary and probably were in Tscherwenka; see their book for detail. Also spelled Brachenmacher. BreckenheimGL, [Hesse-Darmstadt?]: is now a neighborhood some 6 miles E of Wiesbaden city centre, and was said by the Caesarsfeld FSL to be homeUC to a Wenzel family. -

Einmal Adler – Immer Adler! (30. Juni 2010) Da Werden Erinnerungen Wach
Einmal Adler – immer Adler! (30. Juni 2010) Da werden Erinnerungen wach. Körbel, Nachtweih, Hölzenbein, Bindewald, Schur – um nur einige ehemalige Profis zu nennen, die sich zusammen gefunden haben und nun als Eintracht-Traditionself die Zuschauer auf die Fußballplätze in ganz Deutschland locken. Die Anlässe und Gegner sind unterschiedlich. Mal sind es ehemalige Bundesliga- Kontrahenten, mal eine Ortsauswahl oder auch ein runder Vereinsgeburtstag! Hier gibt es keine Liga mehr, hier geht es um Spaß. Gut, siegen wollen sie trotzdem die ehemaligen Größen des deutschen Fußballs. Doch es wird auch mal tief durchgeatmet, wenn der Gegner im Durchschnitt fünfzehn Jahre jünger ist. Aber sie haben den Zauber am Ball nicht verloren. Wenn auch ein paar Haare ärmer und ein paar Falten reicher – sie versprühen den Charme von einst. Retro-Bundesligafußball ist in Mode. „Wir können uns vor Anfragen für Freundschafts- und Benefizspiele kaum retten“, berichtet Charly Körbel. Neben Eintracht Frankfurts Fußballschule managt der Rekord- Bundesligaspieler auch die Traditionself. Eintrachts Traditionsmannschaft gratuliert uns zum Vereinsgeburtstag! (30. Juni 2010) Am 23. Juli können sie live am Spielfeldrand stehen und dann den Adlerjungs, aber auch unseren Somaspielern, mit Freude zuschauen. Es wird mit Sicherheit gebrüllt wie früher, auf dem Platz mal geschimpft auf den anderen, um dann im Freudentaumel umarmt und gejubelt. Und diesen Fußballleckerbissen auf unserem Sportgelände verdanken wir Michael Ehrlich vom m.ehrlichSport – und Eventmanagement aus Stockstadt am Main. Auf seiner Firmenhomepage www.ehrlich-sport.de findet man weitere Einzelheiten zu diesem Jubiläumsspiel! Aktionen rund ums Jubiläumsspiel Rund um dieses Spiel präsentiert unser Partner, die Firma m.ehrlich sport aus Stockstadt die Fußball WM im Torwandschießen mit attraktiven Sachpreisen. -

Mainquerung Stockstadt-Mainaschaff Für Radfahrer Und Fußgänger – Start Der Haushaltsbefragung
Foto: Jörg Walter/Mainaschaff Mainquerung Stockstadt-Mainaschaff für Radfahrer und Fußgänger – Start der Haushaltsbefragung Die Bahnbrücke Stockstadt - Mainaschaff stellt für den örtlichen, aber auch für den überörtlichen Radverkehr eine wichtige Verbindung dar. Dies betrifft sowohl die Wege des alltäglichen Verkehrs als auch die des Freizeit- und Tourismusverkehrs. Im Widerspruch zu seiner Bedeutung steht bislang der Ausbauzustand dieser Mainquerung. Auch als die Bahn AG ihre Brücke zuletzt saniert hatte, konnten leider nur geringe Verbesserungen für den Radverkehr erreicht werden. Die Barrierefreiheit fehlt gänzlich. Die gesamte Region Bayerischer Untermain hat ein nachhaltiges Interesse, hier Verbesserungen zu erzielen. Um für die Verbesserung dieses wichtigen Mainübergangs langfristige Perspektiven zu schaffen, haben sich der Landkreis Aschaffenburg, der Markt Stockstadt und die Gemeinde Mainaschaff dazu entschlossen, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. Der erste Schritt dieser Machbarkeitsstudie ist eine Potentialabschätzung zur Nutzung und Bedeutung dieses Mainübergangs, insbesondere für den Radverkehr. Diese Potentialabschätzung besteht aus verschiedenen Bestandteilen wie einer Haushaltsbefragung zum Nutzerverhalten, einer offenen Online-Befragung und verschiedenen Verkehrserhebungen vor Ort entlang der Radwege. Zunächst wird deshalb vom 03.05. bis zum 23.05.2021 eine Haushaltsbefragung in Stockstadt, Mainaschaff, Kleinostheim, Großostheim und teilen Aschaffenburgs durchgeführt. Hierzu werden pro Kommune 3.500 Einwohner*innen ab 16 Jahren angeschrieben mit der Bitte, im Rahmen eines Onlinefragebogens Auskunft über ihr Verkehrsverhalten zu geben - insbesondere die Nutzung von Verkehrsmitteln. Mit dem Anschreiben erhalten die Haushalte einen Zugangscode, mit welchem sie einmalig den Onlinefragebogen ausfüllen können. Die Teilnehmenden werden durch zufällige Stichprobenziehungen ausgewählt. Sollte Ihnen die Onlineteilnahme nicht möglich sein, bitte melden Sie sich bei Ihrem Bürgerbüro, damit Ihnen ein Papierfragebogen zugesendet werden kann. -

MITTEILUNGEN Aus Dem Stadt- Und Stiftsarchiv Aschaffenburg ISSN 0174-5328 Bd
MITTEILUNGEN aus dem Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg ISSN 0174-5328 Bd. 2 (1987-1989) ---- • . -L ---=-- • ..:=. lli - ___-:::::::::=-- �--.......-=-·· - - -:-._..... - - -�· --�- .1' 11 Haupteingang Schönborner Hof �.. --·"' - " 1-d;:� (Zeichnung: Rainer Erzgraber, Aschaffenburg) Inhalt Gerrit Walther, ,, Was ich will, ist absolute Freiheit". Zum 100. Geburtstag Julius Maria Beckers präsentiert das Stadt- und Stiftsarchiv die erste umfassende Ausstellung zu Leben und Werk des Aschaffenburger Dichters . 3 Hans-Bernd Spies, Wann wurde die Kapelle im alten Aschaffenburger Schloß geweiht? . 14 Werner Krämer, König Ludwig 1. von Bayern - Freund und Förderer Aschaffenburgs . · 18 Brigitte Schad, Zur Wiederentdeckung der Entwürfe Sophie Brentanos für ein Denkmal ihres Großonkels Giemens . 24 Renate Welsch und Helmut Reiserth, Das Jahr 1986 im Presse- spiegel . 32 Arno Störkel, Die Aschaffenburger Bürgerwehr 1806/9 . 41 Werner Krämer, Die Landwirtschaftsfeste in Aschaffenburg . 47 Hans-Bernd Spies, Die Unterstützung der Stadt Wunsiedel nach dem Brand von 1834 durch das bayerische Untermaingebiet . 55 Garsten Pollnick, Die Aschaffenburger Protestanten oder eine Minder- heit plant ihren Kirchenbau. 1837 - vor 150 Jahren erfolgte die Grundsteinlegung für ein eigenes Gotteshaus . 60 Hans-Bernd Spies, Eine Eichendorff-Parodie - erstmals 1960 auf der Tagung der Gruppe 47 in Aschaffenburg vorgetragen . 69 Renate Welsch und Helmut Reiserth, Das erste Halbjahr 1987 im Pressespiegel . 76 Hans-Bernd Spies, Ergänzendes zur Biografie des Aschaffenburger Schloßbaumeisters Georg Ridinger . 81 Hans-Bernd Spies, Ein junger Norweger 1669 auf dem Weg durch den Spessart nach Italien: Hans Hansen Lilienskiold . 90 Werner Krämer, Das Hungerjahr 1817 in Aschaffenburg . 94 Garsten Pollnick, Vom „hohen Geist ächter Nationalität" - Verfassung und Gemeindeedikt Bayerns von 1818 . 97 Werner Krämer, Das Österreicher Denkmal. Vor 120 Jahre:1 feierliche Enthüllung und Übergabe an die Stadt Aschaffenburg 103 Martin Goes, Die Familie des Lujo Brentano .