BR-ONLINE | Das Online-Angebot Des Bayerischen Rundfunks
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Neglected Nation: the CSU and the Territorial Cleavage in Bavarian Party Politics’', German Politics, Vol
Edinburgh Research Explorer ‘The Neglected Nation: The CSU and the Territorial Cleavage in Bavarian Party Politics’ Citation for published version: Hepburn, E 2008, '‘The Neglected Nation: The CSU and the Territorial Cleavage in Bavarian Party Politics’', German Politics, vol. 17(2), pp. 184-202. Link: Link to publication record in Edinburgh Research Explorer Document Version: Peer reviewed version Published In: German Politics Publisher Rights Statement: © Hepburn, E. (2008). ‘The Neglected Nation: The CSU and the Territorial Cleavage in Bavarian Party Politics’. German Politics, 17(2), 184-202 General rights Copyright for the publications made accessible via the Edinburgh Research Explorer is retained by the author(s) and / or other copyright owners and it is a condition of accessing these publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy The University of Edinburgh has made every reasonable effort to ensure that Edinburgh Research Explorer content complies with UK legislation. If you believe that the public display of this file breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 28. Sep. 2021 © Hepburn, E. (2008). ‘The Neglected Nation: The CSU and the Territorial Cleavage in Bavarian Party Politics’. German Politics, 17(2), 184-202. The Neglected Nation: The CSU and the Territorial Cleavage in Bavarian Party Politics Eve Hepburn, School of Social and Political Studies, University of Edinburgh1 ABSTRACT This article examines the continuing salience of the territorial cleavage in Bavarian party politics. It does so through an exploration of the Christian Social Union’s (CSU) mobilisation of Bavarian identity as part of its political project, which has forced other parties in Bavaria to strengthen their territorial goals and identities. -

CSU-Parteivorsitzender 1945-1949
Die Parteivorsitzenden* der CSU (Stand: August 2020) Josef Müller – Landesvorsitzender 17.12.1945-28.05.1949 Hans Ehard – Landesvorsitzender 28.05.1949-22.01.1955 Hanns Seidel – Landesvorsitzender 22.01.1955-18.03.1961 Franz Josef Strauß – Landes-/Parteivorsitzender 18.03.1961-03.10.1988 Theo Waigel – Parteivorsitzender 19.11.1988-16.01.1999 Edmund Stoiber – Parteivorsitzender 16.01.1999-29.09.2007 Erwin Huber – Parteivorsitzender 29.09.2007-25.10.2008 Horst Seehofer – Parteivorsitzender 25.10.2008-19.01.2019 Markus Söder – Parteivorsitzender seit 19.01.2019 ** Die Ehrenvorsitzenden der CSU (Stand: Januar 2019) Josef Müller –Ernennung zum Ehrenvorsitzenden am 13.06.1969 Hans Ehard –Ernennung zum Ehrenvorsitzenden am 13.06.1969 Edmund Stoiber – Ernennung zum Ehrenvorsitzenden am 29.09.2007 Theo Waigel – Ernennung zum Ehrenvorsitzenden am 18.07.2009 Horst Seehofer – Ernennung zum Ehrenvorsitzenden am 14.01.2019 * Die Bezeichnung Landesvorsitzender (seit 1945) wurde 1968 in Parteivorsitzender geändert. ** Die Ernennung zu Ehrenvorsitzenden erfolgte jeweils durch die CSU-Parteitage. Franz Josef Strauß machte in der Präsidiumssitzung am 13.06.1969 darauf aufmerksam, dass die ehemaligen Parteivorsitzenden nach einer Satzungsänderung nicht mehr Mitglied des Landesvorstands wären, stattdessen könnten nun Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende ernannt werden. 2 Josef Müller – CSU-Parteivorsitzender 1945-1949 (Foto: ACSP) 27.03.1898 in Steinwiesen geboren 1916-1918 Soldat beim Bayerischen Minenwerfer-Bataillon IX 1919-1923 Studium der Rechtswissenschaften -

Aktueller Begriff
Aktueller Begriff Die Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern seit 1945 Gemäß der Verfassung des Freistaates Bayern steht an der Spitze der Staatsregierung der vom Landtag auf fünf Jahre gewählte Ministerpräsident. Er bestimmt u.a. die Richtlinien der Politik, er- nennt mit Zustimmung des Landtages die Staatsminister und die Staatssekretäre und vertritt Bay- ern nach außen. Seit 1945 gab es mit Fritz Schäffer (CSU), Wilhelm Hoegner (SPD), Hans Ehard (CSU), Hanns Seidel (CSU), Alfons Goppel (CSU), Franz Josef Strauß (CSU), Max Streibl (CSU) und Edmund Stoiber (CSU) bisher acht Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern, davon beklei- deten Wilhelm Hoegner (SPD) und Hans Ehard (CSU) das Amt zweimal. Mit Ausnahme von Wil- helm Hoegner (SPD) gehörten alle bisherigen bayerischen Ministerpräsidenten der CSU an. Fritz Schäffer war bei Amtsantritt zwar parteilos, gehörte aber 1945/46 zu den Mitbegründern der CSU. Seit dem Jahr 1962, als die CSU erstmals nach 1946 die absolute Mehrheit der Mandate bei baye- rischen Landtagswahlen gewann, regieren alle – stets von der CSU gestellten – Ministerpräsiden- ten mit absoluten Mehrheiten. Seit den Landtagswahlen 1970 erreichte die CSU zudem fortwäh- rend auch die absolute Mehrheit der abgegeben Stimmen bei allen Landtagswahlen. Tabelle: Die bayerischen Ministerpräsidenten seit 1945 Amtszeit Name des Ministerpräsidenten Partei Lebensdaten 1945 Dr. Fritz Schäffer CSU 12.05.1888-29.03.1967 1945-1946 Dr. Wilhelm Hoegner SPD 23.09.1887-05.03.1980 1946-1954 Dr. Hans Ehard CSU 10.11.1887-18.10.1980 1954-1957 Dr. Wilhelm Hoegner SPD 23.09.1887-05.03.1980 1957-1960 Dr. Hanns Seidel CSU 12.10.1901-05.08.1961 1960-1962 Dr. -
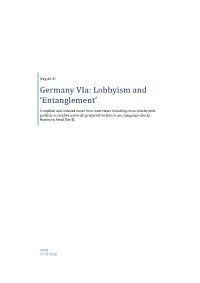
Lobbyism and 'Entanglement'
Jörg Alt SJ Germany VIa: Lobbyism and ‘Entanglement’ Compiled and ordered notes from interviews including cross-checks with publicly accessible material, prepared for future use. Language checks thanks to Amid Dar SJ. Joerg 27.07.2016 2 Table of Content 1 Introduction .............................................................................................................. 2 2 Conceptual clarifications.......................................................................................... 3 3 Europe and Germany ............................................................................................... 3 4 Bavaria ..................................................................................................................... 4 4.1 The “Mia san Mia” frame of mind ................................................................... 4 4.2 Political and economic entanglement ............................................................... 5 4.3 Political, administrative and juridical entanglement ........................................ 6 4.4 Economic and juridical entanglement .............................................................. 7 4.5 The situation since 2008 ................................................................................... 8 4.5.1 A new beginning? ....................................................................................... 8 4.5.2 Participation of the Landesbank in the Offshore business .......................... 9 4.5.3 The “Model-Car” Affair surrounding Minister Christine Haderthauer -

Download [PDF 8,7
„Das schönste Amt der Welt“ Die bayerischen Ministerpräsidenten von 1945 bis 1993 Staatliche Archive Bayerns Kleine Ausstellungen Nr. 13 „Das schönste Amt der Welt“ Die bayerischen Ministerpräsidenten von 1945 bis 1993 Eine Ausstellung des Bayerischen Hauptstaatsarchivs und des Archivs für Christlich-Soziale Politik der Hanns-Seidel-Stiftung mit Unterstützung der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften München 1999 Staatliche Archive Bayerns – Kleine Ausstellungen hrsg. von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns Inhalt Schriftleitung: Albrecht Liess Nr. 13: „Das schönste Amt der Welt.“ Die bayerischen Ministerpräsidenten von 1945 bis 1993. Zum Geleit................................................ 6 Eine Ausstellung des Bayerischen Hauptstaatsarchivs und des Archivs Leihgeber................................................ 11 für Christlich-Soziale Politik der Hanns-Seidel-Stiftung mit Unterstüt- zung der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Ferdinand Kramer Wissenschaften Zur Geschichte des Amtes des Bayerischen Ministerpräsidenten 12 Katalog Karl-Ulrich Gelberg und Michael Stephan Ministerpräsident Fritz Schäffer (28. Mai bis 28. September 1945) .................................. 31 Karl-Ulrich Gelberg und Michael Stephan Bayerisches Hauptstaatsarchiv, 15. Dezember 1999 – 31. Januar 2000 Ministerpräsident Wilhelm Hoegner (28. September 1945 bis 21. Dezember 1946 und 14. Dezember 1954 bis 16. Oktober 1957) ............................................ 44 Karl-Ulrich Gelberg -

Download Als PDF-Datei
Beiträge zum Parlamentarismus 19 Band 19 Wolfgang Reinicke Landtag und Regierung im Widerstreit. Der parlamentarische Neubeginn in Bayern 1946–1962 Herausgeber Bayerischer Landtag Maximilianeum Max-Planck-Straße 1 81675 München Postanschrift: Bayerischer Landtag 81627 München Telefon +49 89 4126-0 Fax +49 89 4126-1392 [email protected] www.bayern.landtag.de zum Parlamentarismus Beiträge Dr. Wolfgang Reinicke (geb. 1974 in Jena) ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Haus der Bayerischen Geschichte in Augsburg. Er hat an zahlreichen Ausstellungsprojekten mitgewirkt, leitet das Projekt Zeitzeugen und ist Mitglied im Projektteam für das neue Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg. München, November 2014 Bayerischer Landtag Landtagsamt Referat Öffentlichkeitsarbeit, Besucher Maximilianeum, 81627 München www.bayern.landtag.de ISBN-Nr. 978-3-927924-34-5 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar. Landtag und Regierung im Widerstreit. Der parlamentarische Neubeginn in Bayern 1946–1962 Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät I der Julius-Maximilians-Universität Würzburg vorgelegt von Wolfgang Reinicke M.A. aus München 3 Erstgutachter: Professor Dr. Dirk Götschmann Zweitgutachter: Professor Dr. Dietmar Grypa Tag des Kolloquiums: 6. Februar 2013 4 Inhaltsverzeichnis Vorwort 12 1 Einleitung -

·Tätigkeitsbericht Über Die 12
BAYERISCHER LANDTAG ·Tätigkeitsbericht über die 12. Wahlperiode 1990/1994 Herausgeber: Bayerischer Landtag · Landtagsamt Redaktion: Referat C IV -Archiv München 1995 Inhaltsübersicht Seite Landtagswahl 1990, Wahlergebnisse . 7 Abgeordnete, Veränderungen im Personalstand . 8 Fraktionen . 9 Präsidium ..... : . „ ........ ·................................ : . 10 Ältestenrat ......................................... „. 11 Ausschüsse ............ .'................. 13 Zwischenausschuß ......................... :.............. ·14 Untersuchungsausschüsse.......... 15 Anfragen (Interp~llationen, Aktuelle Stunden, Mündliche Anfragen, Schriftliche Anfragen) .............. 17 Abstimmungen ................................ „ ... : . 22 Petitionswesen . 23 Gremien ...................................·............... 25 Anhörungen. 33 Erklärung des Landtagspräsidenten vor der Vollversammlung . 34 Regierungserklärungen ................................ ·. 34 Gesamtarbeit des Landtags:............................... 36 Bayerische Staatsregierung ............. ." .. „. 37 Bayerischer Senat .............................. : . 39 Zusammenstellung der Gesetzesvorlagen. .. 40 Tätigkeitsbericht 12. Wahlperiode Bayerischer Landtag Seite 7 Landtagswahl 1990 Die Wahl zum zwölften Bayerischen Landtag 1990/94 fand am 14. Oktober 1990 statt. Die'Wahl er folgte nach dem Gesetz über Landtagswahl, Volksbegehren und Volksentscheid (Landeswahlgesetz - LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. November 1988 (GVBI S.345, BayRS 111-1-I), geändert durch Gesetz vom 30. -

Der Eigensinnige Freistaat
erinnern sich an dieses Datum mit be- – einem Geschehen, das unblutig anfing, sonderer Intensität: nicht weniger als aber blutig endete. Nach Jahrhunderten 300 Veranstaltungen zum Thema 1918 monarchischer Herrschaft schlug das po- – 2018 finden heuer in der bayerischen litische Pendel 1918/19 in Bayern in Der eigensinnige Landeshauptstadt statt. Hier, in der Ka- eine neue, extrem veränderte Richtung tholischen Akademie, will ich daran er- aus. Der Freistaat wurde zu einer Rätere- innern, dass auch das gegenüber gelege- publik – der ersten und einzigen auf ne Schlösschen Suresnes in den Vor- deutschem Boden. Wladimir Lenin Freistaat gängen des Jahres 1919 eine Rolle spiel- konnte am 1. Mai 1919 auf dem Roten te: in diesem Treffpunkt für junge Platz in Moskau nicht nur das revolutio- Künstler hatte zeitweilig Paul Klee sein näre Sowjetrussland begrüßen, er sandte Atelier – und der Maler Hans Reichel auch Grüße an – so wörtlich – „Sowje- versteckte während der Münchner Rä- tungarn und Sowjetbayern“. terepublik in seiner Wohnung dort den Eisner, der Revolutionär und erste Schriftsteller und linkssozialistischen Ministerpräsident des Freistaats, war Revolutionär Ernst Toller. Viel Grund freilich kein Kommunist, sondern ein zum Erinnern also – und viel Anlass zu 1917 zur USPD übergegangener Sozial- Nachfragen, zum historischen Nachfor- demokrat. In seinem Demonstrations- schen und zur politischen Diskussion. zug, der sich nach einer großen Friedens- Mit einem herausragenden Referat Kultusminister saß, ließen den gut Wie soll man sie nun sehen, die letz- demonstration auf der Theresienwiese gelang es Professor Hans Maier, die einstündigen Vortrag am 7. November ten hundert Jahre bayerischer Geschich- am 7. November von der Mehrheit ge- Besonderheiten des bayerischen 2018 zu einem Erlebnis werden. -

Hans Maier Böse Jahre, Gute Jahre Ein Leben 1931 Ff
Unverkäufliche Leseprobe Hans Maier Böse Jahre, gute Jahre Ein Leben 1931 ff. 420 Seiten, In Leinen ISBN: 978-3-406-61285-5 © Verlag C.H.Beck oHG, München 24. Jahre mit Goppel, Jahre mit Strauß «Weißt du nicht, wo die Glocken hängen? Weißt du nicht, wo Gott wohnt?» Genau acht Jahre habe ich dem Landesvater Alfons Goppel gedient – und ebenso acht Jahre dem Bayernherrscher Franz Josef Strauß. Das war keine Absicht, kein Plan; es hat sich eher zufällig so ergeben. Rück- blickend staune ich freilich über meinen Sinn für Symmetrie. Mit Alfons Goppel war ich, als er mich 1970 auf den «Schleuder- sitz» des Kultusministers berief, schon einige Jahre bekannt. Wir hat- ten uns wiederholt gesehen: in München, wo Goppel häufi g auftrat, und in der Bayerischen Landesvertretung in Bonn, wo ich manchmal nach Sitzungen des Bildungsrates übernachtete. Immer war Goppel väterlich und freundlich, unkompliziert und jovial. Und natürlich dachte ich, der Entschluss, mich zu berufen, gehe auf seine persönliche Entscheidung zurück. Er hatte ja Gelegenheit gehabt, meine Arbeit im Bildungsrat und mein Auftreten bei einigen CSU-Veranstaltungen zu beobachten. Heute weiß ich – ich habe es erst nach meiner Amtszeit erfahren –, dass es anders war. Alfons Goppel beabsichtigte zunächst, Wilhelm Ebert zu berufen, den Präsidenten des Bayerischen Lehrer- und Lehre- rinnenverbandes – einen machtbewussten Mann mit internationaler Erfahrung, der seit langem in der bayerischen Politik kräftig mit- mischte (unter anderem war er 1954 einer der «Schmiede» der Vierer- koalition gewesen). Eine Intervention Karl Böcks und seines Freundes Prof. Georg Maurer, Chef des Klinikums rechts der Isar, beim Partei- vorsitzenden Franz Josef Strauß ließ diesen Plan dann scheitern – die Einzelheiten übergehe ich hier. -

Ereignisse, Die Unser Gebiet (Landkr. Ebersberg) Betrafen
Ereignisse, die unser Gebiet (Landkr. Ebersberg) betrafen Vorbemerkung: Klima und Wetter: Folgende Tatsachen beeinflussen unser Klima und Wetter: Sonnenaktivitäten Aufgrund der Sonnenaktivitäten wird manchmal mehr intensive Strahlung, manchmal weniger intensive Strahlung verschickt Erdumlaufbahn Die Umlaufbahn beschreibt einen Kreis oder eine Ellipse (Da hat man Perioden von 40.000 und 100.000 Jahren gefunden) Erdachse (zwischen Nord- und Südpol) hat im Moment einen Winkel von 23.5 Grad; ändert sich aber! Golfstrom bildet eine Art Schleife durch alle Meere hindurch, oben fließt warmes Wasser, es kühlt ab und fließt unten wieder zurück. Land/Wasseroberfläche erhitzen sich unterschiedlich Durchlässigkeit der Stratosphäre z. B.: Durch einen Vulkanausbruch gelangt Asche in dieselbe, die Sonnenstrahlung verringert sich. Industriezeitalter Klimawende Weitere ?? Ändert sich einer der oben genannten Punkte, ändert sich kurzfristig das Wetter und/oder längerfristig das Klima. Wenn Sie Fehler finden, bitte nicht behalten! Wenn Sie Ergänzungen/Korrekturen haben: [email protected] Anmerkung: Diese Übersicht nicht als wissenschaftliches Werk betrachten. Bitte immer den Wahrheitsgehalt nachprüfen, falls Sie die Information benutzen wollen. Ich bin Laie und habe einfach versucht, zusammenzustellen, was im Laufe der Jahrhunderte passiert ist, das unser Gebiet (Landkreis Ebersberg) betraf und betrifft. Es sollte natürlich auch mit der Zeit weiterhin ergänzt werden! 26.07.2019 Seite 2 Information über Themen der Ministerpräsidenten $$$ (Schlagworte der einzelnen Legislaturperioden): http://www.hdbg.de/parlament/content/index.html , Peter Jakob Kock Information über Namen/Themen der Land/Bezirksräte $$$$ (Schlagworte der einzelnen Legislaturperioden): Kreisdokumentation Ebersberg, Fr. Riederer Heft Landkreis Ebersberg 1, Art. Landgericht Schwaben, Gottfried Mayr Heft Landkreis Ebersberg 1, Art. Landrichter, Karl Dickopf (Langenthal): Chronik von Elementarereignissen (Nach Langenthals Geschichte der Landwirtschaft. -

Schierling Und Die Schierlinger «
2 « Richard Rohrer (Jahrgang 1952), der Verfasser des zweiten Chronikban- des ist kein gebürtiger Schierlinger, sondern ein „Zuagraster“. Er ist in Schierlinger Escheldorf, einem kleinen Ort am südöstlichen Steinwaldrand, geboren und hat sich über Grafenwöhr und Re- gensburg Schierling angenähert, da seine Frau aus diesem – damals noch niederbayerischen – Markt stammte. Nach einem 10-jährigen beruflich bedingten „Intermezzo“ in Cham siedel- und die te sich die junge vierköpfi ge Rohrer- Familie im Jahre 1986 in Schierling an, das für Richard Rohrer zur (Wahl-) Heimat wurde. Schon immer geschicht- lich interessiert, machte er sich ab 2014 daran, den zweiten Chronikband zu erarbeiten. Schierling » Richard Rohrer » Schierling und die Schierlinger « Band 2 Richard Rohrer Umschlag2019-neu.indd 1 27.05.19 23:05:16 Richard Rohrer Schierling und die Schierlinger Chronik des Marktes Schierling Band 2 (1800 bis Gegenwart) Herausgegeben vom Markt Schierling 1 Copyright © 2020 by Markt Schierling, Rathausplatz 1, 84069 Schierling Alle Rechte vorbehalten. Printed in Germany Satz, Titelgestaltung: Martin Rohrer Druck: Kössinger AG & Co. KG, Schierling 2 Vorwort Als im Jahr 2003 der Markt Schierling sein 1050-jähriges Jubiläum feierte, kam der 1. Band der vom Studiendirektor a.D. und Schierlinger Ehrenbürger Johann Straßer verfassten Chronik „Schierling und die Schierlinger“ heraus. Leider wurde ihm am 23. Januar 2008 der Stift für immer aus der Hand ge- nommen, – obwohl er teilweise bereits „Stoff“ für einen zweiten Band gesam- melt hatte. Seitdem harrte der 2. Band seiner Entstehung ... ...Diesem in meinen Augen unbefriedigenden Zustand wollte ich, als vierter Chronist nach dem Benefiziaten Georg Heinrich, dem Rektor a.D. Josef Mundigl und dem Philologen Dr. -
Das Debakel Der Freundlichkeit Die Bayerischen Christsozialen Wollen Sich Mit Einem Neuen Steuerkonzept Aus Ihrem Umfragetief Befreien
Deutschland Führungsduo Beckstein, Huber FRANK AUGSTEIN / AP AUGSTEIN FRANK CSU Das Debakel der Freundlichkeit Die bayerischen Christsozialen wollen sich mit einem neuen Steuerkonzept aus ihrem Umfragetief befreien. Das nette, aber blasse Duo Günther Beckstein und Erwin Huber konnte die Macht- ansprüche der Partei und Bayerns bislang nicht erfüllen. Im Hintergrund lauert schon Horst Seehofer. 24 der spiegel 19/2008 wei schwarze Limousinen rollen Es geht um viel für die CSU, es sind ja dachte lange, er könne auf Streit mit langsam vor den „Leeren Beutel“ in nicht nur ein paar Prozentpunkte, die ihr Merkel verzichten, weil dies bei einer so Zder Regensburger Altstadt, die Ka- fehlen, sie muss gerade dabei zusehen, wie populären Kanzlerin nur auf Kosten der pelle spielt einen Tusch. Günther Beck- ihr Mythos zerbröselt. Jahrzehntelang war CSU gehen könne. Inzwischen ist er da- stein steigt mit seiner Ehefrau aus dem Wa- sie mehr als eine politische Kraft, sie hat es von abgekommen. gen, dann folgt Erwin Huber mit Gattin. geschafft, eins zu werden mit dem Land. Das neue Konzept soll vor allem Durch- Beckstein blickt sich kurz um und winkt Das war ihre eigentliche Stärke. Sie hat schnittsverdiener und Familien entlasten. Huber zu sich heran. Es soll ein gemeinsa- den Eindruck erweckt, als seien der weiß- Der Eingangssteuersatz soll von derzeit mer Auftritt werden. blaue Himmel und die Kastanien in den 15 auf 12 Prozent sinken. Der Spitzen- Die vier stellen sich zum Begrüßungs- Biergärten eine Erfindung der CSU. Und steuersatz bleibt bei 42 Prozent, greift aber foto nebeneinander auf, die Frauen in der sie hat diesem Bayern ein überhöhtes bun- nicht wie bisher bei 52000 Euro, sondern Mitte.