Walter MODRIJAN, Die Vor-Und Frühgeschichte
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Der Nepotismus Des Salzburger Erzbischofs Maximilian Gandolf Graf Von Khünburg (1668-1687)
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Mitt(h)eilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde Jahr/Year: 2004 Band/Volume: 144 Autor(en)/Author(s): Naschenweng Hannes Peter Artikel/Article: Der Nepotismus des Salzburger Erzbischofs Maximilian Gandolf Graf von Khünburg (1668-1687) . 99-144 © Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, Salzburg, Austria; download unter www.zobodat.at 99 Der Nepotismus des Salzburger Erzbischofs Maximilian Gandolf Graf von Khünburg (1668-1687) Von Hannes P. N aschenw eng „Unter Nepotismus versteht man die das rechte Maß übersteigende Be günstigung der Verwandten.“ Dieser Satz vom Altmeister der Salzburger Historiografie findet sich in dessen legendären Buch „Salzburgs Fürsten in der Barockzeit“ im Artikel über Erzbischof Max Gandolf von Khünburg. Der Begriff „Nepotismus“ — im Deutschen meist verächtlich mit „Vettern wirtschaft“ übersetzt — ist hauptsächlich auf die römischen Päpste des 16. und 17. Jahrhunderts angewandt worden, die ihre Neffen mit Besitzungen und Würden überhäuften und das Amt des „Kardinalnepoten“ einführten, der zur Schlüsselfigur des päpstlichen Herrschaftssystems wurde. Außen politik, Finanzverwaltung und die kuriale Administration des Kirchenstaa tes waren der Alleinverantwortung des Kardinalnepoten anvertraut1. Geist liche Reichsfürsten des 17. und 18. Jahrhunderts taten es den Päpsten gleich und auch die Salzburger Erzbischöfe waren diesbezüglich keine Ausnahme. Wenn es -
72. Robinig Von Rottenfeld. 141-144 © Gesellschaft Für Salzburger Landeskunde, Salzburg, Austria; Download Unter 141
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Mitt(h)eilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde Jahr/Year: 1940 Band/Volume: 80 Autor(en)/Author(s): Martin Franz Artikel/Article: Beiträge zur Salzburger Familiengeschichte. 72. Robinig von Rottenfeld. 141-144 © Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, Salzburg, Austria; download unter www.zobodat.at 141 wehr, Gutspächter, f..., verm. Gösen, Bez. Kaaden 15. 6. 1882 m. Gisela Herold, geb. Skirl (Böhmen) 14. 11. 1857. 2. Karoline Antonia, geb. Josefstadt (Böhmen) 13. 6. 1856. b) Kinder des Gustav (IV, 6 ): 1. Felix, geb. Wien (St. Joh.) 17. 9. 1866, f Wien (Laimgrube) 25. 11. 1907, verm. Wien-Grinzing 1. 9. 1894 m. Paula, T. d. Alois Edlen v. Hanely, Majors, geb. Lemberg (Mil.-Pf.) 29. 6. 1874. VI. a ) Kinder des Josef (V a, 1 ): 1. Gisela, geb. Gösen 24. 4. 1883. 2. Maria, geb. i884. 3. Johanna, geb---- verm. m. Lischka. 4. Moritz, geb. Gösen 24. 9. 1889, Landwirt in Puch (LK Hallein), verm. Attnang 7. 12. 1920, m. Hermine Braun, geb. Puchheim b. Att- nang 5. 2. 1902. 5. Josef Siegmund, geb. ..., Oberleutnant, f gefallen zu Olszyny (Galizien?) 20. 2. 1915, verm. m. Irma Amalia Steinwender, geb. Komotau (ev.) 14. 11. 1894. b) Kinder des Felix (V b, 1): 1. Kurt, geb. Wien (Rossau) 17. 10. 1895, NSKK-Gruppenführer der Ostmark, verm. Wien (ev. A. B.) 22. 10. 1921 m. Grete von Kopecek. 2. Edith, geb. ebda. 17. 6. 1899. VII. Sohn des Kurt (VI b, 1): Kurt, geb. Wien 15. 8. 1930. Mit gef. -

Landtagsmitglieder 1835 Bis 1848
© Historische Landeskommission für Steiermark www.hlk.steiermark.at Landtagsmitglieder 1835 bis 1848 Bearbeitet von Martin KHULL-KHOLWALD Prälaten CROPHIUS Edler von KAISERSSIEG, Ludwig Die Familie CROPHIUS wurde 1689 mit dem Prädikat Edle von KAISERSSIEG in den Adelsstand erhoben. Der Vater von Ludwig CROPHIUS Edler von KAISERSSIEG (14SEP1792–24APR1861) lebte jedoch in bescheidenen Verhältnissen und übte ein Handwerk aus. Nach der Absolvierung des Gymnasiums in Graz trat Ludwig CROPHIUS 1813 in das Zisterzienserstift Rein ein. 1827 wurde er zum Doktor der Theologie promoviert und schon im darauffolgenden Jahr bekleidete er das Amt des Rektors der Grazer Universität. 1823 war er zum Abt des Stiftes Rein gewählt worden. Dem Abt von Rein stand ein Sitz im steiermärkischen Landtag zu. Zwei Jahre nach seiner Aufnahme in den Landtag wurde Ludwig CROPHIUS zum Ausschussrat des geistlichen Standes gewählt. Später wählten ihn seine Standesgenossen zum Verordneten des Prälatenstandes. Abt Ludwig wohnte zumeist im Reinerhof in Graz. Als enger Wegbegleiter Erzherzog Johanns fungierte Ludwig CROPHIUS ab 1826 als Kurator, ab 1828 als Studiendirektor des Joanneums. Sowohl an der Erstellung der Lehrpläne der 1840 gegründeten Berg- und Hüttenakademie als auch der 1845 eröffneten Realschule wirkte er aktiv mit. Gemeinsam mit dem ständischen Archivar Josef WARTINGER, dem Historiker Albert (Anton) von MUCHAR und dem ständischen Sekretär Karl Gottfried von LEITNER initiierte er die Gründung des Historischen Vereins für Innerösterreich. Ludwig CROPHIUS engagierte sich in den Leitungsgremien der Steiermärkischen Sparkasse und der Wechselseitigen Brandschadens- versicherung.1 KERSCHBAUMER, Gottlieb Gottlieb KERSCHBAUMER (04JAN1801–01JAN1862) wurde am 15. März 1838 zum Propst des Augustiner-Chorherrenstiftes Vorau gewählt. Er entstammte einer bäuerlichen Familie aus der Umgebung des Stiftes, ging in Vorau und Graz zur Schule und studierte in Graz Theologie. -

00 Dissertation in Full.Docx
UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles The War People The Daily Life of Common Soldiers 1618-1654 A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in History by Lucian Edran Staiano-Daniels 2018 © Copyright by Lucia Eileen Staiano-Daniels 2018 ABSTRACT OF THE DISSERTATION The War People The Daily Life of Common Soldiers 1618-1654 by Lucia Eileen Staiano-Daniels Doctor of Philosophy in History University of California, Los Angeles, 2018 Professor David Sabean, Chair This dissertation aims to depict the daily life of early seventeenth-century common soldiers in as much detail as possible. It is based on intensive statistical study of common soldiers in Electoral Saxony during the Thirty Years War, through which I both analyze the demographics of soldiers’ backgrounds and discuss military wages in depth. Drawing on microhistory and anthropology, I also follow the career of a single regiment, headed by Wolfgang von Mansfeld (1575-1638), from mustering-in in 1625 to dissolution in 1627. This regiment was made up largely of people from Saxony but it fought in Italy on behalf of the King of Spain, demonstrating the global, transnational nature of early-modern warfare. My findings upend several assumptions about early seventeenth-century soldiers and war. Contrary to the Military Revolution thesis, soldiers do not appear to have become more disciplined during this period, nor was drill particularly important to their daily lives. Common soldiers also took an active role in military justice. -

Trips Around Graz Nature
TRIPS AROUND GRAZ NATURE. CULTURE. ENJOYMENT. SPORT. HEALTH. Right on Graz’s doorstep there are an endless number of things to Graz for sports activities or for relaxation and wellness? Things to see, enjoy and do. discover – and even more to enjoy ... Everything is possible! WELL WORTH THE TRIP! ACTIONS SPEAK LOUDER THAN WORDS! Leaving behind the urban flair of the city, it’s just a couple of miles For those who enjoy walking, the Styrian countryside offers a huge to the real countryside – how wonderful to breathe fresh air in the range of well-marked paths. Graz is “the most bicycle-friendly city midst of nature, to take in the beautiful, unspoilt Styrian landscape. in Austria”, and the surrounding area can also be explored by bike Discover striking natural wonders and cultural treasures, steeply slop- – whether on the bicycle path along the River Mur, a tour around ing vineyards, the summer residence of the world-famous Lipizzaner Graz or on the mountain bike routes. For golfers there is an Eldo- horses and massive stone fortresses of past centuries on the Styrian rado of wonderful golf courses! And if you’re after relaxation and castle route. Wherever you go, you’ll find the traditional delicacies wellness: close to the city lies a great variety of spas. of local cuisine – taste internationally renowned Styrian wines at the producer’s vineyard and buy fresh pumpkin-seed oil directly from the farmer to take back home with you! GRAZ TOURISMUS INFORMATION A-8010 Graz, Herrengasse 16, T +43/316/8075-0, F ext. -

Heft Seckau Heute 840411 Heftlayout
SECKAUSECKAU HEUTEHEUTE 21. Jahrgang / No. 84 – 4/11 Jahrgang / No. 21. Inhalt Nr. 84 - 4/11 THEMA 3 Wir sind alle das Werk deiner Hände (Jesaja 64,7) 6 Das Leben feiern - Liturgie im Spannungsfeld zwischen Tradi- tion und Moderne 21 Übergang (Gebet von Monika Sadegor) ABTEI 16 Seckauer Rätsel 17 60jähriges Professjubiläum von P. Severin Schneider 19 Zum Gedenken an + Prof. Dr. Günter Duffrer 22 Steirische Weihnachtskrippe 30 Bücher Bücher Bücher 38 Vergelt´s Gott allen Spendern 40 Anzeigen & Rätselauflösung 47 Der Seckauer Kunstkalender 2012 ABTEIGYMNASIUM 22 Splitter aus dem Abteigymnasium ALT-SECKAU 25 Zur Podiumsdiskussion mit bekannten Alt-Seckauern 27 Todesfälle SECKAU KULTUR 28 Programmvorschau 2012 IMPRESSUM: Herausgeber und Verleger. Benediktinerabtei Seckau, Verein Alt Seckau, Verein Seckau Kultur, Eltern- verein am Abteigymnasium Seckau, Pater Laurentius Hora Stiftung. Redaktion: P. Dr. Othmar Stary und Dipl.Päd. Stefan Nöstelthaller, 8732 Seckau 1, e-mail: [email protected]. Grundlegende Richtung: Die Zeitschrift dient der Mitteilung aktueller Geschehnisse rund um die Benediktinerabtei Seckau. Druck: Druckhaus Thalerhof, 8073 Feldkirchen, Gmeinergasse 1-3. Redaktionsschluss für das nächste Heft: 25. Februar 2012 BANKVERBINDUNGEN: Spendenkonto d er Abtei,Kto 8.000.002, BLZ 38346 RB Knittelfeld (IBAN AT353834600008000002 / BIC RZSTAT2G346) Auslandskonto der Abtei Kto 4.500.725, BLZ 75090300 LIGA Bank TITELSEITE: Sebastian Schuster und Stefan Sprinz, Schüler der 7. Klasse des AGS im Schuljahr 2011/12 Seite 2 Wir sind alle das Werk deiner Hände (Jesaja 64, 7) Gedanken von P. Othmar Stary zur Arbeit in Bildnerischer Erziehung von Sebastian Schuster und Stefan Sprinz (7. Kl.) im Schuljahr 2011/12 wei lebendig wirkende Arme strecken sich entgegen, ohne dass die eine Hand die Zandere berührt. -

Marina Brandtner Diskursverweigerung Und Gewalt Dimensionen Der Radikalisierung Des Politischen Klimas in Der Obersteirischen Industrieregion 1927–1934
Marina Brandtner Diskursverweigerung und Gewalt Marina Brandtner Diskursverweigerung und Gewalt Dimensionen der Radikalisierung des politischen Klimas in der obersteirischen Industrieregion 1927–1934 StudienVerlag Innsbruck Wien Bozen Gedruckt mit der Unterstützung des Austrian Science Fund (FWF): D 4302-G15 © 2011 by Studienverlag Ges.m.b.H., Erlerstraße 10, A-6020 Innsbruck E-Mail: [email protected] Internet: www.studienverlag.at Buchgestaltung nach Entwürfen von Kurt Höretzeder Satz: Studienverlag/Georg Toll, www.tollmedia.at Umschlag: Studienverlag/Dominika Nordholm Umschlagbild: Begräbnis der sieben Todesopfer der Exekutive beim Juli-Putsch in Leoben, Juli 1934 © Österreichische Nationalbibliothek, E3/396. Registererstellung durch die Autorin Gedruckt auf umweltfreundlichem, chlor- und säurefrei gebleichtem Papier. Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar. ISBN 978-3-7065-5059-8 Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 Danksagung 13 1. Einleitung und theoretische Grundlagen 15 1.1 Gedanken zum Thema 15 Ungeliebtes Österreich 15 1.2 Methodik und Quellen 18 1.3 Begriffsdefinitionen 20 1.3.1 Radikalismus 20 1.3.2 Formen der politischen Gewalt 21 1.4 Zum Konzept der politischen Kultur 25 1.5 Mentalitätsgeschichte: soziale Milieus und politische „Lager“ 26 1.5.1 Formierung der „Lagermentalität“ 27 1.5.2 Das sozialistisch-kommunistische Lager 28 1.5.3 Das christlichsoziale-konservative Lager 29 1.5.4 Das national-freiheitliche Lager 30 1.6 Politische und wirtschaftliche Entwicklungen in der Zwischenkriegzeit bis 1934 32 1.6.1 Steiermark 37 „Tango Korrupti“: Die Steirerbank-Affäre 38 2. -

00 Dissertation in Full.Docx
UCLA UCLA Electronic Theses and Dissertations Title The War People:The Daily Life of Common Soldiers, 1618-1654 Permalink https://escholarship.org/uc/item/3hr6185w Author Staiano-Daniels, Lucian Publication Date 2018 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles The War People The Daily Life of Common Soldiers 1618-1654 A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in History by Lucian Edran Staiano-Daniels 2018 © Copyright by Lucia Eileen Staiano-Daniels 2018 ABSTRACT OF THE DISSERTATION The War People The Daily Life of Common Soldiers 1618-1654 by Lucia Eileen Staiano-Daniels Doctor of Philosophy in History University of California, Los Angeles, 2018 Professor David Sabean, Chair This dissertation aims to depict the daily life of early seventeenth-century common soldiers in as much detail as possible. It is based on intensive statistical study of common soldiers in Electoral Saxony during the Thirty Years War, through which I both analyze the demographics of soldiers’ backgrounds and discuss military wages in depth. Drawing on microhistory and anthropology, I also follow the career of a single regiment, headed by Wolfgang von Mansfeld (1575-1638), from mustering-in in 1625 to dissolution in 1627. This regiment was made up largely of people from Saxony but it fought in Italy on behalf of the King of Spain, demonstrating the global, transnational nature of early-modern warfare. My findings upend several assumptions about early seventeenth-century soldiers and war. Contrary to the Military Revolution thesis, soldiers do not appear to have become more disciplined during this period, nor was drill particularly important to their daily lives. -

Eschichte & Eschichten G Von Knittelfeld 2
AUS DEM LEBENSLAUF EINER STADT IN DER STEIERMARK eschichte & eschichten G VON KNITTELFELD 2 Zum Werden der heutigen Steiermark Von der Kärntner Mark zum Herzogtum Steiermark (siehe Seite 10 – 12) Enns Wels Steyr HZGT. ÖSTERREICH U Wr. Neustadt TRAUNGAHERRSCH. STEYR Pitten GFT. PITTEN GFT. MÜRZTAL HZGT. Mürzzuschlag BAYERN GFT. IM ENNSTAL GFT. LEOBEN Bruck Leoben Schladming KGR. Ungarn GFT. JUDENBURG Hartberg Knittelfeld OST-STEIERMARK Judenburg Murau Neumarkt Graz Fürstenfeld KÄRNTNER MARK Wildon/Hengistburg HZGT. KÄRNTEN Leibnitz 970 Die Kärntner Mark (0bere karantanische Mark) ist die Keimzelle der Steiermark mit den vier karantanischen Grafschaften Judenburg, Leoben, Ennstal und Mürztal. 1043 Zuwachs der Grafschaft Pitten und der Ost-Steiermark. 1056 Steyr (Burg und Herrschaft) sowie der Ort Enns im Traungau kommen hinzu. 1122 Zuwachs der Gebiete um Murau und Neumarkt. 1147 Zuwachs der Gebiete um Marburg und Pettau (heute Slowenien). 1180 Steiermark ist Herzogtum. Der übrige Traungau mit dem Salzkammergut gehört über die Beziehungen zu den dort herrschenden Ministerialen (Gefolgs- leute, Dienstmannen) zur Steiermark. 1260 werden Traungau und Pitten von der Steiermark abgetrennt und kommen zum Herzogtum Österreich. 3 Zum Werden der heutigen Steiermark Von der Kärntner Mark zum Herzogtum Steiermark Enns Wels Steyr 1 HZGT. ÖSTERREICH U Wr. Neustadt Liebe Knittelfelderinnen und TRAUNGAHERRSCH. STEYR Knittelfelder! Liebe Jugend! Pitten GFT. PITTEN GFT. MÜRZTAL HZGT. Als Bürgermeister freut es mich ganz besonders, Ihnen diesen his- Mürzzuschlag BAYERN torischen Streifzug durch die Geschichte der Stadt und der Region vorzustellen. GFT. IM ENNSTAL Bruck GFT. LEOBEN Es ist ein weiter Bogen, der sich von der Jungsteinzeit über die erst- Leoben Schladming KGR. malige namentliche Erwähnung Knittelfelds bis in die Gegenwart Ungarn GFT. -
Tätigkeitsbericht 1.3.2010 – 30.9.2011
Institut für Österreichisches, Europäisches und Vergleichendes Öffentliches Recht, Politik- wissenschaft und Verwaltungslehre TÄTIGKEITSBERICHT 1.3.2010 – 30.9.2011 Institut für Österreichisches, Europäisches und Vergleichendes Öffentliches Recht, Politikwissenschaft und Verwaltungslehre Rechtswissenschaftliche Fakultät Karl-Franzens-Universität Graz Universitätsstraße 15 8010 Graz Tel. +43/316/380-3382 oder 3372 Fax +43/316/380-9450 www.uni-graz.at/opvwww Fotos: Stefan Greimel, Peter Ivankovics, Katharina Konschegg, Matthias Petritsch; privat 2 VORWORT Der vorliegende Institutsbericht umfasst den Zeitraum vom 1.3.2010 bis 30.9.2011, also die Sommersemester 2010 und 2011 und das Wintersemester 2010/2011. Zu unserem Institut ge- hören 55 Personen, Professoren und Professorinnen, wissenschaftliche und studentische Mitar- beiter und Mitarbeiterinnen und Sekretärinnen. Im Berichtszeitraum ist wieder viel geschehen: Prof. Wieser und Prof. Stöger, die schon vorher Mitglieder des Instituts waren, sind als Professo- ren nach § 98 UG berufen worden, Prof. Brünner ist emeritiert worden. Die Institutsleitung ist von Prof. Merli auf Prof. Storr gewechselt. Prof. Merli war im Berichtszeitraum Forschungsdekan und Vizedekan, Prof. Marko ist zum Dekan (ab 10/2011) ernannt worden. Sechs wissenschaftliche Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen sind ausgeschieden, neun sind neu zu uns gestoßen. Unsere institutsinternen Forschungsschwerpunkte (Südosteuropa, Gesellschaftliche Vielfalt und gesellschaftlicher Zusammenhalt, Modernisierung des Verwaltungsrechts und Steiermärkisches Landesrecht) haben wir vertieft. Dabei wollen wir die breite Forschung natürlich nicht aus den Augen verlieren, verstehen wir doch Lehre und Forschung zum gesamten Öffentlichen Recht als unseren Kernauftrag. Zudem bringen wir uns intensiv in die neuen fakultären Forschungs- schwerpunkte „Wirtschafts- und Gesellschaftsverfassung in Europa“ und „Menschenrechte, De- mokratie und Gender“ ein. Im Sommer 2010 fand eine Evaluierung der Forschungstätigkeit unseres Instituts statt. -
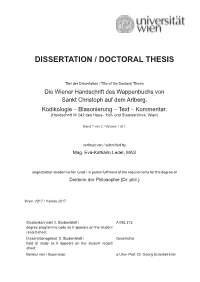
Dissertation / Doctoral Thesis
DISSERTATION / DOCTORAL THESIS Titel der Dissertation / Title of the Doctoral Thesis Die Wiener Handschrift des Wappenbuchs von Sankt Christoph auf dem Arlberg. Kodikologie – Blasonierung – Text – Kommentar. (Handschrift W 242 des Haus-, Hof- und Staatsarchivs, Wien) Band 1 von 2 / Volume 1 of 2 verfasst von / submitted by Mag. Eva-Katharin Ledel, MAS angestrebter akademischer Grad / in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doktorin der Philosophie (Dr. phil.) Wien, 2017 / Vienna 2017 Studienkennzahl lt. Studienblatt / A 092 312 degree programme code as it appears on the student record sheet: Dissertationsgebiet lt. Studienblatt / Geschichte field of study as it appears on the student record sheet: Betreut von / Supervisor: o.Univ.-Prof. Dr. Georg Scheibelreiter Vorwort Vor über zwanzig Jahren wurde der Grundstein für diese Arbeit gelegt. Frau Hon.-Prof. Dr. Chri- stiane Thomas (1938–1997), Archivarin am Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien, hat im Rahmen einer, in den Räumen des Archivs gehaltenen Vorlesung, das „Wappenbuchs von St. Christoph am Arlberg“ gezeigt. Ehrfurchtsvoll standen wir Studenten vor dieser Kostbarkeit. Nach weiteren Gesprächen gab Frau Dr. Thomas die Anregung, diese Handschrift einer genauen Bearbeitung zu unterziehen. Mein Interesse an „Heraldik und Sphragistik“ war seit der Vorlesung von Herrn o.Univ.-Prof. Dr. Georg Scheibelreiter gegeben, und so lagen Thema und Betreuung dankenswer- terweise nah beieinander. Daß Frau Dr. Thomas nur wenig später den Kampf gegen eine schwere Krankheit verlor, war sehr schmerzlich. Ihr enormes Wissen und ihre profunde Kenntnis des Akten- und Urkundenma- terials, gepaart mit ihrer Bereitschaft, dieses Wissen auch weiterzugeben, waren bis zuletzt eine große Bereicherung und Unterstützung. -

Der „Landständisch Salzburgische Militärische Sankt Ruperti Ritterorden“
© Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, Salzburg, Austria; download unter www.zobodat.at 143 Der „Landständisch Salzburgische Militärische Sankt Ruperti Ritterorden“ Von Günter Stierle Der Salzburger Erzbischof Johann Ernst Graf von Thun und Hohenstein stiftete am 12. Mai 1701 den „Ordo equestris in honorem Sancti Ruperti Ec- clesiae Salisburgensis“, den „Landständisch Salzburgischen Militärischen Sankt Ruperti Ritterorden“, zum Andenken an den heiligen Rupert, .den Gründer des Erzstifts Salzburg. Kaiser Leopold I. bestätigte den Orden am 23. August 1701 und dotierte ihn mit 12.000 Talern jährlich. Auch der Erzbischof und die Salzburger Landstände stellten ein nicht unbeträchtliches Stiftungskapital für den Orden und die Präbende der Ritter zur Verfügung. Das feierliche Stiftungsfest fand am 15. November 1701 mit der Initiation der ersten zwölf Ritter in der neu erbauten Dreifaltigkeitskirche in Salzburg statt. Angesichts der Gefahren, die von den Türken ausgingen, die mehrmals nach Mitteleuropa vorgedrungen und bis nach Wien gelangt waren, entstand die Idee, einen Orden zur Verteidigung des christlichen Abendlandes gegen den Islam zu schaffen. Es herrschte die Idealvorstellung des christlichen Rit ters, der im Zeichen des Kreuzes ins Feld zog, um das Abendland vor den Ungläubigen zu retten. Der Fürsterzbischof wollte mit der Schaffung des Ordens eine militärisch geschulte Führungsschicht heranbilden, um sich im Ernstfall ihrer Hilfe bedienen zu können. Der „Landständisch Salzburgische Militärische Sankt Ruperti Ritterorden“ war also kein Verdienstorden, son dern eine Organisation, die dem Landesherrn in Zeiten der Bedrängnis bei stehen sollte. Zur Zeit des Ordensstifters Johann Ernst kam es zu einer Blüte des Ordens, während sich seine Nachfolger nur wenig um sein Gedeihen kümmerten. Im Jahr 1722 wurde die Präbende für die Ordensritter erhöht.