Icos23 1097.Pdf (536.8Ko)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Zum Vorgeschichtlichen Verkehr an Der Elbe Zwischen Böhmen Und Sachsen Raum- Und Funktionskontinuität Der Besiedlung Des Elbdurchbruchs Vladimír Salaˇc
Zum vorgeschichtlichen Verkehr an der Elbe zwischen Böhmen und Sachsen Raum- und Funktionskontinuität der Besiedlung des Elbdurchbruchs Vladimír Salaˇc Die Elbe stellt den einzigen Wasserweg dar, der Am intensivsten wurde der Elbdurchbruch für Dieser Beitrag wurde im Rahmen Sachsen und Böhmen miteinander verbindet, die den Verkehr wahrscheinlich in der jüngeren Ei- des Programms Strategie AV21 der sonst durch Grenzgebirge voneinander getrennt senzeit (Latènezeit, etwa 4. bis 1. Jahrhundert v. Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik zum Druck sind. Diese Flussverbindung zwischen den bei- Chr.) genutzt. Für diese Zeit gilt die Elbe als Ver- vorbereitet. den Ländern wurde schon seit dem Neolithikum bindung zwischen zwei unterschiedlichen kultu- (etwa seit 5.500 v. Chr.) benutzt, damals jedoch rellen und wahrscheinlich auch ethnischen eher nur für Prospektionsreisen. Auch in den fol- Kreisen – der Welt der in Böhmen vorkommen- genden Jahrtausenden wurde der Landweg über den latènezeitlichen Kultur, die den Kelten zu- den Nollendorfer Pass im Osterzgebirge bevor- geschrieben wird, und der Welt der Kultur der zugt, denn dieser Weg war für die Umsiedlungs- vorrömischen Eisenzeit, die am mittleren und bzw. Kolonisationsströmungen, für das Viehher- unteren Flusslauf der Elbe verbreitet war und detreiben oder für den eher gelegentlichen den Germanen zugeschrieben wird. Beim Blick Transport günstiger.1 Erst seit der jüngeren auf die Karte mag es scheinen, dass das Erzge- Bronzezeit (etwa seit 1.000 v. Chr.) hat sich die birge und das -

Amtliches Mitteilungsblatt | Stadt Dohna Und Gemeinde Müglitztal Okal Anzeiger
Amtliches Mitteilungsblatt | Stadt Dohna und Gemeinde Müglitztal okal Anzeiger Region Dresden – Excellence for business Freitag, den 8. Februar 2019 29. JAHRGANG NUMMER 2 BORTHEN | BOSEWITZ BURGSTÄDTEL BURKHARDSWALDE CROTTA | DOHNA FALKENHAIN | GAMIG GORKNITZ | KÖTTEWITZ KREBS | MAXEN MEUSEGAST MÜHLBACH | RÖHRSDORF SCHMORSDORF SÜRSSEN | TRONITZ WEESENSTEIN Lokalanzeiger online lesen: Jens Nowotny und Bürgermeister Dr. Ralf Müller - Foto: Marko Förster Die 5. Offene Sächsische Meisterschaft „Mensch ärgere Dich nicht“ fand in Dohna am 12.01.2019 statt. Lesen Sie weiter auf Seite 20. Veranstaltungen ab Seite 24. Seite 2 Lokalanzeiger der Stadt Dohna und der Gemeinde Müglitztal Nummer 2 Stadt Dohna Telefonverzeichnis der Stadtverwaltung Dohna Sprechzeiten der Postadresse: Am Markt 10/11, 01809 Dohna, Telefon: 03529 5636-0, Fax: 03529 5636-99 [email protected], www.stadt-dohna.de Stadtverwaltung Dohna Bereich Bürgermeister Bürgermeister 03529 563610 Am Markt 10/11 Büro Bürgermeister/Öffentlichkeitsarbeit 03529 563611 Montag + Mittwoch geschlossen Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bau Dienstag 8.30 - 12.00 Uhr Fachbereichsleiter 03529 563620 Sitzungsdienst/Sekretariat Fachbereichsleiter 03529 563621 und 13.30 - 18.00 Uhr Gewerbe/Ordnungswidrigkeiten 03529 563622 Donnerstag 8.30 - 12.00 Uhr Außendienst Ordnungsamt/Marktfestsetzung 03529 563623 und 13.30 - 15.30 Uhr Brandschutz/Verkehrsrecht 03529 563624 Freitag 8.30 - 12.00 Uhr Personal 03529 563625 (Standesamt freitags geschlossen) Widerspruchsstelle/Vergabestelle (VOL) 03529 563657 Bürgermeistersprechstunde -

Mittelalterliche Eliten Und Kulturtransfer Östlich Der Elbe
Anne Klammt und Sébastien Rossignol (Hg.) Mittelalterliche Eliten und Kulturtransfer Beeinflussungen der Eliten des westlichen und östlichen Mitteleuropas im Mittelalter? Ist es östlich der Elbe gleichermaßen für die Untersuchung schriftlicher wie materieller Quellen geeignet? Öffnet sene Geschichte des Raumes östlich der Elbe? Interdisziplinäre Beiträge zu Archäologie und Geschichte im mittelalterlichen Ostmitteleuropa Universitätsverlag Göttingen Anne Klammt und Sébastien Rossignol (Hg.) Mittelalterliche Eliten und Kulturtransfer östlich der Elbe This work is licensed under the Creative Commons License 2.0 “by-nd”, allowing you to download, distribute and print the document in a few copies for private or educational use, given that the document stays unchanged and the creator is mentioned. You are not allowed to sell copies of the free version. erschienen im Universitätsverlag Göttingen 2009 Anne Klammt und Sébastien Rossignol (Hg.) Mittelalterliche Eliten und Kulturtransfer östlich der Elbe Interdisziplinäre Beiträge zu Archäologie und Geschichte im mittelalterlichen Ostmitteleuropa Universitätsverlag Göttingen 2009 Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar. Gefördert durch die DFG im Rahmen des Zukunftskonzepts der Georg-August-Universität Göttingen Anschrift der Herausgeber Dr. Sébastien Rossignol Anne Klammt York University Georg-August-Universität Göttingen Department of History Seminar für Ur- und Frühge Danksagung Der vorliegende Sammelband enthält die Vorträge des ersten Treffens der interdis- ziplinären Arbeitsgruppe „Gentes trans Albiam – Europa östlich der Elbe im Mittel- alter.“ Es ist uns eine große Freude, dass sich in Göttingen 2007 ein gelungenes Treffen mit Gästen aus vier verschiedenen Ländern realisieren ließ und nun zudem diese Publikation entstanden ist. -

Sattelberg Und Gottleubatal Karte 597 598 Sattelberg Und Gottleubatal
596 Sattelberg und Gottleubatal Karte 597 598 Sattelberg und Gottleubatal 1 Špičák / Sattelberg 13 Tannenbusch 2 Wiesen zwischen Oelsener Höhe 14 Gesundheitspark Bad Gottleuba und Sattelberg 15 Poetengang 3 Oelsener Höhe 16 Panoramahöhe 4 Mordgrund und Bienhof 17 Hochstein und Karlsleite 5 Stockwiese 18 Seismologisches Observatorium 6 Strompelgrund und Bocksberg Berggießhübel 7 Rundteil 19 Schaubergwerk Marie-Louise-Stolln 8 Oelsengrund 20 Bergbauzeugnisse im Fuchsbachtal (Martinszeche) 9 Talsperre Gottleuba 21 Gottleubatal unterhalb Zwiesel 10 Bahretal, Eisengrund und Heidenholz 22 Zeisigstein 11 Hohler Stein 23 Tiské stěny / Tyssaer Wände 12 Raabsteine Die Beschreibung der einzelnen Gebiete folgt ab Seite 609 Landschaft Ostflanke Landschaftlich außerordentlich abwechslungsreich ist die Ostflanke des des Erzge- Erzgebirges. Unter den Tiské stěny/Tyssaer Wänden und dem Zeisigstein birges verschluckt die Sächsisch-Böhmische Schweiz die Gneisscholle des Ost- Erzgebirges unter sich. Doch haben sich auch weiter westlich noch Reste Sandstein der Sandsteindecke erhalten, die am Ende der Kreidezeit einst ebenfalls über Gneis das Ost-Erzgebirge überlagert hatte (z. B. Raabstein, Wachstein, Fuß des Sattelberges). Im Nordosten findet das Erzgebirge an den vielfältigen Gesteinen des Elb- talschiefergebirges seinen Abschluss. Besonders der Turmalingranit, ein hartes, fast 500 Millionen Jahre altes Gestein, überragt mit einigen mar- kanten Erhebungen – Schärfling, Herbstberg, Helleberg, Tannenbusch – die Landschaft. Dieser Härtlingszug, der sich im Nordwesten mit der Quarz- porphyrkuppe des Roten Berges bei Borna fortsetzt, markiert als Ausläufer der Mittelsächsischen Störung die Grenze des Naturraumes Ost-Erzgebirge. Jenseits dominieren verschiedene Ton-Schiefer (Phyllite) sowie der Mar- Elbtal- kersbacher Granit. Als während der Entstehung des Elbtalschiefergebirges schiefer- dieses granitische Magma aufdrang, führten die damit einhergehenden gebirge enormen Hitze- und Druckbedingungen zur Umwandlung (Kontaktmeta- morphose) des umliegenden Gesteins. -

Neubau Der a 17/D 8 Dresden – Prag Výstavba Dálnice D 8/A 17 Praha – Drážďany
VIA PORTA BOHEMICA Neubau der A 17/D 8 Dresden – Prag Výstavba dálnice D 8/A 17 Praha – Drážďany Dieses Projekt wird von der Europäischen Union kofinanziert Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií Dokumentation / Dokumentace 2006 im Auftrag / vypracována z pověření der Bundesrepublik Deutschland Spolkové republiky Německo der Tschechischen Republik České republiky des Freistaates Sachsen Svobodného státu Sasko DEGES Zum Geleit Inhalt Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung Seite 4 Verkehrsminister der Tschechischen Republik Seite 7 Sächsischer Staatsminister für Wirtschaft und Arbeit Seite 8 Hauptmann des Bezirks Ústí nad Labem Seite 11 Historie Von Poststraßen und Meilensteinen Seite 12 Erst mit Öffnung der Grenzen wurde das Autobahnprojekt A 17/D 8 konkret Seite 16 Neubeginn Höchste Priorität für den Aufbau einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur Seite 18 Planung A 17/D 8 – ein wichtiger Lückenschluss im europäischen Fernstraßennetz Seite 22 Bürger und Träger öffentlicher Belange machten ihre Interessen geltend Seite 28 Aufwändiger Prozess zur Linienfindung Seite 32 Hohe Anforderungen an den Schutz von Natur und Umwelt Seite 36 Entlastung vom Durchgangsverkehr und Verbesserung der Erreichbarkeit Seite 40 Rechtzeitige Baubeginne durch frühzeitige Flächensicherung Seite 44 Die A 17 im Freistaat Sachsen Maßnahmen 1. Abschnitt: AD Dresden-West – AS Dresden-Süd Seite 46 Technisch aufwändige Kombination von Tunnel – Brücke – Tunnel Seite 50 2. Abschnitt: AS Dresden-Süd – AS Pirna Seite 52 3. Abschnitt: AS Pirna – -

Pressemappe Sonderausstellung 2021
PRESSEMAPPE Pressemappe zur Sonderausstellung 2021: Viel früher als gedacht! Der Königstein in der Bronzezeit Seite 1 von 14 Lebten vor 3000 Jahren tatsächlich schon Menschen auf dem Tafelberg Königstein in der Sächsischen Schweiz? Ein archäologischer Sensationsfund belegt das! Jetzt gibt es auf der Festung Königstein erstmals eine Sonderausstellung zu diesem Thema. Sie zeigt nicht nur die hier gefundenen Keramikscherben, sondern auch zahlreiche weitere Funde aus der Region. Modelle, Medienstationen und museumspädagogische Angebote vermitteln darüber hinaus wichtige Erkenntnisse und fügen sie zu einem faszinierenden Gesamtbild zusammen. Wie haben die Menschen damals im Elbtal gelebt? Wie sahen ihre Häuser und ihr Schmuck aus? Welche Handwerke haben sie betrieben, wie haben sie sich ernährt? Was weiß man über Religion, Bestattungskultur und Kriegführung? Nur die Archäologie kann Auskunft geben über diese ferne Epoche, aus der es keine schriftlichen Überlieferungen gibt. Die Ausstellung wirft einen Lichtstrahl auf eine Welt, von der so vieles noch im Dunkeln liegt. Pressemappe zur Sonderausstellung 2021: Viel früher als gedacht! Der Königstein in der Bronzezeit Seite 2 von 14 Inhalt Daten und Fakten....................................................................................................................... 4 „Viel früher als gedacht! Der Königstein in der Bronzezeit“ .................................................... 4 Die Ausstellung ......................................................................................................................... -

Bad Gottleuba – Berggießhübel
Doppelkurort Bad Gottleuba – Berggießhübel Sehenswertes l Kur l Wellness l Wandern l Gastgeber Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Herzlich willkommen! 3 – 7 Aktiv erholen 32 – 44 Touristinformationen im Doppelkurort 3 Freibad Billy 32 Gästekarte Sächsische Schweiz 3 Tennisplatz Berggießhübel 33 Im Wandel der Jahreszeiten 4 – 7 Kegeln & Bowling • Tischtennis • Frauen-Fit 33 Fahrradbus und Radtouren 34 Ortsgeschichten 8 – 12 Karte Sächsische Schweiz und Böhmische Schweiz 36 – 37 Wanderkarten und „Wanderfreund“ 38 Moorheilbad Bad Gottleuba 8 Geführte Wanderungen und Wandererlebnisse 39 Kneippkurort Berggießhübel 9 Wandererlebnisse direkt vor der Haustür 40 Bahra, Zwiesel und Langenhennersdorf 10 Wandererlebnisse in Tschechien 41 Hellendorf, Markersbach und Oelsen 11 Wandererlebnisse Labyrinth Langenhennersdorf 42 Börnersdorf, Breitenau und Hennersbach 12 Terrainkurwege 43 Service und Veranstaltungen 14 – 20 Kur, Wellness und Entspannung 46 – 58 Statistische Daten • Kurbote • Publikationen 14 Bioenergetische Gesundheitsberatung 46 Veranstaltungskalender (Auswahl) 15 Dr. Medi-Fisch – ein besonderes Erlebnis 46 Service von A bis Z 16 – 17 Salzscheune Berggießhübel 47 Wohnmobil- und Zeltplätze 17 Saunieren • Wassertreten Parkplätze 17 im Kneippkurort Berggießhübel 48 Geschäfte und Dienstleistungen 18 – 19 Ihr Weg zur Kur 49 Restaurants und Cafés 20 Moorheilbad Bad Gottleuba 50 Kneippkurort Berggießhübel 51 Sehenswertes im Gottleubatal 22 – 30 MEDIAN Gesundheitspark Bad Gottleuba 52 Besucherbergwerk „Marie Louise Stolln“ 22 – 25 MEDIAN Klinik -

Archeologické Rozhledy 2009
NOVÉ PUBLIKACE ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, PRAHA, v.v.i. NEW BOOKS FROM THE INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY IN PRAGUE ARCHEOLOGIE PRAVĚKÝCH ČECH. Sv. 1–8. Editoři řady: Luboš Jiráň – Natalie Venclová. Praha 2007–2008. Při odběru kompletní řady 2790 Kč; ceny jednotlivých svazků viz níže. – Czech. Complete set: 110 €. Svazek 1: Martin Kuna (ed.) et al.: Pravěký svět a jeho poznání. Praha 2007. 163 s. 400 Kč / 16 €. Svazek 2: Slavomil Vencl (ed.) – Jan Fridrich: Paleolit a mezolit. Praha 2007. 164 s. 400 Kč / 16 €. Svazek 3: Ivan Pavlů (ed.) – Marie Zápotocká: Neolit. Praha 2007. 118 s. 320 Kč / 13 €. Svazek 4: Evžen Neustupný (ed.) et al.: Eneolit. Praha 2008. 185 s. 420 Kč / 16 €. € Archeologické rozhledy LXI–2009, sešit 4 Svazek 5: Luboš Jiráň (ed.) et al.: Doba bronzová. Praha 2008. 265 s. 450 Kč / 18 . Svazek 6: Natalie Venclová (ed.) et al.: Doba halštatská. Praha 2008. 173 s. 400 Kč / 16 €. Recenzovaný časopis Svazek 7: Natalie Venclová (ed.) et al.: Doba laténská. Praha 2008. 164 s. 400 Kč / 16 €. Vydává Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i. Svazek 8: Vladimír Salač (ed.) et al.: Doba římská a stěhování národů. Praha 2008. 214 s. 400 Kč / 16 €. Peer–reviewed journal published by the Institute of Archaeology, Prague. Jaromír Beneš – Petr Pokorný edd.: BIOARCHEOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE – Bioarchaeology in the Czech Republic. České Budějovice – Praha 2008. 518 s. Czech with English summaries. 400 Kč / 14 €. http://www.arup.cas.cz BURG – VORBURG – SUBURBIUM. ZUR PROBLEMATIK DER NEBENAREALE FRÜHMITTELATERLICHER http://www.arup.cas.cz/cz/publikace/rozhledy.html ZENTREN. -
Spuren Alter Mühlen an Der Gottleuba Und Ihren Neben- Chronik 2011 Flüssen
Spuren alter Mühlen an der Gottleuba und ihren Neben- Chronik 2011 flüssen von Annemarie und Siegfried Fischer Pirna Elbe Zehista z it w Rottwerndorf e id e S Neundorf e r h a Nentmannsdorf B Friedrichswalde- Langen Ottendorf hennersdorf Gersdorf Berggießhübel Liebstadt Bahra Göppersdorf a r Bad h a Gottleuba B Markersbach Hellendorf Hennersbach a b u le tt ehem. Mühle o G Mühle wüst Alte Mühlen und Eisenhämmer (Hütten) an der Gottleuba einschließlich der Bahra, Bahre und Seidewitz von Annemarie und Dr. Siegfried Fischer Inhalt 1 Historischer Hintergrund. 1 2 Mühlen an der Gottleuba. 5 2.1 Oberlauf der Gottleuba. 5 2.2 Stadtgebiet von Bad Gottleuba. 11 2.3 Stadtgebiet von Berggießhübel. 25 2.4 Gemeinde Langenhennersdorf. 30 2.5 Mühlen bis zum Stadtgebiet von Pirna. 34 2.6 Stadtgebiet von Pirna.. 40 3 Mühlen an der Bahra. 45 3.1 Gemeinde Oelsen-Bienhof.. 45 3.2 Gemeinde Hellendorf. 47 3.3 Gemeinde Markersbach.. 53 3.4 Gemeinden Bahra und Langenhennersdorf. 57 4 Mühlen an der Bahre und der Seidewitz. 63 4.1 Mühlen an der Bahre. 63 4.2 Mühlen an der Seidewitz. 67 Literatur.. 77 Index.. 77 Autoren: Annemarie und Dr. Siegfried Fischer, Am Queckbrunnen 1, 01067 Dresden Bildnachweis: Die Fotos und Abbildungen wurden, so weit es nicht anders angegeben, aus der umfangreichen Sammlung der Autoren bereitgestellt. Für die namentlich ausgewiesenen Fotos liegt das Einver- ständnis für die Publikation vor. In der Sammlung sind Bilder enthalten, deren Herkunft nicht mehr eindeutig feststellbar ist. Sollte es diesbezüglich rechtliche Ansprüche geben, so bitten die Autoren das zu entschuldigen und um Nachricht. -

0Xc1aa5576 0X003ace32.Pdf
Maciej Karwowski, Peter C. Ramsl (Eds.) Boii – Taurisci Österreichische Akademie der Wissenschaften Philosophisch-historische Klasse Mitteilungen der Prähistorischen Kommission Seit 1.1.2013 ist die Prähistorische Kommission in das Institut für Orientalische und Europäische Archäologie integriert. Herausgegeben von Barbara Horejs BAND 85 Publikationskoordination: Estella Weiss-Krejci Redaktion: Ulrike Schuh, Estella Weiss-Krejci Maciej Karwowski, Peter C. Ramsl (Eds.) Boii – Taurisci Proceedings of the International Seminar, Oberleis-Klement, June 14th−15th, 2012 Vorgelegt von JK Barbara Horejs in der Sitzung vom 30. Jänner 2015 Veröffentlicht mit Unterstützung des Austrian Science Fund (FWF): PUB-264-G25 und der Abteilung Wissenschaft und Forschung der Gruppe Kultur, Wissenschaft und Unter richt des Amtes der Nieder österreichischen Landesregierung. Open Access: Wo nicht anders festgehalten, ist die Publikation lizenziert unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung 4.0 Diese Publikation wurde einem anonymen, internationalen Peer-Review-Verfahren unterzogen. This publication has undergone the process of anonymous, international peer review. Cover images: Front: Celtic coin deposit from Bratislava Castle, Winter riding school (Photograph: L. Lovíšková; © MÚOP, Bratislava). Spine: fibula of the Zvonimirovo type, unknown site (S. Gabrovec, 1965, Kamniško ozemlje v prazgodovini, Kamniški zbornik 10, Pl. XI/3). Back: Knotenring from the Oberleiserberg (H. Mitscha-Märheim, E. Nischer-Falkenhof, 1929, Der Oberleiser- berg, MPK 2/5, Pl. VI/3). Translation and language editing: Madeleine Hummler, Mark Pluciennik, Katharina Rebay-Salisbury, Roderick Salisbury, Estella Weiss-Krejci Copy-editing and index: Katharina Preindl, Ulrike Schuh, Estella Weiss-Krejci Layout concept: Thomas Melichar Die verwendeten Papiersorten sind aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt, frei von säurebildenden Bestandteilen und alterungsbeständig. The paper used for this publication was made from chlorine-free bleached cellulose and is aging-resistant and free of acidifying substances. -
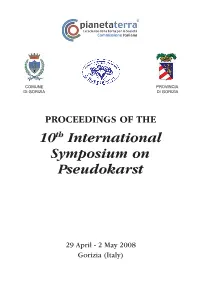
Proceedings of the 10. Pseudokarst Symposium
COMUNE PROVINCIA DI GORIZIA DI GORIZIA PROCEEDINGS OF THE 10th International Symposium on Pseudokarst 29 April - 2 May 2008 Gorizia (Italy) Stampato con il contributo della FEDERAZIONE SPELEOLOGICA REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Foto, disegni e testi sono stati consegnati su supporto informatico dagli autori. Pertanto la qualità delle immagini rispecchia la risoluzione grafica fornita dagli stessi. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o utilizzata in alcun modo senza preventiva autorizzazione. Il contenuto e la forma impegnano esclusivamente gli autori. Stampa: Tipografia Budin - Gorizia Organizzazione / Organization INTERNATIONAL UNION OF SPELEOLOGY Commission for Pseudokarst CENTRO RICERCHE CARSICHE CARLO SEPPENHOFER - GORIZIA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA In collaborazione con / With the collaboration COMUNE DI GORIZIA PROVINCIA DI GORIZIA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA Con il patrocinio di / Promoted by INTERNATIONAL UNION OF SPELEOLOGY UNION INTERNATIONALE DE SPÉLÉOLOGIE SOCIETA SPELEOLOGICA ITALIANA PROVINCIA DI GORIZIA COMUNE DI GORIZIA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA ISONTINA METSO PAPER GORIZIA S.p.A. KERATECH GAUDENZI ATTILIO GORIZIA Comitato scientifico / Scientific committee Fabio Forti (Trieste Italy) Paolo Forti (Bologna Italy) Graziano Cancian (Gorizia Italy) Maurizio Comar (San Canzian dIsonzo GO Italy) Comitato organizzatore / Organizing committee Maurizio Tavagnutti (Chairman) Cristina Pussig (Secretary) Maurizio Comar (Excursions) Erika Devetak (Secretary Translater service) Sabrina Peric (Secretary Translater service) Indirizzo organizzazione The organizers address 10th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PSEUDOKARST Centro Ricerche Carsiche Carlo Seppenhofer Via Ascoli, 7 - 34170 Gorizia (Italy) Tel./Fax. 0039/0481/82012 - e-mail: [email protected] 4 MEINE SEHR GEERTE DAMEN UND HERREN WERTE GÄSTE! Im Namen des Pseudokarstischen Kommissions von der Internationalen Union für Speläo- logie möchte ich alle Teilnehmer am 10. -

Depot Zbraní Z Doby Římské V Krušnohorské Hrádečné, Okr. Chomutov
554 Archeologické rozhledy LXX–2018 554–595 Depot zbraní z doby římské v krušnohorské Hrádečné, okr. Chomutov A Roman Period weapon hoard from Hrádečná in the Erzgebirge Mts., northwest Bohemia Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska – Marek Půlpán – Lenka Ondráčková Na k. ú. obce Hrádečná (okr. Chomutov, Ústecký kraj) byl při amatérském detektorovém průzkumu v roce 2003 objeven hromadný nález výzbroje a výstroje z doby římské čítající celkem 21 železných předmětů a vážící 2,3 kg. Součást výzbroje tvoří meč a 11 hrotů kopí/oštěpů; výstroj je zastoupena elementy několika štítů (4 puklice, 5 držadel). Na základě typologicko-chronologické analýzy lze předměty datovat rámcovým rozpětím stupňů B1–C1. Charakteristickým rysem souboru je jeho intencionální zničení. Nález umístěný mimo sídelní a funerální areály představuje ojedinělý doklad lidské aktivity v době římské v centrální části Krušných hor. Přes nejisté nálezové okolnosti lze klást soubor do souvislostí s rituálním chováním a interpretovat jej jako ireverzibilní depot uložený někdy na přelomu starší a mladší doby římské z votiv- ních důvodů. doba římská – Krušné hory – zbraně – štít – meč – kopí/oštěp – depot – votivní obětina An amateur metal detector survey conducted in 2003 in the cadastre of the town of Hrádečná (Chomutov district, Ústí nad Labem Region) uncovered a mass find of arms and gear from the Roman Period with a total of 21 iron artefacts weighing 2.3 kg. The weapons include a sword and 11 lances/spears; gear is made up of parts of several shield (4 bosses, 5 grips). Based on a typological-chronological analysis, the artefacts can be dated in general to the interval between phases B1–C1.