Landschaftsqualitätsprojekt Albulatal
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Graubünden for Mountain Enthusiasts
Graubünden for mountain enthusiasts The Alpine Summer Switzerland’s No. 1 holiday destination. Welcome, Allegra, Benvenuti to Graubünden © Andrea Badrutt “Lake Flix”, above Savognin 2 Welcome, Allegra, Benvenuti to Graubünden 1000 peaks, 150 valleys and 615 lakes. Graubünden is a place where anyone can enjoy a summer holiday in pure and undisturbed harmony – “padschiifik” is the Romansh word we Bündner locals use – it means “peaceful”. Hiking access is made easy with a free cable car. Long distance bikers can take advantage of luggage transport facilities. Language lovers can enjoy the beautiful Romansh heard in the announcements on the Rhaetian Railway. With a total of 7,106 square kilometres, Graubünden is the biggest alpine playground in the world. Welcome, Allegra, Benvenuti to Graubünden. CCNR· 261110 3 With hiking and walking for all grades Hikers near the SAC lodge Tuoi © Andrea Badrutt 4 With hiking and walking for all grades www.graubunden.com/hiking 5 Heidi and Peter in Maienfeld, © Gaudenz Danuser Bündner Herrschaft 6 Heidi’s home www.graubunden.com 7 Bikers nears Brigels 8 Exhilarating mountain bike trails www.graubunden.com/biking 9 Host to the whole world © peterdonatsch.ch Cattle in the Prättigau. 10 Host to the whole world More about tradition in Graubünden www.graubunden.com/tradition 11 Rhaetian Railway on the Bernina Pass © Andrea Badrutt 12 Nature showcase www.graubunden.com/train-travel 13 Recommended for all ages © Engadin Scuol Tourismus www.graubunden.com/family 14 Scuol – a typical village of the Engadin 15 Graubünden Tourism Alexanderstrasse 24 CH-7001 Chur Tel. +41 (0)81 254 24 24 [email protected] www.graubunden.com Gross Furgga Discover Graubünden by train and bus. -

Switzerland 4Th Periodical Report
Strasbourg, 15 December 2009 MIN-LANG/PR (2010) 1 EUROPEAN CHARTER FOR REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES Fourth Periodical Report presented to the Secretary General of the Council of Europe in accordance with Article 15 of the Charter SWITZERLAND Periodical report relating to the European Charter for Regional or Minority Languages Fourth report by Switzerland 4 December 2009 SUMMARY OF THE REPORT Switzerland ratified the European Charter for Regional or Minority Languages (Charter) in 1997. The Charter came into force on 1 April 1998. Article 15 of the Charter requires states to present a report to the Secretary General of the Council of Europe on the policy and measures adopted by them to implement its provisions. Switzerland‘s first report was submitted to the Secretary General of the Council of Europe in September 1999. Since then, Switzerland has submitted reports at three-yearly intervals (December 2002 and May 2006) on developments in the implementation of the Charter, with explanations relating to changes in the language situation in the country, new legal instruments and implementation of the recommendations of the Committee of Ministers and the Council of Europe committee of experts. This document is the fourth periodical report by Switzerland. The report is divided into a preliminary section and three main parts. The preliminary section presents the historical, economic, legal, political and demographic context as it affects the language situation in Switzerland. The main changes since the third report include the enactment of the federal law on national languages and understanding between linguistic communities (Languages Law) (FF 2007 6557) and the new model for teaching the national languages at school (—HarmoS“ intercantonal agreement). -

Churwalden 129./36
AZA • 7007 Chur Preis Fr.2.90 ElektroRüegg AG Lenzerheide, Lantsch/Lenz www.ruegg-elektro.ch lokalzeitungund amtlichepublikationenfür gemeinden Nr.7,16. Februar 2018 der region albula/alvraund diegemeinde churwalden 129./36. Jahrgang Super Set-Angebote Zuerst testen, dann kaufen! Activ SportBaselgia, Ihr Langlaufprofi in Lenzerheide und der Biathlonarena Tel. +41 81 384 25 34 [email protected], www.activ-sport.ch SUPERIOR «zum z’Mittag und z’Nacht» Tel. 081 384 12 86 Edwina &Silvano Beltrametti und Familie Parpan VoaTgantieni 17 |7078Lenzerheide www.tgantieni.ch |[email protected] SCHLAGKRÄFTIG Immobilienverkauf Immobilienverwaltung Lokal. Kompetent. Engagiert. AUF DER BÜHNE Bild NicoleTrucksess In Lantsch/Lenz wird wieder Theater gespielt +41 81 356 37 69 Lenzerheide Bad JostService www.weishaupt-ag.ch Alvaneu Jost Heizung &Sanitär Service AG Heizung |Sanitär Badezentrum täglich geöffnet BenötigenSie eine neue Heizung? Ölfeuerung von 10 –20Uhr und freitagsvon 10 –21Uhr Wärmepumpen …MWir sindacht’sfür Siepersda!önlich! Solarsystem SLAM & Bad Alvaneu Haushaltapparate Tel. 081 420 44 00 HOWIE www.bad-alvaneu.ch 7083 Lantsch/Lenz |Telefon 08168112 10 |[email protected] Boiler-Entkalkungen LIVE Samstag 17.2.18 07 ab 21:30 Uhr MeinRevier.com 9771424 748007 2|novitats Freitag, 16. Februar 2018 DIE SCHAUSPIELER Christian Ulber: Franz Biberli Markus Bläsi:Friedrich Breitenbach (der Brauer) Patrick Ulber: Friedrich Breitenbach (der Sohn) Marco Lorenz: Friedrich Breitenbach (der echte Boxer) Nadia Sinha: Zoé Breitenbach (die Tochter) Andrea Simeon: Jane Breitenbach Ingrid Schneider: Walburga Biberli Paul Nadig: Johann, der Butler Nicole Rizzi: Coletta, die Tänzerin Adrian Cadosch: Jean Hecht Regie: Thomas Rehsteiner Regisseur Thomas Rehsteiner bespricht in einer kurzen Probenpause eine Szene mit Nadia Sinha, die im Licht: Roman Simeon Stück Zoé Breitenbach spielt. -

5. Protection and Management of the Property
Candidature UNESCO World Heritage | Rhaetian Railway in the Albula/Bernina Cultural Landscape | www.rhb-unesco.ch 5. Protection and Management of the Property 5.a Ownership > 511 5.b Protective designation > 513 5.c Means of implementing protective measures > 535 5.d Existing plans related to municipality and region > 551 in which the proposed property is located 5.e Property management plan or other management system > 557 5.f Sources and levels of finance > 561 5.g Sources of expertise and training in conservation > 565 and management techniques 5.h Visitor facilities and statistics > 571 5.i Policies and programmes related to the presentation > 577 and promotion of the property 5.j Staffing levels > 579 Additional Information > 5. Protection and Management > Table of contents 509 Candidature UNESCO World Heritage | Rhaetian Railway in the Albula/Bernina Cultural Landscape | www.rhb-unesco.ch Albula line > The Glacier Express leaving Celerina. A. Badrutt / Rhaetian Railway Additional Information > 5. Protection and Management > 5.a Ownership 510 Candidature UNESCO World Heritage | Rhaetian Railway in the Albula/Bernina Cultural Landscape | www.rhb-unesco.ch 5.a Ownership The rail infrastructure of the Albula/Bernina line is owned by the Rhaetian Railway. The remain- ing ownership structures within the nominated World Heritage perimeter are also clearly de- fined, and the applicable terms and conditions are set out in the land register. Real property Company property The land and buildings in the core zone directly All structures in the core zone are owned by the serve rail operations and are, for the most part, Rhaetian Railway. The necessary legal basis, owned by the Rhaetian Railway. -

Pfarreiblatt Graubünden, Ausgabe
GRAUBÜNDEN Nummer 72/73 | Juli/August 2021 PFARREIBLATT Fegl parochial grischun | Bollettino parrocchiale grigione 2 Pfarreiblatt Graubünden | Juli/August 2021 MARIÄ HIMMELFAHRT – Editorial Foto: Atelier LE RIGHE GmbH Foto: EIN FEST DES ZEITGEISTS Liebe Leserin Lieber Leser Das Fest Mariä Himmelfahrt am 15. August kann als leibliches Die Aufnahme Mariens in den Himmel ist Fest bezeichnet werden. Denn es besagt, dass Maria, die eines der grossen Feste im August. Warum Mutter Jesu, am Ende ihres irdischen Lebens mit Leib und dieses alte Fest eigentlich sehr gut in un- Seele in den Himmel aufgenommen worden ist. sere heutige Zeit passt, lesen Sie auf den ersten beiden Seiten. Seit dem 7. Jahrhundert wird das Fest Mariä Himmelfahrt begangen –, und dennoch entspricht es dem heutigen Zeitgeist eigentlich sehr gut. Zeigen Besonders freut mich, dass wir in dieser die verschiedenen Angebote für Wellness-Wochenenden, die zahlreichen Fit- Ausgabe des «Pfarreiblatts Graubünden» ness-für-daheim-Filme und die ungezählten Ratgeber für die Erholung von von unserem Bischof Joseph Maria ein Körper und Geist doch deutlich auf: Das Bemühen und die Sorge um Köper anregendes Sommerwort mit auf den Weg und Geist ist ein aktuelles Thema. Die korrekte Benennung des Feiertags lautet Fest der «Aufnahme Marias in erhalten (S. 4). Schon jetzt wünschen wir den Himmel». Damit wird die theologische Unterscheidung zur Himmelfahrt ihm einen problemlosen Umzug und freuen Christi ausgedrückt. An Maria vollzieht sich beispielhaft das, was jedem Ge- uns auf seine Wohnsitznahme in unserem tauften nach christlicher Lehre zugesagt wird: die Auferstehung von den To- ten mit Leib und Seele. Kanton. Mit dem Fest wird zudem in bildhafter Sprache gezeigt, wozu Mensch und Bestimmt haben Sie aus der Tagespresse Welt durch Gottes Willen berufen sind: zu einem guten, gerechten und ewi- vernommen, dass die Bündner Regierung gen Leben, zum Leben im Reich Gottes – im «Himmel». -

Beschluss Kommunales Räumliches Leitbild Der Gemeinde Albula/Alvra
Beschluss Kommunales räumliches Leitbild der Gemeinde Albula/Alvra Inhalt Einleitung .................................................................................................... 3 Analyse Porträt ........................................................................................................ 4 Demografie ................................................................................................. 5 Wirtschaft und Mobilität ............................................................................. 6 Siedlung, soziale Infrastruktur und Versorgung ......................................... 7 Bauzonenreserven und Bedarf ................................................................... 8 Grossräumliche Strukturen ........................................................................ 9 Räumliche Analyse Gesamtgemeinde ..................................................... 10 Stärken-, Schwächen-, Chancen- und Risiken-Analyse ........................... 11 Konzept: Ziele, Strategien und Massnahmen Strategie Historische Dorfkerne .............................................................. 13 Strategie Siedlungsentwicklung Wohnen ................................................ 14 Strategie Siedlungsentwicklung –Versorgung und öff. Nutzungen ......... 15 Impressum Strategie Siedlungsentwicklung – Arbeiten ............................................. 16 Auftraggeber Strategie Tourismus ................................................................................ 17 Gemeinde Albula-Alvra Strategie Kleinsiedlungen und -

Herzlich Willkommen! Besser Bauen – Schöner Wohnen
Sonda e dumengia, igls 5 e 6 d‘otgover 2019 ainten las vischnancas digl cumegn Albula/Alvra Samstag und Sonntag, 5. und 6. Oktober 2019 in den Ortschaften der Gemeinde Albula/Alvra Cordial bavegna! Herzlich willkommen! Besser bauen – schöner wohnen Barit Baubedarf finden Sie in Chur, Thusis, Samedan, Schluein, Fideris und Disentis. www.baubedarf-richner-miauton.ch Innovativ. Weltweit erfolgreich. EMS-CHEMIE AG CH-7013 Domat/Ems Program dall‘exposiziun Samstag, 5. Oktober 2019 10.00 – 19.00 Uhr Ausstellung in den Betrieben und am Dorfmarkt (siehe separate Übersicht) Verpflegungsstand bei der ARGO Tiefencastel Helikopterrundflüge für alle (siehe separates Inserat) ab 19.00 Uhr Seira da folclora a Casti (siehe separates Programm) Sonntag, 6. Oktober 2019 09.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst mit Jodlermesse Mehrzweckhalle Cumpogna, Tiefencastel Mitwirkende: Pater Felicissimo Thalparpan & Dekanin Cornelia Camichel Bromeis Jodlerchörli Vaz/Obervaz anschliessend Kaffee und Gipfeli 10.30 – 12.00 Uhr Podiumsdiskussion Mehrzweckhalle Cumpogna, Tiefencastel Lebenswert ist eine Region dann, wenn sie nicht nur landschaftlich attraktiv sondern auch wirtschaftlich dynamisch ist. Was können die National- und Ständeratskandidaten für die Stärkung der Bergregionen in Bern beitragen? Duri Campell, BDP, Nationalrat Stefan Engler, CVP, Ständerat Josias Gasser, GLP, Grossrat Magdalena Martullo-Blocher, SVP, Nationalrätin Anita Mazzetta, Verda Jon Pult, SP, Grossrat Vera Stiffler, FDP, Grossrätin Monika Werder, Moderation anschliessend Gastrobetrieb 13.00 – -

Environmental Promises of Products from Regional Parks
Environmental promises of products from regional parks The decision making process of environmental promises Diploma thesis Swiss Federal Institute of Technology Zurich Institute of Agricultural Economics Zurich, September 2006 Submitted by Patricia Steinmann Examiner: Prof. Dr. Bernard Lehmann Second examiner: Prof. Dr. Peter Rieder Supervisor: Sophie Réviron Swiss Federal Institute of Technology Zurich ETH Agri-food and Agri-environmental Economics Group Head: Prof. Dr. Bernard Lehmann www.iaw.agrl.ethz.ch Institute for Agricultural Economics IAW ETH-Zentrum SOL CH-8092 Zurich Tel. +41 44 632 53 92 Fax +41 44 632 10 86 Acknowledgement Acknowledgement During my industrial placement at the Swiss Farmers Association I had to write a statement about the revision of the NHG. I considered the idea of improving the potential of marginal areas by establishing parks so interesting that I decided to dedicate my diploma thesis to this topic. I would like to thank the ETH for the education that helped me write this diploma thesis. My special thanks goes to Bernard Lehmann, Peter Rieder and Sophie Réviron, not only for their interesting lectures, but also for the supervision of this diploma thesis. When I learned park products can be labelled, I was even more in favor of the idea. When I shop I try to buy food from nearby or from organic production, as long as my restricted student’s budget allows this. Because I have been absorbed with writing over the last few months, my room mate Martin, his girlfriend Carmen and my boyfriend Sam were more or less feeding me. They kindly took my regional and organic wishes into consideration. -

Projekt-Nummer 3932 Gemeinde Albula/Alvra GR / Erneuerung Der Wasserversorgung Alvaschein ______
Projekt-Nummer 3932 Gemeinde Albula/Alvra GR / Erneuerung der Wasserversorgung Alvaschein _________________________________________________________________ Die Gemeinde Albula/Alvra entstand am 1. Januar 2015 aus der Fusion der bis dahin selbstän- digen Gemeinden Alvaneu, Alvaschein, Brienz/Brinzauls, Mon, Stierva, Surava und Tiefencas- tel. Die sieben Gemeinden stimmten am 28. Februar 2014 dem Fusionsvertrag zu. Jede der sieben Fraktionen ist mit ihren landschaftlichen, wirtschaftlichen, touristischen und kulturellen Eigenschaften einzigartig und wertvoll. Gemeinsam ergibt sich aus den sieben Fraktionen eine attraktive Gemeinde, welche sich als Zentrum von Mittelbünden behaupten und somit die Regi- on mitgestalten und stärken kann. Die Gemeinde liegt im Albulatal, und mit Ausnahme von Mon und Stierva im Talgrund liegen die anderen Ortschaften an der Kantonsstrasse, die von der Schynschlucht nach Alvaschein kommt und von Alvaneu aus nach Bergün und Davos führt. Mon und Stierva liegen am nordöstlichen Abhang des Piz Curver. Bei Tiefencastel mündet die Julia in die Albula. Der tiefste Punkt des Gemeindegebiets liegt in der Albulaschlucht bei Solis auf 824 m.ü.M. und die höchste Erhebung 200 Meter nordwestlich des Piz Mitgel auf 3'098 m.ü.M. Funde belegen, dass das Albulatal bereits in prähistorischer Zeit besiedelt gewesen ist. Nachweisbar sind Sied- lungen aus der Bronze- und Eisenzeit entlang der später von den Römern benutzten Nord-Süd-Transitroute über den Julier- bzw. den Septimerpass. Im 9. Jahrhundert nach Christus bestand das Albulatal zusammen mit dem Sur- ses aus einem Verwaltungs- und Ge- richtsbezirk mit Sitz in Tiefencastel. Diese Einheit zerfiel im Hochmittelalter mit der Aufteilung von Macht und Be- sitz auf verschiedene Feudalherr- schaften mit eigenen Vögten oder Gerichtsherren. -
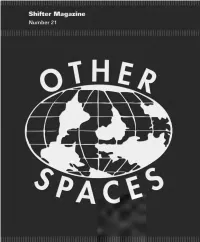
Other Spaces Spreads03.Pdf
9 8 9 7 8 6 7 5 6 4 5 3 4 2 3 1 2 INCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SHIFTER® 14 9 1 Shifter Magazine INCH Number 21: Other Spaces ® 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SHIFTER 14 8 Editors’ Note . 5. Luis Camnitzer . *6. Sean Raspet . 7. 7 Joanne Greenbaum . .*18 Blithe Riley . 20. Tyler Coburn . 31. Sheela Gowda . 39. Blank Noise . 42. Lise Soskolne . 55. 6 Mariam Suhail . 77. Julia Fish . *89. Dan Levenson . 90. Beate Geissler / Oliver Sann . .102 Alison O’Daniel . .110 Greg Sholette / Agata Craftlove . 115. Jacolby Satterwhite . .126 5 Josh Tonsfeldt . 130. Jeremy Bolen . .138 Kitty Kraus . 140. Tehching Hsieh . .143 * Work by these artists is dispersed throughout the issue . The page number marks the first 4 occurrence of their work . Publisher . SHIFTER Editor . .Sreshta Rit Premnath 3 Editor . .Matthew Metzger Designer . Dan Levenson SHIFTER, Number 21, September, 2013 Shifter is a topical magazine that aims to illuminate and broaden our understanding of the inter- sections between contemporary art, politics and philosophy .The magazine remains malleable and 2 responsive in its form and activities, and represents a diversity of positions and backgrounds in its contributors . shifter-magazine .com shiftermail@gmail .com This issue of SHIFTER was funded by a grant from the Graham Foundation © 2013 SHIFTER 1 INCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SHIFTER® 14 9 Other Spaces A city square is occupied by hundreds of shouting voices, and transformed 8 by hundreds of sleeping bodies building together a polis for action as well as a home for repose . -

Candidature UNESCO World Heritage | Rhaetian Railway in the Albula/Bernina Cultural Landscape |
Candidature UNESCO World Heritage | Rhaetian Railway in the Albula/Bernina Cultural Landscape | www.rhb-unesco.ch 1. Identification of the Property 1.a Country (and State Party if different) > 9 1.b State, Province or Region > 9 1.c Name of Property > 9 1.d Geographical coordinates to the nearest second > 13 1.e Maps and plans, showing the boundaries > 1 of the nominated property and buffer zone 1.f Area of nominated property (ha.) and proposed > � 1� buffer zone (ha.) 1. Identification of the Property > Table of contents 0 200 400 600 800 1'000 km ) #( &, ! ) #( &, ! 0 10 20 30 40 50 km & $ & $ ) #( &, )! #( &, ) ! #( &, ! SWITZERLAND Berne (CH) Chur (CH) GRAUBÜNDEN Thusis (CH) St. Moritz (CH) Tirano (I) Sondrio (I) LOMBARDY ITALY ) #( &, ! 1. Identification of the Property � Candidature UNESCO World Heritage | Rhaetian Railway in the Albula/Bernina Cultural Landscape | www.rhb-unesco.ch 1.a Country (and State Party if different) Switzerland and Italy Switzerland is situated at the centre of Europe and covers a surface area of 41,285 km2. The country is divided into 26 cantons. Italy is situated in the south of Europe and covers a surface area of 301,336 km2. The country is divided into 20 political regions. 1.b State, Province or Region Switzerland Canton Graubünden Regions: Heinzenberg/Domleschg, Mittelbünden (Central Graubünden), Upper Engadin and Poschiavo Graubünden lies at the centre of the curve of the Alps; it has some 187,000 inhabitants and, with 7,106 km2, is the largest canton in Switzerland. Italy Region Lombardy Province Sondrio Lombardy is a region in northern Italy. -

Albula Agenda Im Juni 2021
Pfarreiblatt Graubünden | Albula Agenda im Juni 2021 Gottesdienste Sonntag, 20. Juni ALBULA 09.00 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe * vor der hl. Messe Rosenkranzgebet 10.30 Uhr Brienz: Hl. Messe 19.00 Uhr Alvaneu Dorf: Hl. Messe Fronleichnam Donnerstag, 3. Juni Mittwoch, 23. Juni 19.00 Uhr Alvaneu Dorf: Kindermesse 19.00 Uhr Filisur: Italienische Messe zu Fronleichnam Freitag, 25. Juni Freitag, 4. Juni 10.00 Uhr Envia: Hl. Messe (nur für Herz-Jesu-Freitag die Heimbewohnerinnen 19.00 Uhr Schmitten: Hl. Messe und Heimbewohner) 11.00 Uhr Alvaneu Dorf: Abschluss- 10. Sonntag im Jahreskreis gottesdienst der Schule Fronleichnam Alvaneu Kollekte für die neue Orgel in Filisur Samstag, 5. Juni 13. Sonntag im Jahreskreis 17.00 Uhr Filisur: Hl. Messe für Kollekte: Papstopfer/Peterspfennig Bergün und Filisur Samstag, 26. Juni 19.00 Uhr Surava: Hl. Messe 19.00 Uhr Bergün: Hl. Messe für Sonntag, 6. Juni Filisur und Bergün Seelsorgeraum Albula 09.00 Uhr Brienz: Hl. Messe Sonntag, 27. Juni Mit den Pfarreien Alvaneu, 10.30 Uhr Alvaschein: Hl. Messe* 09.00 Uhr Schmitten: Hl. Messe Alvaschein, Bergün, Brienz, 19.00 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe 10.30 Uhr Stierva: Hl. Messe für Mon Filisur, Mon, Schmitten, Stierva, und Stierva Surava und Tiefencastel Mittwoch, 9. Juni 19.00 Uhr Mistail: Patrozinium St. Peter 19.00 Uhr Bergün: Hl. Messe für Zuständig für alle Pfarreien Filisur und Bergün Don Federico Pelicon Pfarreiadministrator HERZ-JESU-FEST Stiftmessen 076 613 71 62 Freitag, 11. Juni [email protected] 10.00 Uhr Envia: Hl. Messe (nur für 6. Juni die Heimbewohnerinnen Alvaschein: Elisabeth Muzzarelli- Rageth, lic.