DIE STADT ROM Zu ENDE DER RENAISSANCE
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
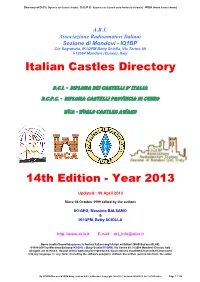
14Th Edition - Year 2013
Directory of D.C.I. Diploma dei Castelli d'Italia) - D.C.P.C. (Diploma dei Castelli della Provincia di Cuneo) - WCA (World Castles Award) A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Mondovì - IQ1BP C/o Segreteria, IK1QFM Betty Sciolla, Via Torino 89 I-12084 Mondovì (Cuneo), Italy Italian Castles Directory D.C.I. - DIPLOMA DEI CASTELLI D’ ITALIA D.C.P.C. - DIPLOMA CASTELLI PROVINCIA DI CUNEO WCA - WORLD CASTLES AWARD 14th Edition - Year 2013 Updated : 09 April 2013 Since 04 October 1999 edited by the authors IK1GPG, Massimo BALSAMO & IK1QFM, Betty SCIOLLA http://www.dcia.it E-mail: [email protected] Opera Inedita Depositata presso la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE-Sezione OLAF). ®1999-2016 by Massimo Balsamo IK1GPG e Betty Sciolla IK1QFM, Via Torino 89, I-12084 Mondovì (Cuneo), Italy All rights are reserved. No part of this work may be reproduced, disassembled, trasmitted, transcribed, translated into any language in any form (including the software program) without the written permission from the editor. By IK1GPG Max and IK1QFM Betty, Sezione A.R.I. di Mondovì, Copyright 1999-2016, Updated 09/04/2013. No.12.634 Castles Page 1 / 135 Directory of D.C.I. Diploma dei Castelli d'Italia) - D.C.P.C. (Diploma dei Castelli della Provincia di Cuneo) - WCA (World Castles Award) № DCI № WCA NAME OF CASTLES PREFIX PROVINCE DCI-AG001 I-00001 Porta di Ponte o Atenea di Agrigento IT9 Agrigento DCI-AG002 I-00002 Castello di Burgio IT9 Agrigento DCI-AG003 I-00003 Torre di Castellazzo a Camastra IT9 Agrigento DCI-AG004 I-00004 Forte -

Planning Versus Fortification: Sangallo's Project for the Defence of Rome Simon Pepper
Fort Vol. 2 1976 Planning versus fortification: Sangallo's project for the defence of Rome Simon Pepper Since 1527, when Rome had been captured and sacked by the mutinous soldiers of Charles V, it had been clear that the defences of the Papal capital were hopelessly outdated. The walls of the Borgo (the Vatican precinct) were constructed during the pontificate of Leo IV (847-855): those of Trastevere and the left bank, enclosing by far the largest part of the city, dated from the reign of the Emperor Aurelian (AD270-75) [1]. Impressive both for their length and antiquity, these walls were poorly maintained and fundamentally unsuitable for defence against gunpowder artillery. In 1534 the Romans were once again forcefully reminded of their vulnerability when a large Turkish fleet moored off the Tiber estuary. Fortunately the hostile intentions of the Turks were directed elsewhere: after taking on fresh water they sailed north to raid the Tuscan coastline. But in the immediate aftermath of the Turkish scare the newly elected Paul III committed himself to an ambitious scheme of re-fortification. Antonio da Sangallo the Younger, advised by many of the leading architects and soldiers employed by the Pope, was commissioned to submit design proposals [2]. Father Alberto Guglielmotti, the nineteenth-century historian of the Papal armed forces, tells us that Sangallo and his consultants decided to replace the Aurelian wall with a new line of works defending the developed areas on both banks of the river. The 18000 metre Aurelian circumfer- ence was to be reduced by half, a decision which is not difficult to understand when one glances at a contemporary map of the city. -

9781107013995 Index.Pdf
Cambridge University Press 978-1-107-01399-5 — Rome Rabun Taylor , Katherine Rinne , Spiro Kostof Index More Information INDEX abitato , 209 , 253 , 255 , 264 , 273 , 281 , 286 , 288 , cura(tor) aquarum (et Miniciae) , water 290 , 319 commission later merged with administration, ancient. See also Agrippa ; grain distribution authority, 40 , archives ; banishment and 47 , 97 , 113 , 115 , 116 – 17 , 124 . sequestration ; libraries ; maps ; See also Frontinus, Sextus Julius ; regions ( regiones ) ; taxes, tarif s, water supply ; aqueducts; etc. customs, and fees ; warehouses ; cura(tor) operum maximorum (commission of wharves monumental works), 162 Augustan reorganization of, 40 – 41 , cura(tor) riparum et alvei Tiberis (commission 47 – 48 of the Tiber), 51 censuses and public surveys, 19 , 24 , 82 , cura(tor) viarum (roads commission), 48 114 – 17 , 122 , 125 magistrates of the vici ( vicomagistri ), 48 , 91 codes, laws, and restrictions, 27 , 29 , 47 , Praetorian Prefect and Guard, 60 , 96 , 99 , 63 – 65 , 114 , 162 101 , 115 , 116 , 135 , 139 , 154 . See also against permanent theaters, 57 – 58 Castra Praetoria of burial, 37 , 117 – 20 , 128 , 154 , 187 urban prefect and prefecture, 76 , 116 , 124 , districts and boundaries, 41 , 45 , 49 , 135 , 139 , 163 , 166 , 171 67 – 69 , 116 , 128 . See also vigiles (i re brigade), 66 , 85 , 96 , 116 , pomerium ; regions ( regiones ) ; vici ; 122 , 124 Aurelian Wall ; Leonine Wall ; police and policing, 5 , 100 , 114 – 16 , 122 , wharves 144 , 171 grain, l our, or bread procurement and Severan reorganization of, 96 – 98 distribution, 27 , 89 , 96 – 100 , staf and minor oi cials, 48 , 91 , 116 , 126 , 175 , 215 102 , 115 , 117 , 124 , 166 , 171 , 177 , zones and zoning, 6 , 38 , 84 , 85 , 126 , 127 182 , 184 – 85 administration, medieval frumentationes , 46 , 97 charitable institutions, 158 , 169 , 179 – 87 , 191 , headquarters of administrative oi ces, 81 , 85 , 201 , 299 114 – 17 , 214 Church. -

Allegato Capitolato Tecnico ELENCO STRADE MUN 1
MUN. LOTTO Denominazione strada Note 1A 1 BELVEDERE ANTONIO CEDERNA 1A 1 BELVEDERE TARPEO 1A 1 BORGO ANGELICO 1A 1 BORGO PIO 1A 1 BORGO S. ANGELO 1A 1 BORGO S. LAZZARO 1A 1 BORGO S. SPIRITO 1A 1 BORGO VITTORIO 1A 1 CIRCONVALLAZIONE CLODIA 1A 1 CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 1A 1 CLIVO ARGENTARIO 1A 1 CLIVO DEI PUBLICII 1A 1 CLIVO DELLE MURA VATICANE 1A 1 CLIVO DI ACILIO 1A 1 CLIVO DI ROCCA SAVELLA 1A 1 CLIVO DI SCAURO 1A 1 CLIVO DI VENERE FELICE 1A 1 FORO ROMANO 1A 1 FORO TRAIANO 1A 1 GALLERIA GIOVANNI XXIII 1A 1 GALLERIA PRINCIPE AMEDEO SAVOIA AOSTA 1A 1 GIARDINO DEL QUIRINALE 1A 1 GIARDINO DOMENICO PERTICA 1A 1 GIARDINO FAMIGLIA DI CONSIGLIO 1A 1 GIARDINO GEN. RAFFAELE CADORNA 1A 1 GIARDINO PIETRO LOMBARDI 1A 1 GIARDINO UMBERTO IMPROTA 1A 1 LARGO ANGELICUM 1A 1 LARGO ARRIGO VII 1A 1 LARGO ASCIANGHI 1A 1 LARGO ASSEN PEIKOV 1A 1 LARGO BRUNO BALDINOTTI 1A 1 LARGO CARLO LAZZERINI 1A 1 LARGO CERVINIA 1A 1 LARGO CORRADO RICCI 1A 1 LARGO CRISTINA DI SVEZIA 1A 1 LARGO DEGLI ALICORNI 1A 1 LARGO DEI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA 1A 1 LARGO DEL COLONNATO 1A 1 LARGO DELLA GANCIA 1A 1 LARGO DELLA POLVERIERA 1A 1 LARGO DELLA SALARA VECCHIA 1A 1 LARGO DELLA SANITA' MILITARE 1A 1 LARGO DELLA SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA forse parco 1A 1 LARGO DELL'AMBA ARADAM 1A 1 LARGO DELLE TERME DI CARACALLA 1A 1 LARGO DELLE VITTIME DEL TERRORISMO 1A 1 LARGO DI PORTA CASTELLO 1A 1 LARGO DI PORTA S. -

3 Architects, Antiquarians, and the Rise of the Image in Renaissance Guidebooks to Ancient Rome
Anna Bortolozzi 3 Architects, Antiquarians, and the Rise of the Image in Renaissance Guidebooks to Ancient Rome Rome fut tout le monde, & tout le monde est Rome1 Drawing in the past, drawing in the present: Two attitudes towards the study of Roman antiquity In the early 1530s, the Sienese architect Baldassare Peruzzi drew a section along the principal axis of the Pantheon on a sheet now preserved in the municipal library in Ferrara (Fig. 3.1).2 In the sixteenth century, the Pantheon was generally considered the most notable example of ancient architecture in Rome, and the drawing is among the finest of Peruzzi’s surviving architectural drawings after the antique. The section is shown in orthogonal projection, complemented by detailed mea- surements in Florentine braccia, subdivided into minuti, and by a number of expla- natory notes on the construction elements and building materials. By choosing this particular drawing convention, Peruzzi avoided the use of foreshortening and per- spective, allowing measurements to be taken from the drawing. Though no scale is indicated, the representation of the building and its main elements are perfectly to scale. Peruzzi’s analytical representation of the Pantheon served as the model for several later authors – Serlio’s illustrations of the section of the portico (Fig. 3.2)3 and the roof girders (Fig. 3.3) in his Il Terzo Libro (1540) were very probably derived from the Ferrara drawing.4 In an article from 1966, Howard Burns analysed Peruzzi’s drawing in detail, and suggested that the architect and antiquarian Pirro Ligorio took the sheet to Ferrara in 1569. -

Building in Early Medieval Rome, 500-1000 AD
BUILDING IN EARLY MEDIEVAL ROME, 500 - 1000 AD Robert Coates-Stephens PhD, Archaeology Institute of Archaeology, University College London ProQuest Number: 10017236 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest. ProQuest 10017236 Published by ProQuest LLC(2016). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. Microform Edition © ProQuest LLC. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 Abstract The thesis concerns the organisation and typology of building construction in Rome during the period 500 - 1000 AD. Part 1 - the organisation - contains three chapters on: ( 1) the finance and administration of building; ( 2 ) the materials of construction; and (3) the workforce (including here architects and architectural tracts). Part 2 - the typology - again contains three chapters on: ( 1) ecclesiastical architecture; ( 2 ) fortifications and aqueducts; and (3) domestic architecture. Using textual sources from the period (papal registers, property deeds, technical tracts and historical works), archaeological data from the Renaissance to the present day, and much new archaeological survey-work carried out in Rome and the surrounding country, I have outlined a new model for the development of architecture in the period. This emphasises the periods directly preceding and succeeding the age of the so-called "Carolingian Renaissance", pointing out new evidence for the architectural activity in these supposed dark ages. -

Allegato 1 Proposta Progettuale Ad-Templum-Pacis
TITOLO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE “ AD TEMPLVM PACIS” Progetto integrato di gestione, fruizione e valorizzazione di villa Silvestri-Rivaldi in via del Colosseo a Roma, attraverso l’avvio di cantieri-scuola replicabili in altri tre siti della Regione Lazio ABSTRACT DELLA PROPOSTA PROGETTUALE La Direzione Generale Educazione e Ricerca MiBACT - capofila - presenta la proposta progettuale AD TEMPLUM PACIS , in partenariato con la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, con l’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, con il Comune di Cittaducale (RI) e con la Fondazione Cavallini-Sgarbi, per la realizzazione di un Progetto integrato di gestione, fruizione e valorizzazione di villa Silvestri-Rivaldi in via del Colosseo a Roma, attraverso l’avvio di cantieri-scuola replicabili in altri tre siti della Regione Lazio. Tradizione e nuove tecnologie possono essere opportunamente coniugate, specie nel campo del restauro e della valorizzazione del patrimonio storico culturale: per il passato e per il futuro si tratta infatti di percorrere due opposti versi della stessa direzione. Nel proporre cantieri scuola che possano favorire nel Lazio il recupero di saperi specifici e di competenze specialistiche e locali, qualificazioni che in passato erano garantite dalle corporazioni di arti e mestieri e dalle fabbricerie - opere o “ope” delle singole fabbriche - si sono individuati alcuni primi possibili siti, diffusi al territorio di tutta la regione, per cercare di attivare o meglio riattivare tali processi di formazione e di svolgimento di concrete attività, che assicurano il duplice risultato di aderire, tra i principi fondamentali della Costituzione, sia all’incremento delle possibilità e della qualità del lavoro (art. -

Roma, Torre Dei Conti. Ricerca, Formazione, Progetto, a Cura Di Elisabetta Pallottino Rivista Quadrimestrale Edita Da Carocci Editore S.P.A., Roma
Ricerche di Storia dell’arte n. 108/2012 Serie “Conservazione e restauro” Roma, Torre dei Conti. Ricerca, formazione, progetto, a cura di Elisabetta Pallottino Rivista quadrimestrale edita da Carocci editore S.p.A., Roma I fascicoli dedicati alla storia dell’arte (Serie: Arti visive) si alternano ad un fascicolo dedicato ai temi della conservazione e del restauro (Serie: Conservazione e Restauro) Direttore responsabile: Antonio Pinelli Comitato direttivo: Paolo Marconi, Antonio Pinelli Progetto grafico: Paolo Lecci Serie Arti visive Direttore: Antonio Pinelli Comitato di redazione: Silvia Bordini, Silvia Carandini, Luciana Cassanelli, Michela di Macco, Maria Letizia Gualandi, Maria Grazia Messina, Jolanda Nigro Covre, Orietta Rossi Serie Conservazione e Restauro Direttore: Paolo Marconi Comitato di redazione: Francesco Paolo Fiore, Elisabetta Pallottino, Alberto Maria Racheli Abbonamento annuale 2013: Italia + 65,00; Europa + 83,00; Paesi extra-europei + 94,50. Prezzo di un fascicolo: Italia n. singolo + 29,00; n. doppio + 56,50; Europa n. singolo + 36,50; n. doppio + 63,00; Paesi extra-europei n. singolo + 40,00; n. doppio + 69,50. Fascicoli arretrati: Italia n. singolo + 38,50; n. doppio + 63,50; Europa n. singolo + 45,50; n. doppio + 66,00; Paesi extra-europei n. singolo + 46,50; n. doppio + 76,50. Gli abbonamenti si possono sottoscrivere mediante versamento sul ccp 77228005 intestato a Carocci editore S.p.A., corso Vittorio Emanuele II, 229, 00186 Roma, o inviando un assegno bancario non trasferibile intestato a Carocci editore S.p.A., o tramite bonifico bancario sul c/c 000001409096 del Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma cod. 8710, Via Sicilia 203/A, 00187 Roma, IBAN IT92C0103003301000001409096 - SWIFT BIC: PASCITM1Z70. -

Curriculum Vitae Europass
Curriculum Vitae Europass Informazioni personali Nome / Cognome ELEONORA SCETTI Telefono ufficio 06.67103856, cell. 339.7838558 E-mail [email protected] Cittadinanza italiana Sesso femminile Esperienza professionale (Presso ROMA CAPITALE) Lavoro o posizione ricoperti - ARCHITETTO, CON POSIZIONE DI RESPONSABILITA’ IN AMBITO ORGANIZZATIVO DI Posizione attuale COMPLESSITA’ ELEVATA, categoria D, p.e. D6O, in servizio presso la Sovrintendenza di Roma Capitale, Direzione Interventi su Edilizia Monumentale, assunta a tempo indeterminato (Contratto di lavoro n. 80 del 16.01.2006). Ruoli ricoperti nella posizione Date Dal 01 giugno 2017 ad oggi Ruolo ricoperto - RESPONSABILE DELL’UFFICIO “Appalti per i beni archeologici, architettonici e monumentali del Suburbio di Roma”, con incarico di alta responsabilita’ ex art. 19 CCDI – Direzione Tecnico Territoriale – Sovrintendenza Capitolina (O.S. n. 60, prot. N. 14695 del 6.06.2017) Dal 01 giugno 2012 al 31 maggio 2017 Date Ruolo ricoperto - TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA di TIPO “A” con elevata Responsabilità organizzativa/gestionale per il “Coordinamento degli appalti di restauro dei monumenti archeologici, medievali e moderni del Suburbio” della U.O. Monumenti di Roma – Direzione Tecnico Territoriale - Sovrintendenza Capitolina (D. D. Rep. n. S.C. 505 del 31.05.2012) Date Dal 01 agosto 2011 Ruolo ricoperto - RESPONSABIILE DEL PROCESSO ORGANIZZATIVO - UFFICIO DI COORDINAMENTO “Gestione appalti e contabilità” E UFFICIO “Architettura Moderna e contemporanea, incarico di alta responsabilita’ ex art. 19 CCDI vigente – U.O. Tecnica di progettazione, Direzione Tecnico Territoriale – Sovrintendenza Capitolina (O.S. n.125, prot. N. 20051 del 20.09.2011) Date Dal 14 aprile 20 08 al 28 luglio 2011 Ruolo ricoperto - TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA di TIPO “A” con elevata Responsabilità organizzativa/gestionale per il “Coordinamento, gestione tecnico amministrativa e progettazione degli interventi strategici riguardanti i monumenti medievali e moderni” della U.O. -

DALLA TORRE ALLA TORRE PIEZOMETRICA a Cura Di Antonella Greco
STORIA DELL’URBANISTICA 5/2013 DALLA TORRE ALLA TORRE PIEZOMETRICA a cura di Antonella Greco EDIZIONI KAPPA STORIA DELL’URBANISTICA 5/2013 STORIA DELL’URBANISTICA ANNUARIO NAZIONALE DI STORIA DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO Fondato da Enrico Guidoni Anno XXXII - Serie Terza 5/2013 ISSN 2035-8733 DIPARTIMENTO INTERATENEO DI SCIENZE, PROGETTO E POLITICHE DEL TERRITORIO DEL POLITECNICO DI TORINO DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DELL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DELL’UNIVERSITÀ DI “ROMA TRE” DIPARTIMENTO DI STORIA, DISEGNO E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA, SAPIENZA-UNIVERSITÀ DI ROMA DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DELL’UNIVERSITÀ “FEDERICO II” DI NAPOLI DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E ARCHITETTURA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI Comitato scientifico Nur Akin, Sofia Avgerinou Kolonias, Clementina Barucci, Carla Benocci, Claudia Bonardi, Marco Cadinu, Jean Cancellieri, Carmel Cassar, Teresa Colletta, Antonella Greco, Paolo Micalizzi, Amerigo Restucci, Costanza Roggero, Carla Giuseppina Romby, Tommaso Scalesse, Eva Semotanova, Ugo Soragni, Donato Tamblè Redazione Federica Angelucci, Claudia Bonardi, Marco Cadinu,Teresa Colletta, Gabriele Corsani, Antonella Greco, Stefania Ricci, Laura Zanini Segreteria di Redazione Irina Baldescu, Giada Lepri (coordinatrice), Raimondo Pinna, Luigina Romaniello, Maurizio Vesco Corrispondenti Eva Chodejovska, Vilma Fasoli, Luciana Finelli, Maria Teresa Marsala, Francesca Martorano, Adam Nadolny, Josè Miguel Remolina Direttore responsabile: Ugo Soragni I contributi proposti saranno valutati dal Comitato scientifico che sottoporrà i testi ai referees, secondo il criterio del blind peer review Segreteria: c/o Stefania Ricci, Associazione Storia della Città, Via I. Aleandri 9, 00040 Ariccia (Roma) e-mail: s.ricci@storiadellacittà.it Copyright © 2014 Edizioni Kappa, piazza Borghese, 6 - 00186 Roma - tel. 0039 066790356 Amministrazione e distribuzione: via Silvio Benco, 2 - 00177 Roma - tel. -

Relazione Adottata
INDICE A) LA COSTRUZIONE DEL PIANO 1. DALLA TUTELA ALLA VALORIZZAZIONE - 1.1 Il senso del piano pag. 2 - 1.2 I caratteri del paesaggio pag. 4 - 1.3 I precedenti storici pag. 15 - 1.4 Le vicende urbanistiche recenti pag. 17 - 1.5 Il piano paesistico, il piano di assetto del parco e i nuovi provvedimenti legislativi pag. 19 2. I VINCOLI E LA COGENZA DEL PIANO pag. 22 - 2.1 Il valore formale pag. 22 - 2.2. Il perimetro del piano paesistico pag. 23 - 2.3 Il beni con dichiarazione di vincolo pag. 24 - 2.4 Le integrazioni indispensabili e le destinazioni d’uso auspicabili pag. 25 3. LA STRUTTURA DEL PIANO - 3.1 La tutela dei beni diffusi pag. 29 - 3.2 L’articolazione della tutela e della valorizzazione pag. 31 - 3.3 La forma del piano pag. 33 - 3.4 Gli elaborati del piano pag. 35 B) LA CONOSCENZA, LA VALUTAZIONE E GLI OBIETTIVI 4 I PAESAGGI E LE LORO COMPONENTI pag. 40 5. I SISTEMI, I SUBSISTEMI E GLI AMBITI IDRO-MORFOLO- GICO-VEGETAZIONALI pag. 41 5.1 Sistema V1 Valle dell’Almone pag. 44 5.1.1.Sub-sistema V1.a Travicella – Caffarella pag 44 5.1.2. Sub-sistema V1.b –Acquasanta pag. 45 5.1.3 Sub-sistema V1.c -Statuario pag. 45 1 5.1.4.Sub –sistema V1.d-Calice pag. 46 5.2 Sistema V2: Valle di Tor Carbone 5.2.1.Sub-sistema V2.a -Tor Marancia-Grotta Perfetta pag. 47 5.2.3. Sub-sistema V2.c -Tor Carbone – orlo della Colata Lavica pag. -

The City Boundary in Late Antique Rome Volume 1 of 1 Submitted By
1 The City Boundary in Late Antique Rome Volume 1 of 1 Submitted by Maria Anne Kneafsey to the University of Exeter as a thesis for the degree of Doctor of Philosophy in Classics in December 2017. This thesis is available for Library use on the understanding that it is copyright material and that no quotation from the thesis may be published without proper acknowledgement. I certify that all material in this thesis which is not my own work has been identified and that no material has previously been submitted and approved for the award of a degree by this or any other University. Signature: ………………………………………………………………… 2 Abstract This thesis examines the changing meaning and conceptualisation of the city boundary of Rome, from the late republic and imperial periods into late antiquity. It is my aim in this study to present a range of archaeological and historical material from three areas of interest: the historical development of the city boundary, from the pomerium to the Aurelian wall, change and continuity in the ritual activities associated with the border, and the reasons for the shift in burial topography in the fifth century AD. I propose that each of these three subject areas will demonstrate the wide range of restrictions and associations made with the city boundary of Rome, and will note in particular instances of continuity into late antiquity. It is demonstrated that there is a great degree of continuity in the behaviours of the inhabitants of Rome with regard to the conceptualisation of their city boundary. The wider proposal made during the course of this study, is that the fifth century was significant in the development of Rome – archaeologically, historically, and conceptually – but not for the reasons that are traditionally given.