Blätter Aus Dem Thurgauer Wald
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lessons for Public Transport and Density in Peri-Urban Australia Title
Watching the Swiss: Lessons for public transport and density in peri-urban Australia Title: Watching the Swiss: Lessons for public transport and density in peri-urban Australia Running head: Lessons for peri-urban public transport Key words: urban density; public transport; peri-urban; Australia; Switzerland Word Count: Approximately 5000 words. Author: Tim Petersen PhD Candidate, University of Melbourne. Funded by the Australasian Centre for Governance and Management of Urban Transport. Faculty of Architecture, Building and Planning The University of Melbourne Victoria 3010 [email protected] 0428 220 082 Abstract According to conventional wisdom, small towns and settlements on the fringes of Australian cities are impossible to serve by public transport. Low population densities mean that public transport cannot attract enough passengers to be viable, let alone have any significant impact on levels of car use. The case of semi-rural Switzerland challenges this consensus. Villages around Zurich- Winterthur have population densities comparable to semi-rural Australia, but journey- to-work figures show their public transport mode share exceeding those of most Australian capital cities. While there are obvious differences in urban form, the greatest contrast may be in public transport planning methods and supply policies. This paper compares the settlements in Zurich's Weinland region with those on Victoria's Bellarine Peninsula, focussing in particular on population density and journey-to-work mode shares. In analysing the similarities and differences, it also introduces the Weinland’s transport planning methods (explored in greater detail in Petersen 2009) which appear to be critical to its success. It therefore challenges Australian transport policy makers to reconsider the traditional approach to public transport planning in the commuter belts of Australian cities. -

Ausgabe 04 Vom August 2014 [Pdf, 5.0
Drehschiibe_August_2014_Layout 1 18.08.14 10:44 Seite 1 EINKLINGE RH N N Nr. 4 | August 2014 K E A S L U T E A N H B N A E C G H A W Ozielle Publikationen der Gemeinde Wagenhausen ETZWILEN Liebe Einwohnerinnen immer besser abgesicherten Umfeld gehört auch der Unterhalt der Spiel- und Einwohner nehmen alle möglichen Formen von geräte, der Autos, Velos etc., um de- Risikosportarten zu. Der Mensch ren Funktionstüchtigkeit und Sicher- Gedanken zur Kletterstange möchte seine Grenzen ausloten, et- heit auf lange Frist zu gewährleisten. Ich bin 5 Meter hoch, meine Stan- was Aufregendes erleben, Herausfor- Zu einem positiven und fördernden gen verlaufen auf der einen Seite derungen meistern, sich einem Risiko Umfeld gehört auch Geborgenheit. senkrecht, auf der andern leicht aussetzen. Sicherheit und Geborgenheit sind schräg. Grau angestrichen und für Ge- Wie können wir unser Umfeld at- Zwillinge. Nicht dasselbe, aber nahe nerationen von Kindern Herausforde- traktiv und spannend und trotzdem verwandt und beide unabdingbar. rung, Stolz oder Überforderung. Auf sicher gestalten? Die besten Sicher- Auch unsere Beziehungen brauchen vielen Schulanlagen bin ich ver- heitsvorkehrungen nützen wenig, Pflege und Unterhalt, wenn sie lang- schwunden, weil ich zu gefährlich sei. wenn wir keine Eigenverantwortung fristig bestehen sollen. Wie sicher müssen wir unsere Umge- wahrnehmen. Mit unseren Kindern Unser Sporttag liegt zwei Monate bung gestalten? Zertifizierte Spielge- das Verhalten auf den Strassen ein- zurück. Die Kinder haben sich gemes- räte, Velohelme, Leuchtwesten, Rad- üben. Lernen, wie man klettert und sen im Schnellauf, Langstreckenlauf, und Fusswege, Geländer ab 1 Meter im Rhein badet. Je besser wir unsere Hochsprung, Ballwurf, Weitsprung Fallhöhe, Dreipunktgurten, Ge- Kids in einen selbstverständlichen und Stangenklettern. -

Stability of Travel Behaviour: Thurgau 2003
Research Collection Working Paper Stability of Travel Behaviour: Thurgau 2003 Author(s): Löchl, Michael Publication Date: 2005 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-b-000066687 Rights / License: In Copyright - Non-Commercial Use Permitted This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more information please consult the Terms of use. ETH Library Stability of Travel Behaviour: Thurgau 2003 Michael Löchl Travel Survey Metadata Series 16 Travel Survey Metadata Series 16 Stability of Travel Behaviour: Thurgau 2003 Michael Löchl IVT ETH Zürich Zürich Phone: +41 44 633 62 58 Fax: +41 44 633 10 57 [email protected] Abstract Within the project, a six week travel survey has been conducted among 230 persons from 99 households in Frauenfeld and the surrounding areas in Canton Thurgau from August until December 2003. The design built on the questionnaire used in the German project Mobidrive, but developed the set of questions further. All trip destinations of the survey have been geocoded. Moreover, route alternatives for private motorised transport and public transport have been calculated. Moreover, the collected data has been compared with the National Travel Survey 2000 (Mikrozensus zum Verkehrsverhalten 2000), whereas differences in terms of sociodemographic characteristics of the respondents and particularly their travel behaviour couldn't be observed except for an higher proportion of GA and Halbtax ownership. For example, the average trip frequency per person and day is almost the same. In order to check for possible fatigue effects of the amount of reported trips, several GLM (Generalised Linear Model) and poisson regression models have been estimated besides descriptive analysis. -

Stammheim 2009 23
Springkonkurrenz Stammheim 2009 23. / 24. Mai 2009 Samstag: Kombinierte Prüfung Dressur - Springen 1912-2009 OKV Junioren A+S Cup Dragonerspringen Sonntag: Freie Springprüfungen Schauprogramm RI und RII - Springen Gedeckte Festwirtschaft mit reichhaltigem Angebot für Gross und Klein. «S’hätt für alli öppis». SPRINGKONKURRENZ 2009 STAMMHEIM Gestaltung Verband Ostschweizerischer Konzepte Kavallerie- und Drucksachen Reitvereine Beschriftungen Programm Freitag, 22. Mai 2009 ab 17.00 Uhr Vereinsspringen Vereinsspringen in 3 Stufen kleine Festwirtschaft Samstag, 23. Mai 2009 7.30 Uhr Komb. Prüfung, Dressur Preis vom Schloss Girsberg Familie Henry Bodmer, Zollikerberg Plaketten: Mirror-Polish AG, Basadingen Flots: Velosport Fridolin Keller, Unterstammheim 10.30 Uhr Komb. Prüfung, Springen A Zm 12.00 Uhr OKV Junioren A & S Cup Preis der Leihkasse Stammheim Springen A Zm Plaketten: Bahnhofgarage Walther, Unterstammheim Flots: Beat Wirth, Sanitär-Heizungen, Oberstammheim anschl. OKV Junioren A & S Cup Stilprüfung 15.00 Uhr Dragonerspringen, A Zm Preis der Stammertaler Winzer M. & H. Glesti, Oberstammheim, M & K. Keller, Waltalingen Stammheimer-Winzer Genossenschaft, Oberstammheim Plaketten: Metzgerei zur Krone, Unterstammheim Flots: RUBA Objekteinrichtungen, Oberneunforn anschl. Dragonerspringen, Preis der Dragoner Zweiphasen A Zm Senioren des RV Stammheimertal Plaketten: Vereinigung Alte Garde anschl. Gesangseinlage vom Flots: Senioren des RV Stammheimertal Dragonerchörli Sonntag, 24. Mai 2009 08.00 Uhr Freie Prüfung, A Zm Preis vom Gasthof zum -

Suffizienz Als Schlüssel Zum Erfolg Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen
Binding Waldpreis 2016 Weniger ist mehr – Suffizienz als Schlüssel zum Erfolg Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen Weniger ist mehr – Suffizienz als Schlüssel zum Erfolg Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen Der Binding Waldpreis wird seit 1987 jährlich an einen Schweizer Wald- besitzer verliehen. Die Zielsetzung des Binding Waldpreises bildet die Auszeichnung von Waldbesitzern und Forstbetrieben, die ihren Wald beispielhaft nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit nutzen und dabei die ökologischen Potenziale und das soziale Umfeld umfassend berück- sichtigen sowie Strategien für den wirtschaftlichen Erfolg langfristig umsetzen. Das Jahresthema des Binding Waldpreises 2016 lautet: «Weniger ist mehr – Suffizienz als Schlüssel zum Erfolg» Herausgeberin Sophie und Karl Binding Stiftung Rennweg 50, CH-4020 Basel Redaktion Claudia Meile, Forstamt Thurgau Ulrich Ulmer, Forstamt Thurgau Willi Itel, Präsident Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen Walter Ackermann, Revierförster und Betriebsleiter Layout/Druck medienwerkstatt ag, 8583 Sulgen www.medienwerkstatt-ag.ch Bezug/Information Diese Broschüre erhalten Sie im Buchhandel oder über die Sophie und Karl Binding Stiftung Tel. +41 61 317 12 39 Fax +41 61 313 12 00 [email protected] Nähere Informationen finden Sie unter: www.binding-stiftung.ch/waldpreis ISBN 978-3-9523797-5-2 1 Vorwort 6 Daniel Böhi 2 Laudatio 10 Georg Schoop 3 Die Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen und ihr Wald 16 Willi Itel 4 Suffizienz – weniger ist mehr 4.1 Weniger ist mehr im Wald der Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen -

8477 Oberstammheim (Gemeinde Stammheim) 1’045 M2 Bauland
8477 Oberstammheim (Gemeinde Stammheim) 1’045 m2 Bauland Sonnig gelegen, ebene Topografie Zone: Kernzone A (Dorf) Hux AG Verkauf ohne Architekturverpflichtung Dr. iur. Thomas Hux Chesslerstrasse 12 8477 Oberstammheim Telefon: 052 368 77 77 [email protected] Verhandlungspreis: CHF 522'500 (CHF 500/m2) Makrolage / Oberstammheim, Gemeinde Stammheim ZH Das Stammertal ist bekannt für seine schmucken Riegelhäuser und die lang gezogenen Rebberge. Es zählt zu den trockensten und wärmsten Gegenden des Schweizer Mittellandes. Oberstammheim liegt in der Mitte des Städtedreiecks Winterthur, Schaffhausen, Frauenfeld. Die Städte sind alle innerhalb 15 - 25 Minuten mit dem Auto erreichbar. Der Bahnhof Stammheim befindet sich an der Bahnlinie Winterthur- Stein am Rhein. Die S29 verkehrt im Halbstundentakt. Zwischen Frauen- feld und Diessenhofen verkehrt ein Postauto mit mehreren Haltestellen auf dem Gemeindegebiet Stamm- heim (Linie B 823). Von Oberstamm- heim nach Andelfingen Bahnhof sind es mit dem Postauto (Linie B 605) 26 min. Die nächstgelegenen Autobahnan- schlüsse befinden sich in Kleinandel- fingen (10 km, A4), Frauenfeld West (13 km, A7) bzw. Oberwinterthur und Attikon (16 km, A1). Insgesamt 52 Vereine (Sport, Kultur Geschichte und Natur) fördern das gesellschaftliche Leben im Stammer- tal. Eine Anzahl Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel die Galluskapelle, bekannt für seine hochgotischen Fresken aus dem 14. Jahrhundert, tragen dazu bei, dass das Stammer Dorfbild zu einem der schönsten der Schweiz zählt. Die nähere Umgebung lädt ein zum Wandern -

Neues Zur Geologie Zwischen Thur Und Rhein
Neues zur Geologie zwischen Thur und Rhein Autor(en): Müller, Erich R. Objekttyp: Article Zeitschrift: Mitteilungen der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft Band (Jahr): 53 (1995) PDF erstellt am: 05.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-593743 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch NEUES ZUR GEOLOGIE ZWISCHEN THÜR UND RHEIN Anmerkung: Sämtliche Orts- und Flurbezeichnungen entsprechen der Landes- karte der Schweiz 1 : 25 000, Bundesamt für Landestopographie, 3084 Wabern: Blätter 1031 (Neunkirch), 1032 (Diessenhofen), 1033 (Steckborn), 1052 (Andelfingen), 1053 {Frauenfeld). ZUSAMMENFASSUNG: In der vorliegenden Arbeit wird nach einer kurzen Übersicht die Literatur skizziert, die das Gebiet beschreibt. -

RRB-2012-0275.Pdf
Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich Sitzung vom 21. März 2012 275. Regionaler Richtplan Weinland (Teilrevision regionaler Richtplan, Teil Verkehr, betreffend Fuss-, Wander- und Radwege) A. Ausgangslage Mit Beschluss Nr. 2661/1997 setzte der Regierungsrat den regionalen Richtplan Weinland fest. Mit Schreiben vom 7. Oktober 2011 beantragt die Zürcher Planungsgruppe Weinland (ZPW), gestützt auf den Be- schluss der Delegiertenversammlung vom 30. Juni 2011, Festlegungen im regionalen Richtplan Verkehr zu den Fuss- und Wanderwegen sowie Radwegen zu ändern. Die Vereinigung Zürcher Wanderwege (ZAW) beantragte nach Ab- stimmung mit den betroffenen Gemeinden in den Jahren 2009 und 2010 verschiedene Verlegungen oder Neuaufnahmen von Fuss- und Wander- wegen. B. Änderungen betreffend Fuss-, Wander- und Radwege Die Änderungen der Fuss- und Wanderwege (Kartenteil 1, Plan Mst. 1:25000, dat. 30. Juni 2011) umfassen: – Ossingen: Verlegung des Wanderwegs entlang der Thur – Laufen-Uhwiesen: Verlegung des Wanderwegs im Kern von Uhwiesen – Ossingen: Weiterführung des Thuruferwegs von Pfingstweid nach Äuli – Waltalingen: Verlegung des Wanderwegs entlang der Neun fornerstrasse – Berg a.I. und Flaach: Neuer Wanderweg Ziegelhütte–Tüfels Chanzle Zudem wird nach Abstimmung mit den kantonalen Fachstellen und den betroffenen Gemeinden die Linienführung des Radwegs zwischen Ossingen und Guntalingen geändert. Die Strecke Ossingen–Gisenhard– Guntalingen wird aufgehoben und dafür neu die Strecke Ossingen– Trutti kon–Guntalingen festgelegt (Kartenteil 2, Plan Mst. 1:25000, dat. 30. Juni 2011). – 2 – Der regionale Richtplantext wird wie folgt geändert: 4.3.1.4 Radwege Festlegung Ossingen – Truttikon Gisenhard – Guntalingen C. Anhörung und Mitwirkung Die Anhörung und öffentliche Auflage fand von 28. Januar 2011 bis 30. März 2011 statt. Während der Auflagefrist gingen zwei Einwendun- gen mit drei Anträgen ein, wovon einer vollständig berücksichtigt wurde. -

80.823 Frauenfeld - Stammheim - Diessenhofen Stand: 30
FAHRPLANJAHR 2020 80.823 Frauenfeld - Stammheim - Diessenhofen Stand: 30. Oktober 2019 Montag–Freitag ohne allg. Feiertage ohne 1.5. 82301 82303 82305 82307 82309 82311 82313 82315 82317 Winterthur ab 5 16 6 01 7 01 7 16 8 01 9 01 Weinfelden ab 5 52 6 52 7 12 Frauenfeld, Bahnhof 5 16 5 46 6 16 7 16 7 37 8 16 9 16 Frauenfeld, Schaffhauserplatz 5 18 5 48 6 18 7 18 7 39 8 18 9 18 Frauenfeld, Sportplatz 5 19 5 49 6 19 7 19 7 40 8 19 9 19 Weiningen TG, Dorfplatz 5 25 5 55 6 25 7 25 7 46 8 25 9 25 Hüttwilen, Oberdorf 7 53 Hüttwilen, Zentrum 5 28 5 58 6 28 7 28 8 28 9 28 Nussbaumen TG, Schulhaus 5 32 6 02 6 32 7 32 8 32 9 32 Oberstammheim, Post 5 36 6 06 6 36 7 36 8 36 9 36 Stammheim, Bahnhof 5 37 6 07 6 16 6 37 7 16 7 37 8 37 9 37 Schlattingen, Hauptstrasse 5 42 6 12 6 21 6 42 7 21 7 42 8 42 9 42 Basadingen, Unterdorf 5 45 6 15 6 24 6 45 7 24 7 45 8 45 9 45 Diessenhofen, Bahnhof 5 51 6 21 6 30 6 51 7 30 7 51 8 51 9 51 Schaffhausen an 6 13 6 43 7 13 8 13 9 13 10 13 82319 82321 82323 82325 82327 82329 82331 82333 82335 Winterthur ab 10 01 11 01 12 01 13 01 14 01 15 01 16 01 16 31 Weinfelden ab 16 36 Frauenfeld, Bahnhof 10 16 11 16 12 16 13 16 14 16 15 16 16 16 16 51 Frauenfeld, Schaffhauserplatz 10 18 11 18 12 18 13 18 14 18 15 18 16 18 16 53 Frauenfeld, Sportplatz 10 19 11 19 12 19 13 19 14 19 15 19 16 19 16 54 Weiningen TG, Dorfplatz 10 25 11 25 12 25 13 25 14 25 15 25 16 25 17 00 Hüttwilen, Oberdorf 17 07 Hüttwilen, Zentrum 10 28 11 28 12 28 13 28 14 28 15 28 16 28 Nussbaumen TG, Schulhaus 10 32 11 32 12 32 13 32 14 32 15 32 16 32 Oberstammheim, -

Hereinspaziert!
HEREINSPAZIERT! 1. Mai und 5./6. Mai 2018 jeweils ab 11.00 Uhr www.offeneweinkeller.ch Wein massvoll geniessen Wein – 1 Prosit 1. Mai! Nein, ich habe die Offenen Weinkeller nicht erfunden, auch wenn einzelne Winzer der Meinung sind, ich würde das behaupten. «Erfinder» des erfolg Samstag, 5. Mai 2018, 14 –19 Uhr reichen Events, der dieses Jahr bereits zum 20. Mail stattfindet, ist Hanspeter Wehrli, Präsident des Weinbauvereins Winterthurer Weinland. Unter seiner DEGUSTIEREN UND GENIESSEN Ägide öffnete eine Schar von Winterthurer Winzern am 1. Mai 1999 erstmals ihre Weinkeller für das Publikum. Zwei Jahre später taten es ihnen rund zwan zig Betriebe vom Zürichsee gleich und nochmals zwei Jahre später beteilgten sich Winzer aus dem ganzen Kanton Zürich an der Veranstaltung. Zuständig für den Anlass war jetzt Winzersfrau Cécile Schwarzenbach aus Meilen, die sich mit Grafiker Daniel Kleiner bis heute unermüdlich für den «1. Mai» einsetzt. Ich selbst stiess 2007 zum Team, als ich die Redaktion der Zürcher Weinzeitschrift «Räbe & Wii» übernahm. Damals sprengten die Offenen Weinkeller zum ersten Mal die Kantonsgrenzen von Zürich, und wir mussten schon 2009 eine neue Trägerschaft für unseren Event suchen. Diese fanden wir im neu gegründeten Branchenverband Deutschschweizer Wein, unter dessen Dach alle kantonalen Weinbranchenverbände der Deutsch schweiz zusammengeschlossen sind. Gleichzeitig riefen wir auch den Guide, den Sie in den Händen halten, ins Traditionelle Jahresdegustation der Winzervereinigung vinotiv Graubünden im Leben und bauten die Webseite «offeneweinkeller.ch» immer weiter aus. Für Rahmen der «Offenen Weinkeller 2018» – mit einer umfassenden Palette an Rot- und Aufsehen sorgten dabei die Kellertiere des international bekannten Winterthurer Weissweinen und zahlreichen inspirierenden Gesprächen. -

Guntalingen Bei Stammheim ZH Bauernhaus Mit 2 Wohnungen Schopf, Garage Und Weitläufi Gem Garten
Guntalingen bei Stammheim ZH Bauernhaus mit 2 Wohnungen Schopf, Garage und weitläufi gem Garten Fleischmann Immobilien AG An sehr ruhiger, ländlich idyllischer Lage im Zürcher Weinland, am Hügelfuss von Niederlassung Stein am Rhein Schloss Girsberg. Angrenzend an die Landwirtschaftszone mit unverbaubarem Blick Orichhöhe 12, 8260 Stein am Rhein gegen Stammheim. Tel. 052 740 35 35 www.fl eischmann.ch Ehemaliges Bauernhaus mit zwei Wohnungen, einseitig angebaut, separat stehender, info@fl eischmann.ch grosser Schopf und Einzelgarage. Gut unterhalten, gepfl egt und laufend renoviert. Im Erdgeschoss eine grosszügige 4½-Zimmer-Wohnung mit 126 m² Nettowohnfl äche Hauptsitz: Weinfelden und grossem Balkon; im Obergeschoss eine 4-Zimmer-Wohnung mit 104 m² Netto- wohnfl äche ebenfalls mit Balkon. Scheunenteil mit Tenne und Heustock. Weitere Niederlassungen: Separat stehender Schopf (130 m² Grundfl äche) mit drei grossen Einstellräumen und Arbon, Frauenfeld, Tägerwilen, Wil separate Einzelgarage. Grosser, lauschiger Garten mit zwei Sitzplätzen auf der Südseite. Landanteil 1'605 m². Preis Fr. 1'250'000.– Lage Der Weiler Girsberg gehört zur Politischen Gemeinde Stammheim mit 2'800 Einwoh- nern und liegt im Stammertal, im Zürcher Weinland. Sie umfasst die Dörfer Gunta- lingen, Waltalingen, Unter- und Oberstammheim. Der idyllische Weiler Girsberg liegt nordwestlich von Guntalingen. Die Gemeinde bildet mit ihren Grünflächen, Reben und Wäldern ein einzigartiges Naherholungsgebiet, zudem liegen malerische Seen, Flüsse und Dörfer in nächster Umgebung. Die Liegenschaft Girsberg 10 befindet sich an absolut ruhiger Lage am Hügelfuss des Schlosses Girsberg, teilweise in der Kernzone Weiler und teilweise in der Landwirt- schaftszone. Kindergarten und Primarschule (mit Schulbusbetrieb) befinden sich in Unterstammheim, Oberstammheim und Waltalingen, die Sekundarschule in Unter- stammheim (2.6 km). -
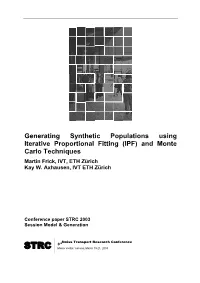
Generating Synthetic Populations Using Iterative Proportional Fitting (IPF) and Monte Carlo Techniques Martin Frick, IVT, ETH Zürich Kay W
Generating Synthetic Populations using Iterative Proportional Fitting (IPF) and Monte Carlo Techniques Martin Frick, IVT, ETH Zürich Kay W. Axhausen, IVT ETH Zürich Conference paper STRC 2003 Session Model & Generation Swiss Transport Research Conference 3 rd STRC Monte Verità / Ascona, March 19-21, 2003 Swiss Transport Research Conference _______________________________________________________________________________ March 19-21, 2003 Generating Synthetic Populations using Itera- tive Proportional Fitting (IPF) and Monte Carlo Techniques Martin Frick IVT ETH Zürich 8093 Zürich Phone: 01-633 37 13 Fax: 01-633 10 57 e-Mail: [email protected] I Swiss Transport Research Conference _______________________________________________________________________________ March 19-21, 2003 Abstract The generation of synthetic populations represents a substantial contribution to the acquisition of useful data for large scale multi agent based microsimulations in the field of transport plan- ning. Basically, the observed data is available from censuses (microcensus) in terms of simple summary tables of demographics, such as the number of persons per household for census block group sized areas. Nevertheless, there is a need of more disaggregated personal data and thus another data source is considered. The Public Use Sample (PUS), often used in transportation studies, is a 5% representative sample of almost complete census records for each individual, missing addresses and unique identifiers, including missing items. The problem is, to generate a large number of individual agents (~ 1Mio.) with appropriate characteristic values of the demo- graphic variables for each agent, interacting in the microsimulation. Due to the fact that one is faced with incomplete multivariate data it is useful to consider multiple data imputation tech- niques. In this paper an overview is given over existing methods such as Iterative Proportional Fitting (IPF), the Maximum Likelihood method (MLE) and Monte-Carlo (MC) techniques.