Statistik.Info 15/2005
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lessons for Public Transport and Density in Peri-Urban Australia Title
Watching the Swiss: Lessons for public transport and density in peri-urban Australia Title: Watching the Swiss: Lessons for public transport and density in peri-urban Australia Running head: Lessons for peri-urban public transport Key words: urban density; public transport; peri-urban; Australia; Switzerland Word Count: Approximately 5000 words. Author: Tim Petersen PhD Candidate, University of Melbourne. Funded by the Australasian Centre for Governance and Management of Urban Transport. Faculty of Architecture, Building and Planning The University of Melbourne Victoria 3010 [email protected] 0428 220 082 Abstract According to conventional wisdom, small towns and settlements on the fringes of Australian cities are impossible to serve by public transport. Low population densities mean that public transport cannot attract enough passengers to be viable, let alone have any significant impact on levels of car use. The case of semi-rural Switzerland challenges this consensus. Villages around Zurich- Winterthur have population densities comparable to semi-rural Australia, but journey- to-work figures show their public transport mode share exceeding those of most Australian capital cities. While there are obvious differences in urban form, the greatest contrast may be in public transport planning methods and supply policies. This paper compares the settlements in Zurich's Weinland region with those on Victoria's Bellarine Peninsula, focussing in particular on population density and journey-to-work mode shares. In analysing the similarities and differences, it also introduces the Weinland’s transport planning methods (explored in greater detail in Petersen 2009) which appear to be critical to its success. It therefore challenges Australian transport policy makers to reconsider the traditional approach to public transport planning in the commuter belts of Australian cities. -

Stability of Travel Behaviour: Thurgau 2003
Research Collection Working Paper Stability of Travel Behaviour: Thurgau 2003 Author(s): Löchl, Michael Publication Date: 2005 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-b-000066687 Rights / License: In Copyright - Non-Commercial Use Permitted This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more information please consult the Terms of use. ETH Library Stability of Travel Behaviour: Thurgau 2003 Michael Löchl Travel Survey Metadata Series 16 Travel Survey Metadata Series 16 Stability of Travel Behaviour: Thurgau 2003 Michael Löchl IVT ETH Zürich Zürich Phone: +41 44 633 62 58 Fax: +41 44 633 10 57 [email protected] Abstract Within the project, a six week travel survey has been conducted among 230 persons from 99 households in Frauenfeld and the surrounding areas in Canton Thurgau from August until December 2003. The design built on the questionnaire used in the German project Mobidrive, but developed the set of questions further. All trip destinations of the survey have been geocoded. Moreover, route alternatives for private motorised transport and public transport have been calculated. Moreover, the collected data has been compared with the National Travel Survey 2000 (Mikrozensus zum Verkehrsverhalten 2000), whereas differences in terms of sociodemographic characteristics of the respondents and particularly their travel behaviour couldn't be observed except for an higher proportion of GA and Halbtax ownership. For example, the average trip frequency per person and day is almost the same. In order to check for possible fatigue effects of the amount of reported trips, several GLM (Generalised Linear Model) and poisson regression models have been estimated besides descriptive analysis. -

Stammheim 2009 23
Springkonkurrenz Stammheim 2009 23. / 24. Mai 2009 Samstag: Kombinierte Prüfung Dressur - Springen 1912-2009 OKV Junioren A+S Cup Dragonerspringen Sonntag: Freie Springprüfungen Schauprogramm RI und RII - Springen Gedeckte Festwirtschaft mit reichhaltigem Angebot für Gross und Klein. «S’hätt für alli öppis». SPRINGKONKURRENZ 2009 STAMMHEIM Gestaltung Verband Ostschweizerischer Konzepte Kavallerie- und Drucksachen Reitvereine Beschriftungen Programm Freitag, 22. Mai 2009 ab 17.00 Uhr Vereinsspringen Vereinsspringen in 3 Stufen kleine Festwirtschaft Samstag, 23. Mai 2009 7.30 Uhr Komb. Prüfung, Dressur Preis vom Schloss Girsberg Familie Henry Bodmer, Zollikerberg Plaketten: Mirror-Polish AG, Basadingen Flots: Velosport Fridolin Keller, Unterstammheim 10.30 Uhr Komb. Prüfung, Springen A Zm 12.00 Uhr OKV Junioren A & S Cup Preis der Leihkasse Stammheim Springen A Zm Plaketten: Bahnhofgarage Walther, Unterstammheim Flots: Beat Wirth, Sanitär-Heizungen, Oberstammheim anschl. OKV Junioren A & S Cup Stilprüfung 15.00 Uhr Dragonerspringen, A Zm Preis der Stammertaler Winzer M. & H. Glesti, Oberstammheim, M & K. Keller, Waltalingen Stammheimer-Winzer Genossenschaft, Oberstammheim Plaketten: Metzgerei zur Krone, Unterstammheim Flots: RUBA Objekteinrichtungen, Oberneunforn anschl. Dragonerspringen, Preis der Dragoner Zweiphasen A Zm Senioren des RV Stammheimertal Plaketten: Vereinigung Alte Garde anschl. Gesangseinlage vom Flots: Senioren des RV Stammheimertal Dragonerchörli Sonntag, 24. Mai 2009 08.00 Uhr Freie Prüfung, A Zm Preis vom Gasthof zum -

Neues Zur Geologie Zwischen Thur Und Rhein
Neues zur Geologie zwischen Thur und Rhein Autor(en): Müller, Erich R. Objekttyp: Article Zeitschrift: Mitteilungen der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft Band (Jahr): 53 (1995) PDF erstellt am: 05.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-593743 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch NEUES ZUR GEOLOGIE ZWISCHEN THÜR UND RHEIN Anmerkung: Sämtliche Orts- und Flurbezeichnungen entsprechen der Landes- karte der Schweiz 1 : 25 000, Bundesamt für Landestopographie, 3084 Wabern: Blätter 1031 (Neunkirch), 1032 (Diessenhofen), 1033 (Steckborn), 1052 (Andelfingen), 1053 {Frauenfeld). ZUSAMMENFASSUNG: In der vorliegenden Arbeit wird nach einer kurzen Übersicht die Literatur skizziert, die das Gebiet beschreibt. -

RRB-2012-0275.Pdf
Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich Sitzung vom 21. März 2012 275. Regionaler Richtplan Weinland (Teilrevision regionaler Richtplan, Teil Verkehr, betreffend Fuss-, Wander- und Radwege) A. Ausgangslage Mit Beschluss Nr. 2661/1997 setzte der Regierungsrat den regionalen Richtplan Weinland fest. Mit Schreiben vom 7. Oktober 2011 beantragt die Zürcher Planungsgruppe Weinland (ZPW), gestützt auf den Be- schluss der Delegiertenversammlung vom 30. Juni 2011, Festlegungen im regionalen Richtplan Verkehr zu den Fuss- und Wanderwegen sowie Radwegen zu ändern. Die Vereinigung Zürcher Wanderwege (ZAW) beantragte nach Ab- stimmung mit den betroffenen Gemeinden in den Jahren 2009 und 2010 verschiedene Verlegungen oder Neuaufnahmen von Fuss- und Wander- wegen. B. Änderungen betreffend Fuss-, Wander- und Radwege Die Änderungen der Fuss- und Wanderwege (Kartenteil 1, Plan Mst. 1:25000, dat. 30. Juni 2011) umfassen: – Ossingen: Verlegung des Wanderwegs entlang der Thur – Laufen-Uhwiesen: Verlegung des Wanderwegs im Kern von Uhwiesen – Ossingen: Weiterführung des Thuruferwegs von Pfingstweid nach Äuli – Waltalingen: Verlegung des Wanderwegs entlang der Neun fornerstrasse – Berg a.I. und Flaach: Neuer Wanderweg Ziegelhütte–Tüfels Chanzle Zudem wird nach Abstimmung mit den kantonalen Fachstellen und den betroffenen Gemeinden die Linienführung des Radwegs zwischen Ossingen und Guntalingen geändert. Die Strecke Ossingen–Gisenhard– Guntalingen wird aufgehoben und dafür neu die Strecke Ossingen– Trutti kon–Guntalingen festgelegt (Kartenteil 2, Plan Mst. 1:25000, dat. 30. Juni 2011). – 2 – Der regionale Richtplantext wird wie folgt geändert: 4.3.1.4 Radwege Festlegung Ossingen – Truttikon Gisenhard – Guntalingen C. Anhörung und Mitwirkung Die Anhörung und öffentliche Auflage fand von 28. Januar 2011 bis 30. März 2011 statt. Während der Auflagefrist gingen zwei Einwendun- gen mit drei Anträgen ein, wovon einer vollständig berücksichtigt wurde. -

Blätter Aus Dem Thurgauer Wald
Blätter aus dem Thurgauer Wald Informationen für Waldeigentümer und Forstreviere 25. Jahrgang, Nr. 4, November 2018 2 Editorial Geschätzte Leserinnen und Leser Es war ein wunderbarer Herbst! Sowohl der Sep- lich muss wohl auch die Thematik Wald und tember als auch der Oktober waren von viel Klimawandel verstärkt diskutiert werden. Trotz Sonnenschein und milden Temperaturen ge- allem werden Waldbesitzer und Förster in den prägt, und dies nach einem Jahrhundertsommer. nächsten Wochen und Monaten darauf bedacht Die Bevölkerung hat dies sicherlich in vollen Zü- sein, weitere, noch frische Käfernester zu ent- gen genossen. Nun, das ist natürlich legitim, decken und diese aus dem Wald zu entneh- aber wir sind nun einmal Förster und nicht Ba- men. Damit sollte dann auch der offensichtlich demeister. Wir vermissen den Regen seit dem vorhandene Bedarf an Frischholz abgedeckt Frühjahr und nun brachte auch der Frühherbst werden können. die sehnlichst erhoffte, längere Niederschlags- Der Frühherbst 2018 brachte auf dem Forst- periode nicht. Obwohl: Gerade als ich diese Zei- amt zwei grössere personelle Veränderungen len verfasse, regnet es im Tessin und in Teilen mit sich. Einerseits trat per Ende August Gerold des Kantons Wallis teils massiv. Dort geht es Schwager, Leiter Abteilung Planung und Beiträ- sozusagen von der Waldbrandgefahr direkt in ge, nach 28 Jahren in den Ruhestand und ande- eine Hochwassersituation hinüber. Aber wo rerseits ging auch Ruedi Bohren, Leiter Zentrale bleibt die breite Regenfront für die ganze Dienste, nach 15 Jahren per Ende September in Schweiz? Und wo bleiben die sonst für unsere Pension. Ich danke an dieser Stelle den beiden Gebiete so charakteristischen Landregen? nochmals für ihren Einsatz zugunsten des Wal- Die warmen bis sehr warmen Temperaturen des und des Kantons Thurgau. -
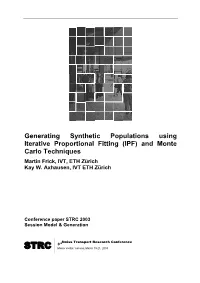
Generating Synthetic Populations Using Iterative Proportional Fitting (IPF) and Monte Carlo Techniques Martin Frick, IVT, ETH Zürich Kay W
Generating Synthetic Populations using Iterative Proportional Fitting (IPF) and Monte Carlo Techniques Martin Frick, IVT, ETH Zürich Kay W. Axhausen, IVT ETH Zürich Conference paper STRC 2003 Session Model & Generation Swiss Transport Research Conference 3 rd STRC Monte Verità / Ascona, March 19-21, 2003 Swiss Transport Research Conference _______________________________________________________________________________ March 19-21, 2003 Generating Synthetic Populations using Itera- tive Proportional Fitting (IPF) and Monte Carlo Techniques Martin Frick IVT ETH Zürich 8093 Zürich Phone: 01-633 37 13 Fax: 01-633 10 57 e-Mail: [email protected] I Swiss Transport Research Conference _______________________________________________________________________________ March 19-21, 2003 Abstract The generation of synthetic populations represents a substantial contribution to the acquisition of useful data for large scale multi agent based microsimulations in the field of transport plan- ning. Basically, the observed data is available from censuses (microcensus) in terms of simple summary tables of demographics, such as the number of persons per household for census block group sized areas. Nevertheless, there is a need of more disaggregated personal data and thus another data source is considered. The Public Use Sample (PUS), often used in transportation studies, is a 5% representative sample of almost complete census records for each individual, missing addresses and unique identifiers, including missing items. The problem is, to generate a large number of individual agents (~ 1Mio.) with appropriate characteristic values of the demo- graphic variables for each agent, interacting in the microsimulation. Due to the fact that one is faced with incomplete multivariate data it is useful to consider multiple data imputation tech- niques. In this paper an overview is given over existing methods such as Iterative Proportional Fitting (IPF), the Maximum Likelihood method (MLE) and Monte-Carlo (MC) techniques. -

SEBA Gene Conservation Units (EUFORGEN) Proposal for Selction of Candidate Gene Conservation Units (GCU) for Scattered Broadleav
SEBA Gene conservation units (EUFORGEN) page 1 / 2 Proposal for selction of candidate gene conservation units (GCU) for scattered broadleaves in Switzerland attrib Record ID Entry Latin species name Bewertu Notes on qualification Type of Canton Region Municipality Forest Provenance Notes on location Notes on Type of ex situ National Notes on juristic Longitude Latitude Digita Altitude Main river River last levelTotal area Total area Year(s) of Number Average Genotype Average number Average Share in Type of marker(s) Notes on ute Numb ng pot. population Region responsable Conservation Registration aspects X coordinate Y coordinate lizatio (m) tributary stand (ha) region establish of number s of trees (nr/ha) number of total basal genetic er GCU 1 structure partners Unit Number n of (ha) ment genotype of ramets originate trees (nr/ha) area (%) information Phase in situ GIS s per from ## ID_rec ID_id ID_nr ID_spec_name QU_pro QU_note LO_pop_typ LO_kt LO_reg LO_muni LO_for LO_prov LO_note LO_partner_not JU_exSitu_type JU_nat_nr JU_note SI_lon_X SI_lon_Y SI_di SI_alt SI_river_mai SI_river_lastl ST_stand ST_regio ST_date ST_geno ST_rame ST_regio ST_spec_dens ST_spec_d ST_spec_s GE_markers_type GE_note 603 IN-ACEPL-CHE-03 3 Acer platanoides 1 high regional density, population size C region GL Nordalpen Region Glarner Unterland (5 0 Swiss Northern 0 0 0 0 0 728000 219500 (Y) 420- Rhein Linth, Limmat 0 78 km2 0000 10'000 >2 >1 - 0 and quality (SEBA1) due to the Gemeinden): Bilten, Niederunren, Alps 1000 influence of Foehn (warm and dry wind Oberurnen, -

Regiorok Weinland
ZPW Zürcher Planungsgruppe Weinland RegioROK Weinland von der Delegiertenversammlung verabschiedet am 30. Juni 2011 Regio ROK - Gesamtplan 30.06.2011 Feuerthalen A V A Flussbad Flussbad Siedlung Flurlingen Weiler Rheinfall Schloss Laufen traditionelle Dorfkerne Laufen-Uhwiesen Dachsen Siedlungen im ländlichen Umfeld Siedlungen im urbanen Umfeld Siedlungsbegrenzungslinien Flussbad A Funktionen Benken Siedlungsschwerpunkte Unterstammheim Kloster Rheinau A Arbeitsschwerpunkte A V A Trüllikon Rheinau V Versorgungsschwerpunkte Marthalen V Oberstammheim Truttikon Verkehr Naturbad Waltalingen Bahn Seebad Hauptverkehrsstrasse / Hochleistungsstrasse Ossingen Radroute von nationaler Bedeutung hist. Ortskern am A Rheinufer, Ellikon Kleinandelfingen Flussbad Camping Naturstrand Landschaft / Landwirtschaft V Camping Naturstrand und Naturstrand A Naturstrand Naturlandschaft / Wald Naturstrand Naturstrand Naturstrand Naturlandschaft Übergang ausserhalb ZPW Naturstrand Andelfingen Thalheim Kulturlandschaft Flaach A Adlikon Steubisallmend Camping V Golfplatz Flussbad Humlikon Vernetzung Auenzentrum Volken Dorf Durchlässe A4 Berg am Irchel Henggart V Übergänge Brücken A grossräumige Naturschutzgebiete und wiederherzustellende Biotope ökologische Vernetzung Buch am Irchel ökologische Vernetzung Fluss N Erholungsschwerpunkte Ausflugsziele Ortskerne als Erlebnisräume Schwerpunkte Naturerlebnisräume 30.06.2011 Inhalt 1 Einleitung/ Ablauf 1 1.1 Verfahrensablauf 1 1.2 Ziel und Inhalt des RegioROK 1 1.3 Verwendete Grundlagen 1 2 Positionierung und Leitidee 2 -
Passerteilungen in Zürich Nach Amerika Und Australien 1848-1870
Staatsarchiv des Kantons Zürich Passerteilungen in Zürich nach Amerika und Australien 1848-1870 Auswertung der Passkontrollen 1848-1870 (Staatsarchiv Zürich, PP 38.42-63) Bearbeitet durch Hans Ulrich Pfister. Stand: 30.11.2005 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung und Erläuterungen 2. Passerteilungen nach Nordamerika (und Amerika) 1848-1870 3. Passerteilungen nach Mittelamerika und Südamerika 1848-1870 4. Passerteilungen nach Australien 1848-1870 1. Einleitung und Erläuterungen Passkontrollen sind eine wichtige Quelle für die Ermittlung von Auswanderer- Namen. Die im Staatsarchiv des Kantons Zürich aufbewahrten Kontrollen über die von der Staatskanzlei ausgestellten Auslandspässe enthalten in den Jahren 1848 bis 1870 besonders viele Namen von Reisenden nach Übersee, hauptsächlich nach Amerika, bei denen es sich wohl in den meisten Fällen um Auswanderer handelte. Ein Spitzenjahr der Auswanderung war das Jahr 1854. Es gab daneben aber auch andere Gruppen wie die Kaufleute oder die Missionare, welche für ihre Reisen einen Pass benötigten. Unbekannt ist, wie gross der Anteil der Auswanderer war, welche keinen Pass für ihre Reise bezogen. Auch enthalten die bearbeiteten Bände der Passkontrolle nicht alle im Kanton Zürich erteilten Pässe. Wiederholt wurden einzelne kleine Nummern- blöcke an das Statthalteramt Winterthur abgetreten, welches ebenfalls Passerteilun- gen vornahm. Erläuterungen zu den erfassten Angaben: Die Angaben zu den Passerteilungen weisen folgende Reihenfolge auf: Inhalt: Kommentar: Familienname Wiedergabe normalisiert nach heutiger amtlicher Festle- gung der Namen. Vorname(n) Teils normalisiert wiedergegeben (z.B. Konrad statt „Conrad“). Charakterisierungen Zum Beispiel Jgfr. [Jungfrau], Fräulein, Frau, Witwe, so- weit diese Bezeichnungen in der Passkontrolle aus- drücklich vermerkt wurden. Die häufig verwendete Be- nennung „Herr“ wurde weggelassen. Bürgerort Grundlage der Angaben bilden die jetzigen politischen Gemeinden. -

In Oberneunforn 1
Männerchor Oberneunforn präsentiert: in Oberneunforn 1. bis 3. September 2017 Männerchor Oberneunforn Sängertage 2017 Das Kompetenzzentrum Inhaltsverzeichnis in Unterstammheim für Grusswort des OK Präsidenten 5 Agrar, Haushalt und Garten mit Grusswort des Gemeindepräsidenten 7 der AGROLA Tankstelle Festprogramm 9 Experte Jürg Wasescha 11 Männerchor Oberneunforn 13 Experte Joseph Müller-Büche 15 Organisationskomitee 17 Übersichtsplan 19 Expertin Helene Haegi 21 Sängertag Freitag «Biergrotto» 23 Sängertag Samstag «Hüttengaudi» 25 Sängertag Sonntag 27 www.landistammertal.ch Experte Peter Appenzeller 29 Choreinteilung Nüfermer Gesangsfest vom 3. September 2017 30 Festgottesdienst 33 Das Einkaufserlebnis im Dorfladen Ehrengäste 35 Sponsoren und Gönner 39 Hinweise / Organisation 41 Kinderprogramm 43 Chöre mit Liedern 45 Gesamtchorlied: Sing mit mir 57 Gesamtchorlied: Aus der Traube in die Tonne 58 Volg Guntalingen Volg Oberneunforn Volg Unterstammheim Volg Oberstammheim mit Drogerie und 3 Männerchor Oberneunforn Sängertage 2017 Grusswort des OK Präsidenten Willkommen am Nüfermer Sängerfest in Oberneunforn Liebe Sängerinnen und Sänger Liebe Gäste und Festbesucher Der Männerchor Oberneunforn freut sich, Sie vom 1.bis 3. September 2017 bei uns in Oberneunforn begrüssen zu dürfen. Das Sängerfest 2017 verbinden wir mit unserem 135-jährigen Jubiläum. Es ist für uns der Höhepunkt im laufenden Vereinsjahr. Drei Tage Festivitäten, da ist für jeden etwas dabei, das ist uns wichtig. Wir komponieren mit Ihnen Freitag 1. September2017 Eröffnung in der Biergrotto Samstag 2. September 2017 Unterhaltungsabend und Barbetrieb mit verschiedenen Darbietungen in der Festhalle Sonntag 3. September 2017 Verbandssängertag Harmonie Es ist uns eine Ehre, den Sängertag „Harmonie“ mit den Verbandschören und einer grossen Anzahl Gastchören bei uns willkommen zu heissen. Der Männerchor Oberneunforn, die Bevölkerung und alle Helferinnen und Helfer freuen sich auf die Traumreise Ihres Lebens viele Festbesucher und wünschen allen viele fröhliche Stunden bei uns in Oberneunforn. -

Sozioökonomisches Profil Der Provisorischen Standortregionen
Bestandesaufnahme Sozialstrukturen im Sach- planverfahren für geologische Tiefenlager Teil I: Sozioökonomisches Profil der provisorischen Standortregionen Standortregion Zürich Nord-Ost Im Auftrag des Bundesamtes für Energie BFE Rüschlikon, Januar 2011 IMPRESSUM 2 Auftraggeber Bundesamt für Energie BFE, Projektbegleitung: Simone Brander Auftragnehmer Rütter+Partner, Sozioökonomische Forschung und Beratung Autoren / Autorinnen Dr. Heinz Rütter (Projektleitung) Christian Schmid (Projektkoordination) Andreas Rieser Sabine Schneiter Edward Weber Alex Beck Dr. Ursula Rütter-Fischbacher Anja Umbach-Daniel Adresse Rütter+Partner, Weingartenstr. 5, 8803 Rüschlikon +41 (0)44 724 27 70, [email protected] INHALT 3 Zusammenfassung 4 1. Einleitung und Zielsetzung 9 2. Methodisches Vorgehen 12 3. Übersicht provisorische Standortregionen 16 3.1 Provisorische Standortregionen und Planungsperimeter 17 3.2 Ausgewählte Indikatoren 27 4. Sozioökonomisches Profil provisorische Standortregion Zürich Nord-Ost 40 4.1 Bevölkerungs- und Sozialstruktur 45 4.2 Politik 71 4.3 Wirtschaft 76 4.4 Identifikation von Gruppen für den Aufbau der regionalen Partizipation 92 Anhang 94 Quellenverzeichnis 95 4 Zusammenfassung ZUSAMMENFASSUNG 5 Sozioökonomisches Profil Deutschland ■ Ziel der Vorarbeiten für die regionale Partizipation im Thayngen Sachplanverfahren für geologische Tiefenlager ist es, mit einem systematischen, transparenten Verfahren Schaffhausen Kt. SH ! Dörflingen Löhningen diejenigen Sozialstrukturen zu erfassen, welche die Büsingen Beringen Gailingen Kt. SH Region