Zum Jahresbericht Der
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Hamburger Kurs 1/2017 (Pdf)
1.2017 | Mitteilungen der SPD Hamburg Hamburger Kuvorrwsärts Guter Auftakt FÜR 2017 WIR SIND BEREIT FÜR DEN WAHLKAMPF Foto: Kirill Brusilovsky Kirill Foto: Martin Schulz beim Neumitgliederabend im Distrikt Oberalster mit dem Hörbuch der SPD Hamburg „150 Jahre SPD“ * Am 29. Januar hat der SPD-Bundesvorstand Martin Schulz Martin überreichte den jüngst eingetretenen Genossinnen die Handschrift der SPD. Er rief dazu auf, diese sozialdemo- einstimmig als Kanzlerkandidat und Parteichef nominiert. und Genossen ihre Parteibücher und nahm sich Zeit für per- kratischen Werte zu verteidigen und sich für soziale- und Damit wurde ein starkes Signal zum Aufbruch für das Wahl- sönliche Gespräche mit den Neumitgliedern an den Tischen Steuergerechtigkeit einzusetzen. jahr 2017 gesetzt. Allein im Verlauf seiner Wir treten mit Aydan Özoğuz, mitreißenden Rede konnten 200 On- Johannes Kahrs, Dorothee Mar- line-Neueintritte in die SPD verzeichnet tin, Niels Annen, Dr. Matthias werden. Seit der Bekanntgabe der Nomi- Bartke, Metin Hakverdi und den nierung von Martin Schulz haben sich die Kandidatinnen und Kandidaten Neueintritte sogar auf 5000 bundesweit der Landesliste für Hamburg an summiert - allein in Hamburg sind es 375 und freuen uns auf einen enga- neue Genossinnen und Genossen (Stand: gierten Wahlkampf, mit dem 16.2.2017). Ziel alle sechs hamburger Wahl- kreise für die SPD zu gewinnen. Wir freuen uns über jeden, der den Weg zu uns findet und uns in unserem Han- Die SPD-Landesorganisation deln und Wirken unterstützen möchte. stellt neben der Organisation Die vielen Neumitglieder sind eine große der Veranstaltungen mit Olaf Unterstützung für die SPD – nicht nur, SPD Hamburg Foto: Scholz und den jeweiligen Di- aber besonders im Wahlkampfjahr 2017. -

Profile Persönlichkeiten Der Universität Hamburg Profile Persönlichkeiten Der Universität Hamburg Inhalt
FALZ FÜR EINKLAPPER U4 RÜCKENFALZ FALZ FÜR EINKLAPPER U1 4,5 mm Profile persönlichkeiten der universität hamburg Profile persönlichkeiten der universität hamburg inhalt 6 Grußwort des Präsidenten 8 Profil der Universität Portraits 10 von Beust, Ole 12 Breloer, Heinrich 14 Dahrendorf, Ralf Gustav 16 Harms, Monika 18 Henkel, Hans-Olaf 20 Klose, Hans-Ulrich 22 Lenz, Siegfried 10 12 14 16 18 20 22 24 Miosga, Caren 26 von Randow, Gero 28 Rühe, Volker 30 Runde, Ortwin 32 Sager, Krista 34 Schäuble, Wolfgang 24 26 28 30 32 34 36 36 Schiller, Karl 38 Schmidt, Helmut 40 Scholz, Olaf 42 Schröder, Thorsten 44 Schulz, Peter 46 Tawada, Yoko 38 40 42 44 46 48 50 48 Voscherau, Henning 50 von Weizsäcker, Carl Friedrich 52 Impressum grusswort des präsidenten Grußwort des Präsidenten der Universität Hamburg Dieses Buch ist ein Geschenk – sowohl für seine Empfänger als auch für die Universität Hamburg. Die Persönlichkeiten in diesem Buch machen sich selbst zum Geschenk, denn sie sind der Universität auf verschiedene Weise verbunden – als Absolventinnen und Absolventen, als ehemalige Rektoren, als prägende Lehrkräfte oder als Ehrendoktoren und -senatoren. Sie sind über ihre unmittelbare berufliche Umgebung hinaus bekannt, weil sie eine öffentliche Funktion wahrnehmen oder wahrgenommen haben. Die Universität Hamburg ist fern davon, sich selbst als Causa des beruflichen Erfolgs ihrer prominenten Alumni zu betrach- ten. Dennoch hat die Universität mit ihnen zu tun. Sie ist der Ort gewesen, in dem diese Frauen und Männer einen Teil ihrer Sozialisation erfahren haben. Im glücklicheren Fall war das Studium ein Teil der Grundlage ihres Erfolges, weil es Wissen, Kompetenz und Persönlichkeitsbildung ermöglichte. -

Plenarprotokoll 15/102
Plenarprotokoll 15/102 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 102. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 1. April 2004 Inhalt: Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Edelgard Bulmahn, Bundesministerin nung . 9147 A BMBF . 9160 A Absetzung der Tagesordnungspunkte 17, 20, Katherina Reiche CDU/CSU . 9160 C 23 h und 23 i . 9148 B Jörg Tauss SPD . 9163 A Nachträgliche Ausschussüberweisungen . 9148 B Katherina Reiche CDU/CSU . 9163 C Grietje Bettin BÜNDNIS 90/ Tagesordnungspunkt 3: DIE GRÜNEN . 9163 C a) Erste Beratung des von den Fraktionen Cornelia Pieper FDP . 9164 A der SPD und des BÜNDNISSES 90/ Christoph Hartmann (Homburg) FDP . 9165 A DIE GRÜNEN eingebrachten Ent- wurfs eines Gesetzes zur Sicherung Petra Pau fraktionslos . 9165 D und Förderung des Fachkräftenach- Dr. Ernst Dieter Rossmann SPD . 9166 D wuchses und der Berufsausbil- dungschancen der jungen Genera- Dagmar Wöhrl CDU/CSU . 9168 A tion (Berufsausbildungssicherungs- gesetz – BerASichG) Swen Schulz (Spandau) SPD . 9170 C (Drucksache 15/2820) . 9148 C b) Antrag der Abgeordneten Cornelia Pieper, Christoph Hartmann (Hom- Tagesordnungspunkt 4: burg), weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP: Ausbildungsplatz- Antrag der Abgeordneten Karl-Josef abgabe verhindern – Wirtschaft Laumann, Dagmar Wöhrl, weiterer Abge- nicht weiter belasten – Berufsausbil- ordneter und der Fraktion der CDU/CSU: dung stärken Weichen stellen für eine bessere Be- (Drucksache 15/2833) . 9148 D schäftigungspolitik – Wachstumspro- gramm für Deutschland Jörg Tauss SPD . 9149 A (Drucksache 15/2670) . 9172 A Friedrich Merz CDU/CSU . 9151 B Karl-Josef Laumann CDU/CSU . 9172 B Dr. Thea Dückert BÜNDNIS 90/ Klaus Brandner SPD . 9175 C DIE GRÜNEN . 9154 A Dirk Niebel FDP . 9176 A Cornelia Pieper FDP . 9155 B Karl-Josef Laumann CDU/CSU . -

Organizational Change in Office-Seeking Anti-Political
Adapt, or Die! Organizational Change in Office-Seeking Anti- Political Establishment Parties Paper for Presentation at the Annual General Meeting of the Canadian Political Science Association in Winnipeg, Manitoba, June 3-5, 2004. Amir Abedi, Ph.D. Dr. Steffen Schneider Department of Political Science Collaborative Research Center 597 – Western Washington University Transformations of the State 516 High Street, MS-9082 University of Bremen Bellingham, WA 98225-9082 P.B. 33 04 40 USA 28334 Bremen Germany Tel.: +1-360-650 4143 +49-421-218 8715 Fax: +1-360-650-2800 +49-421-218 8721 [email protected] [email protected] Draft version – not to be quoted – comments welcome I Introduction Over the last few years, the entry of radical right-wing parties into national governments in Austria, Italy and the Netherlands has made headlines around the world and sparked debates on the impact that the government participation of these formations might have on policy- making, political cultures and system stability in the affected countries (Hainsworth, 2000; Holsteyn and Irwin, 2003; Kitschelt, 1995; Luther, 2003; Minkenberg, 2001). There has been much less discussion about the effects of government participation on radical right-wing parties themselves. After all, they tend to portray themselves as challengers of the political establishment up to the moment of joining coalitions with their mainstream competitors. In this, they are comparable to new politics, left-libertarian or green parties, which began their life as challengers of the establishment as well but have joined national governments in Belgium, Finland, France, Germany and Italy over the last decade (Müller-Rommel, 1998; Taggart, 1994). -
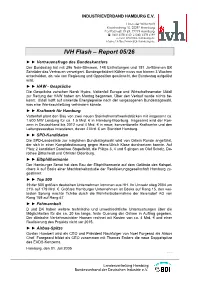
IVH Flash – Report 05/26
INDUSTRIEVERBAND HAMBURG E.V. Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10, 22297 Hamburg Postfach 60 19 69, 22219 Hamburg 040/ 6378-4120 040/ 6378-4199 e-mail: [email protected] Internet: http://www.BDI-Hamburg.de IVH Flash – Report 05/26 ► ► Vertrauensfrage des Bundeskanzlers Der Bundestag hat mit 296 Nein-Stimmen, 148 Enthaltungen und 151 Ja-Stimmen BK Schröder das Vertrauen verweigert. Bundespräsident Köhler muss nun binnen 3 Wochen entscheiden, ob, wie von Regierung und Opposition gewünscht, der Bundestag aufgelöst wird. ► ► HAW - Gespräche Die Gespräche zwischen Norsk Hydro, Vattenfall Europe und Wirtschaftssenator Uldall zur Rettung der HAW haben am Montag begonnen. Über den Verlauf wurde nichts be- kannt. Uldall hofft auf sinkende Energiepreise nach der vorgezogenen Bundestagswahl, was eine Werksschließung verhindern könnte. ► ► Kraftwerk für Hamburg Vattenfall plant den Bau von zwei neuen Steinkohlekraftwerksblöcken mit insgesamt ca. 1.600 MW Leistung für ca. 1.5 Mrd. € in Hamburg-Moorburg. Insgesamt wird der Kon- zern in Deutschland bis 2012 rund 4 Mrd. € in neue, konventionelle Kraftwerke und den Leitungssausbau investieren, davon 2 Mrd. € am Standort Hamburg. ► ► SPD-Kandidaten Die SPD-Landesliste zur möglichen Bundestagswahl wird von Ortwin Runde angeführt, der sich in einer Kampfabstimmung gegen Hans-Ulrich Klose durchsetzen konnte. Auf Platz 2 kandidiert Dorothee Stapelfeldt, die Plätze 3, 4 und 5 gingen an Olaf Scholz, Do- rothee Bittscheidt und Christel Oldenburg. ► ► Elbphilharmonie Der Hamburger Senat hat dem Bau der Elbphilharmonie auf dem Gelände des Kaispei- chers A auf Basis einer Machbarkeitsstudie der Realisierungsgesellschaft Hamburg zu- gestimmt. ► ► Top 500 39 der 500 größten deutschen Unternehmen kommen aus HH. Ihr Umsatz stieg 2004 um 21% auf 179 Mrd. -

Protestparteien in Regierungsverantwortung
Universität Potsdam Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät Sommersemester 2006 Protestparteien in Regierungsverantwortung Die Grünen, die Alternative Liste, die STATT Partei und die Schill- Partei in ihrer ersten Legislaturperiode als kleine Koalitionspartner Dissertation Termin der Disputation: 14.06.2007 Betreuer/1.Gutachter: Prof. Dr. Jürgen Dittberner Zweitgutachter: Prof. Dr. Klaus Götz vorgelegt von: Adriana Wipperling Matrikelnummer: 129777 1 Impressum: Verantwortlich für den Inhalt: Adriana Wipperling Anschrift: Rosenweg 12 14772 Brandenburg Telefon: (03381) 70 71 91 Email: [email protected] Betreuende Einrichtung: Universität Potsdam Am Neuen Palais 10 14469 Potsdam Online veröffentlicht auf dem Publikationsserver der Universität Potsdam: http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2008/2703/ urn:nbn:de:kobv:517-opus-27030 [http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-27030] 2 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 6 1. 1. Problemstellung 6 1. 2. Stand der Forschung 7 1. 3. Aufbau und Methodik 10 2. Was ist eine Protestpartei? 12 2. 1. Definition des Begriffs „Politische Partei“ 12 2. 2. Protestparteien und soziale Bewegungen 15 2. 3. Protestparteien und Protestwähler 18 2. 4. Protest- vs. Milieupartei? 22 2. 4. 1. Die Entstehung sozialer Milieus 22 2. 4. 2. Grüne und PDS: Stamm- und Protestwähler 24 2. 4. 3. Die PDS zwischen Protest-, Milieu- und Regierungspartei 26 2. 4. 4. Die Grünen: Prototyp einer Bewegungspartei 30 2. 5. Das Basiskonsens-Konzept von Stöss 35 2. 6. Merkmale von Protestparteien 38 3. Regieren in Koalitionen 40 3. 1. Koalitionsbegriff und Koalitionstypen 41 3. 2. Großparteien und Kleinparteien 43 3. 3. Koalitionstheorie und Koalitionsmodelle 46 3. 3. 1. Das „Office-Seeking“-Theorem 46 3. 3. -
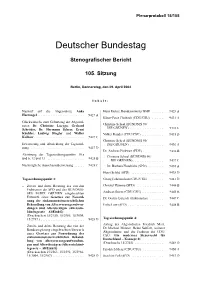
Andreas Storm (CDU/CSU)
Plenarprotokoll 15/105 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 105. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 29. April 2004 Inhalt: Nachruf auf die AbgeordneteAnke Hans Eichel, Bundesminister BMF . 9429 A Hartnagel . 9427 A Klaus-Peter Flosbach (CDU/CSU) . 9431 A Glückwünsche zum Geburtstag der Abgeord- neten Dr. Christine Lucyga, Gerhard Christine Scheel (BÜNDNIS 90/ Schröder, Dr. Hermann Scheer, Ernst DIE GRÜNEN) . 9433 C Küchler, Ludwig Stieglerund Walter Volker Kauder (CDU/CSU) . 9435 D Kolbow . 9427 C Christine Scheel (BÜNDNIS 90/ Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- DIE GRÜNEN) . 9436 A nung . 9427 D Dr. Andreas Pinkwart (FDP) . 9436 B Absetzung der Tagesordnungspunkte 10 a Christine Scheel (BÜNDNIS 90/ und b, 12 und 13 . 9428 B DIE GRÜNEN) . 9437 C Nachträgliche Ausschussüberweisung . 9428 C Dr. Barbara Hendricks (SPD) . 9438 A Horst Schild (SPD) . 9438 D Tagesordnungspunkt 3: Georg Fahrenschon (CDU/CSU) . 9441 D – Zweite und dritte Beratung des von den Christel Humme (SPD) . 9444 B Fraktionen der SPD und des BÜNDNIS- SES 90/DIE GRÜNEN eingebrachten Andreas Storm (CDU/CSU) . 9445 B Entwurfs eines Gesetzes zur Neuord- Dr. Gesine Lötzsch (fraktionslos) . 9447 C nung der einkommensteuerrechtlichen Behandlung von Altersvorsorgeaufwen- Erika Lotz (SPD) . 9448 B dungen und Altersbezügen (Altersein- künftegesetz – AltEinkG) (Drucksachen 15/2150, 15/2986, 15/3004, 15/2987 ) . 9428 D Tagesordnungspunkt 4: Antrag der Abgeordneten Friedrich Merz, – Zweite und dritte Beratung des von der Dr. Michael Meister, Heinz Seiffert, weiterer Bundesregierung eingebrachten Entwurfs Abgeordneter und der Fraktion der CDU/ eines Gesetzes zur Neuordnung der CSU: Ein modernes Steuerrecht für einkommensteuerrechtlichen Behand- Deutschland – Konzept 21 lung von Altersvorsorgeaufwendun- (Drucksache 15/2745) . gen und Altersbezügen (Alterseinkünf- 9449 D tegesetz – AltEinkG) Friedrich Merz (CDU/CSU) . -

Luuk Molthof Phd Thesis
Understanding the Role of Ideas in Policy- Making: The Case of Germany’s Domestic Policy Formation on European Monetary Affairs Lukas Hermanus Molthof Thesis submitted for the degree of PhD Department of Politics and International Relations Royal Holloway, University of London September 2016 1 Declaration of Authorship I, Lukas Hermanus Molthof, hereby declare that this thesis and the work presented in it is entirely my own. Where I have consulted the work of others, this is always clearly stated. Signed: ______________________ Date: ________________________ 2 Abstract This research aims to provide a better understanding of the role of ideas in the policy process by not only examining whether, how, and to what extent ideas inform policy outcomes but also by examining how ideas might simultaneously be used by political actors as strategic discursive resources. Traditionally, the literature has treated ideas – be it implicitly or explicitly – either as beliefs, internal to the individual and therefore without instrumental value, or as rhetorical weapons, with little independent causal influence on the policy process. In this research it is suggested that ideas exist as both cognitive and discursive constructs and that ideas simultaneously play a causal and instrumental role. Through a process tracing analysis of Germany’s policy on European monetary affairs in the period between 1988 and 2015, the research investigates how policymakers are influenced by and make use of ideas. Using five longitudinal sub-case studies, the research demonstrates how ordoliberal, (new- )Keynesian, and pro-integrationist ideas have importantly shaped the trajectory of Germany’s policy on European monetary affairs and have simultaneously been used by policymakers to advance strategic interests. -
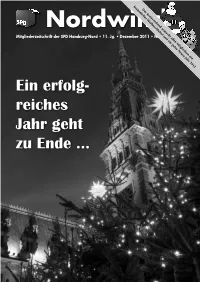
Nordwind 12/2011 (Pdf)
b e s D in e n r li K ch r e e s is W vo e rs ih ta n n a d ch w t ü Nordwind s n f e s st c u h n t Mitgliederzeitschrift der SPD Hamburg-Nord • 11. Jg. • Dezember 2011 • Nr. 35 d a ll e en in g M u i t tg es li N ed e eu r e n s e J in ah r 2 0 1 2 Ein erfolg - reiches Jahr geht zu Ende … Editorial Leitlinien Liebe Genossinnen und Genossen, Liebe Genossinnen und Genossen, mit den Nachrückerinnen Sylvia Wowretz - ein ereignisreiches politisches Jahr 2011 ko und Barbara Nitruch sind nunmehr 13 geht zu Ende. Mit der Hamburg-Wahl im von 62 SPD-Bürgerschaftsabgeordneten Februar sind wir wieder zur bestimmen - aus der SPD Hamburg-Nord. 6 davon wer - den Kraft im Rathaus und in den sieben den wir in dieser Ausgabe vorstellen. Seit Bezirken geworden. Die nukleare Kata - einigen Monaten haben wir im Bezirk eine strophe in Japan hat die Bundesregierung Koalition mit der FDP. Hauptgrund: Er - zu einem endgültigen Ausstieg aus der möglichung von mehr Wohnungsbau. Atomenergie gezwungen. Die Schulden - Wichtiger Aspekt: Schon im Koalitions - krise in Griechenland und anderen euro - vertrag hatten wir festgeschrieben, dass päischen Staaten hat gezeigt, dass die Sa - wir uns für Quoren bei Bürgerentscheiden nierung der öffentlichen Haushalte einsetzen. Relevanz? Beim jüngsten Bür - wichtig ist und die Staaten der Euro-Zone gerentscheid zum Bebauungsplan Langen - in ihrer Wirtschafts- und Finanzpolitik horn 73 haben ca. 14 % der Abstimmungs - eng miteinander verbunden sind. -

Divided Government“ in Deutschland
Simone Burkhart, Dr. rer. pol., war wissenschaftliche Mitarbeiterin am MPI für Gesellschaftsforschung in Köln. Für die dem Buch zugrundeliegende Dis- sertation wurde sie mit der Otto-Hahn-Medaille der Max-Planck-Gesellschaft ausgezeichnet. Simone Burkhart Blockierte Politik Ursachen und Folgen von „Divided Government“ in Deutschland Campus Verlag Frankfurt/New York Schriften aus dem Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung Köln, Band 60 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. ISBN 978-3-593-38731-4 Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Copyright © 2008 Campus Verlag GmbH, Frankfurt/Main Umschlagmotiv: Gebäude des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung, Köln Satz: Jeanette Störtte; Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, Köln Druck und Bindung: KM-Druck, Groß-Umstadt Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier. Printed in Germany Besuchen Sie uns im Internet: www.campus.de Für meine Familie Inhalt Danksagung ............................................................................................................ 11 Kapitel 1 Der Bundesrat als Blockadeinstrument -

Freitag, 24. April 2009 Namentliche Abstimmung Nr.: 3 Sitzung Des
Beginn: 00:00 Ende: 00:00 218. Sitzung des Deutschen Bundestages am: Freitag, 24. April 2009 Namentliche Abstimmung Nr.: 3 zum Thema: Antrag der Abgeordneten Dr. Werner Hoyer, Elke Hoff, Jens Ackermann, Dr. Karl Addicks, Christian Ahrendt, Uwe Barth, Rainer Brüderle, Angelika Brunkhorst, Ernst Burgbacher, Patrick Döring, Mechthild Dyckmans, Ulrike Flach, Otto Fricke, Horst Friedrich (Bayreuth), Hans-Michael Goldmann, Miriam Gruß, Dr. Christel Happach-Kasan, Heinz-Peter Haustein, Birgit Homburger, Dr. Heinrich Leonhard Kolb, Hellmut Königshaus, Gudrun Kopp, Jürgen Koppelin, Heinz Lanfermann, Harald Leibrecht, Ina Lenke, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Michael Link, Dr. Erwin Lotter, Horst Meierhofer, Patrick Meinhardt, Jan Mücke, Burkhardt Müller- Sönksen, Dirk Niebel, Hans-Joachim Otto, Detlef Parr, Cornelia Pieper, Gisela Piltz, Frank Schäffler, Marina Schuster, Dr. Hermann Otto Solms, Dr. Max Josef Stadler, Dr. Rainer Stinner, Carl-Ludwig Thiele, Florian Toncar, Christoph Waitz, Dr. Claudia Winterstein, Dr. Volker Wissing, Dr. Guido Westerwelle und der Fraktion der FDP für einen Abzug der in Deutschland noch verbliebenen US-Nuklearwaffen; Drs. 16/12667 Endgültiges Ergebnis: Abgegebene Stimmen insgesamt: 503 nicht abgegebene-Stimmen: 109 Ja-Stimmen: 128 Nein-Stimmen: 374 Enthaltungen: 1 ungültige: 0 Berlin, den 24. Apr. 2009 Seite: 1 Seite: 1 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Ulrich Adam X Ilse Aigner X Peter Albach X Peter Altmaier X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Dr. Wolf Bauer X Günter Baumann X Ernst-Reinhard Beck (Reutlingen) X Veronika Bellmann X Dr. Christoph Bergner X Otto Bernhardt X Clemens Binninger X Renate Blank X Peter Bleser X Antje Blumenthal X Dr. Maria Böhmer X Jochen Borchert X Wolfgang Börnsen (Bönstrup) X Wolfgang Bosbach X Klaus Brähmig X Michael Brand X Helmut Brandt X Dr. -

Brechmittel Wahlkampf
# 2001/38 Inland https://jungle.world/artikel/2001/38/brechmittel-wahlkampf Hamburg vor der Bürgerschaftswahl Brechmittel Wahlkampf Von Gaston Kirsche In der Schlussrunde des Hamburger Wahlkampfs wurde bekannt, dass zwei der mutmaßlichen Selbstmordattentäter vom 11. September in der Stadt gelebt haben. Niemand in Hamburg muss sich fürchten«, beteuerte Hamburgs Bürgermeister Ortwin Runde (SPD) in der vergangenen Woche, es gebe »nach den Erkenntnissen aller Sicherheitsexperten keine Anzeichen für eine besondere Gefährdung« in der Stadt. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass zwei der mutmaßlichen Selbstmordattentäter von Manhattan bzw. Washington, der 33jährige Mohamed Atta und der 23jährige Marwan Al- Shehhi, im Stadtteil Harburg gelebt und studiert hatten. Die Meldung platzte in einen Wahlkampf, der vor allem von der Auseinandersetzung um die Innere Sicherheit geprägt war. »Ist die liberale Metropole auch noch bevorzugter Unterschlupf für ausländische Terroristen?« fragte das Hamburger Abendblatt am 14. September besorgt seine LeserInnen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Wahlkampf schon ausgesetzt, alle großen Parteien hatten einer mehrtägigen Pause zugestimmt. Die Ereignisse könnten der SPD endgültig die Chance auf den Sieg bei der Bürgerschaftswahl am kommenden Sonntag genommen haben. Stand sie doch sowieso schon im Ruch, zu viel für Ausländer und zu wenig gegen Kriminelle getan zu haben. In Hamburg herrscht »Wechselstimmung«, wie Ole von Beust, der Spitzenkandidat der CDU, nicht müde wird zu betonen. Nach den jüngsten Umfragen würde die CDU allerdings nur auf 27 Prozent der Stimmen kommen, das wären 3,7 Prozent weniger als im Jahr 1997. Die Partei müsste wieder in die Opposition, gäbe es da nicht den so genannten Bürgerblock. So bezeichnet die Hamburger Presse eine mögliche Koalition der CDU, der FDP und der Partei Rechtsstaatliche Offensive (Pro) des Amtsrichters und Rechtspopulisten Ronald Schill (Jungle World, 28/01).