Protestparteien in Regierungsverantwortung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
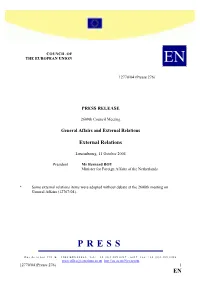
Council of the EU Press Release on Libya Embargo
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION EN 12770/04 (Presse 276) PRESS RELEASE 2609th Council Meeting General Affairs and External Relations External Relations Luxembourg, 11 October 2004 President Mr Bernard BOT Minister for Foreign Affairs of the Netherlands * Some external relations items were adopted without debate at the 2608th meeting on General Affairs (12767/04). P R E S S Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUSSELS Tel.: +32 (0) 2 285 8239 / 6319 Fax: +32 (0)2 285 8026 [email protected] http://ue.eu.int/Newsroom 12770/04 (Presse 276) 1 EN 11.X.2004 Main Results of the Council As part of a policy of engagement vis-à-vis Libya , the Council decided inter alia to lift the arms embargo against that country as well as to repeal a set of economic sanctions adopted by the EU in application of UNSC resolutions. The Council invited Libya to respond positively to this policy, notably with a view to the resolution of remaining EU concerns, in particular the case of the Bulgarian and Palestinian medical workers and other outstanding issues. The Council, addressing the situation in the Middle East , - condemned in the strongest terms the terrorist attacks perpetrated in the Sinai against innocent Egyptian and Israeli citizens; - expressed grave concern at the unprecedented cycle of retaliatory violence in Israel and the Occupied Territories, called on both parties to take steps to fulfil their Roadmap obligations and commitments and welcomed the proposals made by the EU Special Representative for an EU coordinating mechanism for donor assistance to the Palestinian Civil Police. -

Flyer: Anne-Klein-Frauenpreis
Vergabekriterien Informationen Vorschlagsberechtigt sind Personen und Initiativen. Eigenbe- werbungen sind nicht möglich. Mitglieder der Jury können nicht Wenn Sie das Anliegen des Anne-Klein-Frauenpreises teilen, nominiert werden. Aus den Vorschlägen wählt die fünfköpfige Jury freuen wir uns auch über weitere Spenden: Anne-Klein-Frauenpreis die Preisträgerin aus. Heinrich-Böll-Stiftung Nominierungskriterien Konto 307 67 02 Stichwort «Anne Klein» Kandidatinnen für den Anne-Klein-Frauenpreis der Heinrich-Böll- Bank für Sozialwirtschaft Stiftung sollen politisch engagiert und zivilgesellschaftlich vernetzt BLZ 100 205 00 sein sowie als Vorbilder andere Frauen und Mädchen zu geschlech- terdemokratischem Handeln ermutigen. Sie sollen sich durch heraus- IBAN: DE11 1002 0500 0003 0767 02 ragende Aktivitäten und Engagement nachweislich für Frauen und BIC: BFSW DE 33 BER Mädchen ausgezeichnet haben, insbesondere durch Verwirklichung der Geschlechterdemokratie Kontakt: Beseitigung von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts Heinrich-Böll-Stiftung und der geschlechtlichen Identität Anne-Klein-Frauenpreis politisches Engagement zur Verwirklichung von Frauen-, Ulrike Cichon Menschen- und Freiheitsrechten E [email protected] Förderung von Frauen und Mädchen in Wissenschaft T 030.285 34-112 und Forschung www.boell.de/annekleinfrauenpreis Nominierungswürdig sind Frauen, die als Pionierinnen mutig und hartnäckig ihr Anliegen verfolgen, gesellschaftliche Veränderungen bewirken und sich so auch durch Zivilcourage und Widerstand Besuchen sie auch das feministische -

Hamburger Kurs 1/2017 (Pdf)
1.2017 | Mitteilungen der SPD Hamburg Hamburger Kuvorrwsärts Guter Auftakt FÜR 2017 WIR SIND BEREIT FÜR DEN WAHLKAMPF Foto: Kirill Brusilovsky Kirill Foto: Martin Schulz beim Neumitgliederabend im Distrikt Oberalster mit dem Hörbuch der SPD Hamburg „150 Jahre SPD“ * Am 29. Januar hat der SPD-Bundesvorstand Martin Schulz Martin überreichte den jüngst eingetretenen Genossinnen die Handschrift der SPD. Er rief dazu auf, diese sozialdemo- einstimmig als Kanzlerkandidat und Parteichef nominiert. und Genossen ihre Parteibücher und nahm sich Zeit für per- kratischen Werte zu verteidigen und sich für soziale- und Damit wurde ein starkes Signal zum Aufbruch für das Wahl- sönliche Gespräche mit den Neumitgliedern an den Tischen Steuergerechtigkeit einzusetzen. jahr 2017 gesetzt. Allein im Verlauf seiner Wir treten mit Aydan Özoğuz, mitreißenden Rede konnten 200 On- Johannes Kahrs, Dorothee Mar- line-Neueintritte in die SPD verzeichnet tin, Niels Annen, Dr. Matthias werden. Seit der Bekanntgabe der Nomi- Bartke, Metin Hakverdi und den nierung von Martin Schulz haben sich die Kandidatinnen und Kandidaten Neueintritte sogar auf 5000 bundesweit der Landesliste für Hamburg an summiert - allein in Hamburg sind es 375 und freuen uns auf einen enga- neue Genossinnen und Genossen (Stand: gierten Wahlkampf, mit dem 16.2.2017). Ziel alle sechs hamburger Wahl- kreise für die SPD zu gewinnen. Wir freuen uns über jeden, der den Weg zu uns findet und uns in unserem Han- Die SPD-Landesorganisation deln und Wirken unterstützen möchte. stellt neben der Organisation Die vielen Neumitglieder sind eine große der Veranstaltungen mit Olaf Unterstützung für die SPD – nicht nur, SPD Hamburg Foto: Scholz und den jeweiligen Di- aber besonders im Wahlkampfjahr 2017. -

Annual Report 2010 Contents
ANNUAL REPORT 2010 CONTENTS EDITORIAL 2 BUILDING BRIDGES: 20 YEARS OF THE ROSA LUXEMBURG FOUNDATION 4 Award-winning east-west projects 5 Posters from 20 years of the Rosa Luxemburg Foundation 6 KEY ISSUE: AUTOMOBILES, ENERGY AND POLITICS 8 «Power to the People» conference of the Academy of Political Education 9 «Auto.Mobil.Krise.» Conference of the Institute for Social Analysis 10 THE ACADEMY OF POLITICAL EDUCATION 12 PUBLICATIONS OF THE ROSA LUXEMBURG FOUNDATION 16 EDUCATIONAL WORK IN THE FEDERAL STATES 20 CENTRE FOR INTERNATIONAL DIALOGUE AND COOPERATION 32 Interview with the new director of the Centre, Wilfried Telkämper 33 New presences: The Foundations in Belgrade and Quito 34 Africa Conference «Resistance and awakening» 35 Visit by El Salvador’s foreign minister 36 Israel and Palestine: Gender dimensions. Conference in Brussels 36 RELAUNCH OF THE FOUNDATION WEBSITE 40 PROJECT SPONSORSHIP 42 FINANCIAL AND CONCEPTUAL SUPPORT: THE SCHOLARSHIP DEPARTMENT 52 Academic tutors 54 Conferences of the scholarship department 56 RosAlumni – an association for former scholarship recipients 57 Scholarship recipient and rabbi: Alina Treiger 57 ARCHIVE AND LIBRARY 58 Finding aid 58 What is a finding aid? 59 About the Foundation’s library: Interview with Uwe Michel 60 THE CULTURAL FORUM OF THE ROSA LUXEMBURG FOUNDATION 61 PERSONNEL DEVELOPMENT 64 THE FOUNDATION’S BODIES 66 General Assembly 66 Executive Board 68 Scientific Advisory Council 69 Discussion Groups 70 ORGANIGRAM 72 THE FOUNDATION’S BUDGET 74 PUBLISHING DETAILS/PHOTOS 80 1 Editorial Dear readers, new political developments, the movements for democratic change in many Arab countries, or the natural and nuclear disaster in Japan all point to one thing: we must be careful about assumed certainties. -

Brussels, 18 December 2015 Dear High Representative
Brussels, 18 December 2015 Dear High Representative, After 16 years of exile in the Netherlands, Ms. Victoire Ingabire Umuhoza, president of the Unified Democratic Forces FDU-Inkingi, a coalition of Rwandan opposition parties, returned to Rwanda to run for presidential elections scheduled for August 2010. On 14th October she was arrested after weeks of police harassment, intimidation and media lynching, charged with genocide ideology, genocide denial, and conspiracy against the regime. Charges commonly used to silence any opposition in a country where freedom of expression is severely curtailed. After a flawed trial, condemned among others by Amnesty International, Human Rights Watch and the Foundation Jean Jaurès, she was sentenced in first 8 years in prison. On appeal, the sentence was increased to 15 years. Yet, the Supreme Court had invalidated some of the evidences used to convict her in the first place. Having lost all confidence in the justice of her country led by an authoritarian regime, she filed an application with the African Court of Human Rights and Peoples based in Arusha, Tanzania. Nominated for Sakharov Prize in 2012, the fate of this mother, nicknamed by her followers as the Rwandan Aung San Suu Kyi, should challenge us. Pursuant to the resolution of our Parliament 2013/2641 (RSP) of 25 may 2013, we ask the European Commission to officially request the immediate release of Madam Ingabire. In the meantime, we urge the Commission to take action to improve her prison conditions by ensuring, among others, a free and easy access to legal counsel and her recognition as a political prisoner. -

Download Download
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE STUDIA TERRITORIALIA VI – 2004 ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE STUDIA TERRITORIALIA VI – 2004 SBORNÍK PRACÍ KATEDRY NĚMECKÝCH A RAKOUSKÝCH STUDIÍ IMS FSV UK UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM 2005 Vědecký redaktor: prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. Recenzovali: PhDr. Miroslav Kunštát doc. PhDr. Petr Svobodný © Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha 2005 ISBN 80-246-0990-8 ISSN 1213-4449 Obsah Editorial JIŘÍ PEŠEK ...................................................................... 7 Der lange Weg zum Dialog. Ein Jahrhundert deutsche Auswärtige Kulturpolitik (1912–2001) PAVLÍNA RICHTEROVÁ ........................................................ 13 Vývoj československo-západoněmeckých vztahů v letech 1949–1961: národní zájmy versus socialistický internacionalismus MAGDA GREGEROVÁ .......................................................... 105 Vergleich der politischen Diskussionen über den Paragraphen 218 in den 1970er und 1990er Jahren vor dem Hintergrund der Aktionen der Frauenbewegung JOHANA JONÁKOVÁ ........................................................... 153 Zuwanderungspolitische Diskussion der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien. Hintergrund und Lage der Debatte – 14. Legislaturperiode (1998–2002) EVA HORELOVÁ................................................................. 237 Rekonstrukce Evropy a severní Ameriky po druhé světové válce (1944–1949) z pohledu současné historiografie MARIE MRÁZKOVÁ – LUCIE PÁNKOVÁ .................................... 309 5 Editorial -

Profile Persönlichkeiten Der Universität Hamburg Profile Persönlichkeiten Der Universität Hamburg Inhalt
FALZ FÜR EINKLAPPER U4 RÜCKENFALZ FALZ FÜR EINKLAPPER U1 4,5 mm Profile persönlichkeiten der universität hamburg Profile persönlichkeiten der universität hamburg inhalt 6 Grußwort des Präsidenten 8 Profil der Universität Portraits 10 von Beust, Ole 12 Breloer, Heinrich 14 Dahrendorf, Ralf Gustav 16 Harms, Monika 18 Henkel, Hans-Olaf 20 Klose, Hans-Ulrich 22 Lenz, Siegfried 10 12 14 16 18 20 22 24 Miosga, Caren 26 von Randow, Gero 28 Rühe, Volker 30 Runde, Ortwin 32 Sager, Krista 34 Schäuble, Wolfgang 24 26 28 30 32 34 36 36 Schiller, Karl 38 Schmidt, Helmut 40 Scholz, Olaf 42 Schröder, Thorsten 44 Schulz, Peter 46 Tawada, Yoko 38 40 42 44 46 48 50 48 Voscherau, Henning 50 von Weizsäcker, Carl Friedrich 52 Impressum grusswort des präsidenten Grußwort des Präsidenten der Universität Hamburg Dieses Buch ist ein Geschenk – sowohl für seine Empfänger als auch für die Universität Hamburg. Die Persönlichkeiten in diesem Buch machen sich selbst zum Geschenk, denn sie sind der Universität auf verschiedene Weise verbunden – als Absolventinnen und Absolventen, als ehemalige Rektoren, als prägende Lehrkräfte oder als Ehrendoktoren und -senatoren. Sie sind über ihre unmittelbare berufliche Umgebung hinaus bekannt, weil sie eine öffentliche Funktion wahrnehmen oder wahrgenommen haben. Die Universität Hamburg ist fern davon, sich selbst als Causa des beruflichen Erfolgs ihrer prominenten Alumni zu betrach- ten. Dennoch hat die Universität mit ihnen zu tun. Sie ist der Ort gewesen, in dem diese Frauen und Männer einen Teil ihrer Sozialisation erfahren haben. Im glücklicheren Fall war das Studium ein Teil der Grundlage ihres Erfolges, weil es Wissen, Kompetenz und Persönlichkeitsbildung ermöglichte. -

Plenarprotokoll 15/102
Plenarprotokoll 15/102 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 102. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 1. April 2004 Inhalt: Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Edelgard Bulmahn, Bundesministerin nung . 9147 A BMBF . 9160 A Absetzung der Tagesordnungspunkte 17, 20, Katherina Reiche CDU/CSU . 9160 C 23 h und 23 i . 9148 B Jörg Tauss SPD . 9163 A Nachträgliche Ausschussüberweisungen . 9148 B Katherina Reiche CDU/CSU . 9163 C Grietje Bettin BÜNDNIS 90/ Tagesordnungspunkt 3: DIE GRÜNEN . 9163 C a) Erste Beratung des von den Fraktionen Cornelia Pieper FDP . 9164 A der SPD und des BÜNDNISSES 90/ Christoph Hartmann (Homburg) FDP . 9165 A DIE GRÜNEN eingebrachten Ent- wurfs eines Gesetzes zur Sicherung Petra Pau fraktionslos . 9165 D und Förderung des Fachkräftenach- Dr. Ernst Dieter Rossmann SPD . 9166 D wuchses und der Berufsausbil- dungschancen der jungen Genera- Dagmar Wöhrl CDU/CSU . 9168 A tion (Berufsausbildungssicherungs- gesetz – BerASichG) Swen Schulz (Spandau) SPD . 9170 C (Drucksache 15/2820) . 9148 C b) Antrag der Abgeordneten Cornelia Pieper, Christoph Hartmann (Hom- Tagesordnungspunkt 4: burg), weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP: Ausbildungsplatz- Antrag der Abgeordneten Karl-Josef abgabe verhindern – Wirtschaft Laumann, Dagmar Wöhrl, weiterer Abge- nicht weiter belasten – Berufsausbil- ordneter und der Fraktion der CDU/CSU: dung stärken Weichen stellen für eine bessere Be- (Drucksache 15/2833) . 9148 D schäftigungspolitik – Wachstumspro- gramm für Deutschland Jörg Tauss SPD . 9149 A (Drucksache 15/2670) . 9172 A Friedrich Merz CDU/CSU . 9151 B Karl-Josef Laumann CDU/CSU . 9172 B Dr. Thea Dückert BÜNDNIS 90/ Klaus Brandner SPD . 9175 C DIE GRÜNEN . 9154 A Dirk Niebel FDP . 9176 A Cornelia Pieper FDP . 9155 B Karl-Josef Laumann CDU/CSU . -

Download File
EUROPEAN UNITED LEFT • NORDIC GREEN LEFT STRASBOURGSTRASBOURG FOCUSFOCUS PLENARY SESSION PRIORITIES 7-10 September 2015 THE STATE OF THE UNION Gabi Zimmer, GUE/NGL President, Germany The governing elites have brought the EU to the brink of disintegration. The unsolved errors of the euro further increase the imbalances between North and South, rich and poor. The euro crisis is being misused for a neoliberal dismantling of European welfare states in order to generate higher profits for banks and corporations and is not providing the right answers for growing levels of unemployment, particularly youth unemployment. For the same reason, social and workers’ rights are being attacked under the guise of “better regulation” while the issue of tax evasion is not being dealt with at all. The Commission, ECB and IMF are forcing Greece into a vicious circle of recession and poverty. In this way, they have damaged both Greek and European democracy. Increasing refugee flows are totally overwhelming the EU which is reacting using deadly isolationist policies resulting in increasing nationalism. The fact that extreme right-wing parties are gaining strength is a dangerous sign of disintegrating solidarity. MIGRATION Cornelia Ernst, Germany The continuous arrival of asylum-seekers and migrants in the EU and the appalling inability of member state governments to address the situation is often likened to a natural disaster or a tragedy that is striking us. This could hardly be farther from the truth. People are fleeing from poverty and wars that more often than not result from policies of the EU and its member states. Reducing the number of asylum-seekers therefore means putting an end to economic policies that impoverish the South and stopping support for dictatorships and injustice. -

Organizational Change in Office-Seeking Anti-Political
Adapt, or Die! Organizational Change in Office-Seeking Anti- Political Establishment Parties Paper for Presentation at the Annual General Meeting of the Canadian Political Science Association in Winnipeg, Manitoba, June 3-5, 2004. Amir Abedi, Ph.D. Dr. Steffen Schneider Department of Political Science Collaborative Research Center 597 – Western Washington University Transformations of the State 516 High Street, MS-9082 University of Bremen Bellingham, WA 98225-9082 P.B. 33 04 40 USA 28334 Bremen Germany Tel.: +1-360-650 4143 +49-421-218 8715 Fax: +1-360-650-2800 +49-421-218 8721 [email protected] [email protected] Draft version – not to be quoted – comments welcome I Introduction Over the last few years, the entry of radical right-wing parties into national governments in Austria, Italy and the Netherlands has made headlines around the world and sparked debates on the impact that the government participation of these formations might have on policy- making, political cultures and system stability in the affected countries (Hainsworth, 2000; Holsteyn and Irwin, 2003; Kitschelt, 1995; Luther, 2003; Minkenberg, 2001). There has been much less discussion about the effects of government participation on radical right-wing parties themselves. After all, they tend to portray themselves as challengers of the political establishment up to the moment of joining coalitions with their mainstream competitors. In this, they are comparable to new politics, left-libertarian or green parties, which began their life as challengers of the establishment as well but have joined national governments in Belgium, Finland, France, Germany and Italy over the last decade (Müller-Rommel, 1998; Taggart, 1994). -
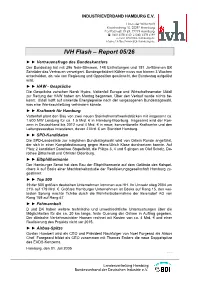
IVH Flash – Report 05/26
INDUSTRIEVERBAND HAMBURG E.V. Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10, 22297 Hamburg Postfach 60 19 69, 22219 Hamburg 040/ 6378-4120 040/ 6378-4199 e-mail: [email protected] Internet: http://www.BDI-Hamburg.de IVH Flash – Report 05/26 ► ► Vertrauensfrage des Bundeskanzlers Der Bundestag hat mit 296 Nein-Stimmen, 148 Enthaltungen und 151 Ja-Stimmen BK Schröder das Vertrauen verweigert. Bundespräsident Köhler muss nun binnen 3 Wochen entscheiden, ob, wie von Regierung und Opposition gewünscht, der Bundestag aufgelöst wird. ► ► HAW - Gespräche Die Gespräche zwischen Norsk Hydro, Vattenfall Europe und Wirtschaftssenator Uldall zur Rettung der HAW haben am Montag begonnen. Über den Verlauf wurde nichts be- kannt. Uldall hofft auf sinkende Energiepreise nach der vorgezogenen Bundestagswahl, was eine Werksschließung verhindern könnte. ► ► Kraftwerk für Hamburg Vattenfall plant den Bau von zwei neuen Steinkohlekraftwerksblöcken mit insgesamt ca. 1.600 MW Leistung für ca. 1.5 Mrd. € in Hamburg-Moorburg. Insgesamt wird der Kon- zern in Deutschland bis 2012 rund 4 Mrd. € in neue, konventionelle Kraftwerke und den Leitungssausbau investieren, davon 2 Mrd. € am Standort Hamburg. ► ► SPD-Kandidaten Die SPD-Landesliste zur möglichen Bundestagswahl wird von Ortwin Runde angeführt, der sich in einer Kampfabstimmung gegen Hans-Ulrich Klose durchsetzen konnte. Auf Platz 2 kandidiert Dorothee Stapelfeldt, die Plätze 3, 4 und 5 gingen an Olaf Scholz, Do- rothee Bittscheidt und Christel Oldenburg. ► ► Elbphilharmonie Der Hamburger Senat hat dem Bau der Elbphilharmonie auf dem Gelände des Kaispei- chers A auf Basis einer Machbarkeitsstudie der Realisierungsgesellschaft Hamburg zu- gestimmt. ► ► Top 500 39 der 500 größten deutschen Unternehmen kommen aus HH. Ihr Umsatz stieg 2004 um 21% auf 179 Mrd. -

JAHRESBERICHT 2016 EUROPÄISCHES JUGENDPARLAMENT in DEUTSCHLAND E.V
JAHRESBERICHT 2016 EUROPÄISCHES JUGENDPARLAMENT IN DEUTSCHLAND e.V. Impressum Jahresbericht 2016 des Europäischen Jugendparlaments in Deutschland e.V. © Europäisches Jugendparlament in Deutschland e.V. (EJP) European Youth Parliament Germany V.i.S.d.P.: David Plahl, Janis Fifka Layout: Kira Lange Abbildungen: Eigentum des EJP, wenn nicht anders genannt. Sophienstraße 28-29, 10178 Berlin E-Mail: [email protected] Internet: www.eyp.de Telefon: +49 (0) 30 280 95 - 155 Fax: +49 (0) 30 280 95 - 150 Gestaltungsvorlage: European Youth Parliament c/o Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa Jonas Pruditsch David Plahl Vorstandsvorsitzender Sehr geehrte Damen und Herren, Liebe Freundinnen und Freunde des Europäischen Jugendparlaments, mit dem vergangenen Jahr 2016 liegt wohl eines der politisch erschütterndsten Jahre in Europa und welt- weit hinter uns. Gerade die Europäische Union erlebte in den vergangenen Monaten sehr bewegte Zeiten. Anhaltende Konflikte und soziale Ungleichgewichte drängten weiterhin viele Millionen von Menschen dazu, zu fliehen. Die Auswirkungen beschäftigten unser Europa im Jahr 2016 so sehr wie fast kein anderes Thema. Das Votum der Bürgerinnen und Bürger des Vereinigten Königreichs, die Europäische Union zu verlassen, hat den gesamten Kontinent erschüttert. Der Aufstieg populistischer und euroskeptischer Kräfte in vielen Ländern stellt die etablierten Parteien und auch die Europäische Union mit ihren Institutionen vor neue Herausforderungen. All diese Krisen erfordern eine starke Zivilgesellschaft, die sich der Bewältigung dieser aktiv annimmt. Es gilt Antworten zu finden und die Menschen wieder davon zu überzeugen, dass in vielen Bereichen eine europäische Lösung für alle Beteiligten vorteilhaft ist. Gerade für diese Diskussionen über aktuelle Fragen der Europapolitik bietet das Europäischen Jugendpar- lament Jugendlichen einen Rahmen.