Download Download
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
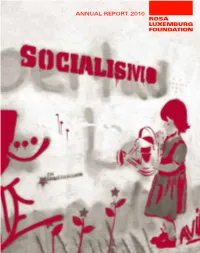
Annual Report 2010 Contents
ANNUAL REPORT 2010 CONTENTS EDITORIAL 2 BUILDING BRIDGES: 20 YEARS OF THE ROSA LUXEMBURG FOUNDATION 4 Award-winning east-west projects 5 Posters from 20 years of the Rosa Luxemburg Foundation 6 KEY ISSUE: AUTOMOBILES, ENERGY AND POLITICS 8 «Power to the People» conference of the Academy of Political Education 9 «Auto.Mobil.Krise.» Conference of the Institute for Social Analysis 10 THE ACADEMY OF POLITICAL EDUCATION 12 PUBLICATIONS OF THE ROSA LUXEMBURG FOUNDATION 16 EDUCATIONAL WORK IN THE FEDERAL STATES 20 CENTRE FOR INTERNATIONAL DIALOGUE AND COOPERATION 32 Interview with the new director of the Centre, Wilfried Telkämper 33 New presences: The Foundations in Belgrade and Quito 34 Africa Conference «Resistance and awakening» 35 Visit by El Salvador’s foreign minister 36 Israel and Palestine: Gender dimensions. Conference in Brussels 36 RELAUNCH OF THE FOUNDATION WEBSITE 40 PROJECT SPONSORSHIP 42 FINANCIAL AND CONCEPTUAL SUPPORT: THE SCHOLARSHIP DEPARTMENT 52 Academic tutors 54 Conferences of the scholarship department 56 RosAlumni – an association for former scholarship recipients 57 Scholarship recipient and rabbi: Alina Treiger 57 ARCHIVE AND LIBRARY 58 Finding aid 58 What is a finding aid? 59 About the Foundation’s library: Interview with Uwe Michel 60 THE CULTURAL FORUM OF THE ROSA LUXEMBURG FOUNDATION 61 PERSONNEL DEVELOPMENT 64 THE FOUNDATION’S BODIES 66 General Assembly 66 Executive Board 68 Scientific Advisory Council 69 Discussion Groups 70 ORGANIGRAM 72 THE FOUNDATION’S BUDGET 74 PUBLISHING DETAILS/PHOTOS 80 1 Editorial Dear readers, new political developments, the movements for democratic change in many Arab countries, or the natural and nuclear disaster in Japan all point to one thing: we must be careful about assumed certainties. -

Brussels, 18 December 2015 Dear High Representative
Brussels, 18 December 2015 Dear High Representative, After 16 years of exile in the Netherlands, Ms. Victoire Ingabire Umuhoza, president of the Unified Democratic Forces FDU-Inkingi, a coalition of Rwandan opposition parties, returned to Rwanda to run for presidential elections scheduled for August 2010. On 14th October she was arrested after weeks of police harassment, intimidation and media lynching, charged with genocide ideology, genocide denial, and conspiracy against the regime. Charges commonly used to silence any opposition in a country where freedom of expression is severely curtailed. After a flawed trial, condemned among others by Amnesty International, Human Rights Watch and the Foundation Jean Jaurès, she was sentenced in first 8 years in prison. On appeal, the sentence was increased to 15 years. Yet, the Supreme Court had invalidated some of the evidences used to convict her in the first place. Having lost all confidence in the justice of her country led by an authoritarian regime, she filed an application with the African Court of Human Rights and Peoples based in Arusha, Tanzania. Nominated for Sakharov Prize in 2012, the fate of this mother, nicknamed by her followers as the Rwandan Aung San Suu Kyi, should challenge us. Pursuant to the resolution of our Parliament 2013/2641 (RSP) of 25 may 2013, we ask the European Commission to officially request the immediate release of Madam Ingabire. In the meantime, we urge the Commission to take action to improve her prison conditions by ensuring, among others, a free and easy access to legal counsel and her recognition as a political prisoner. -

Download File
EUROPEAN UNITED LEFT • NORDIC GREEN LEFT STRASBOURGSTRASBOURG FOCUSFOCUS PLENARY SESSION PRIORITIES 7-10 September 2015 THE STATE OF THE UNION Gabi Zimmer, GUE/NGL President, Germany The governing elites have brought the EU to the brink of disintegration. The unsolved errors of the euro further increase the imbalances between North and South, rich and poor. The euro crisis is being misused for a neoliberal dismantling of European welfare states in order to generate higher profits for banks and corporations and is not providing the right answers for growing levels of unemployment, particularly youth unemployment. For the same reason, social and workers’ rights are being attacked under the guise of “better regulation” while the issue of tax evasion is not being dealt with at all. The Commission, ECB and IMF are forcing Greece into a vicious circle of recession and poverty. In this way, they have damaged both Greek and European democracy. Increasing refugee flows are totally overwhelming the EU which is reacting using deadly isolationist policies resulting in increasing nationalism. The fact that extreme right-wing parties are gaining strength is a dangerous sign of disintegrating solidarity. MIGRATION Cornelia Ernst, Germany The continuous arrival of asylum-seekers and migrants in the EU and the appalling inability of member state governments to address the situation is often likened to a natural disaster or a tragedy that is striking us. This could hardly be farther from the truth. People are fleeing from poverty and wars that more often than not result from policies of the EU and its member states. Reducing the number of asylum-seekers therefore means putting an end to economic policies that impoverish the South and stopping support for dictatorships and injustice. -

Solidarität Statt Konkurrenz Helmut Scholz Sabine Wils Die Industriepolitik Der Europäischen Union
DIE LINKE. im Europaparlament www.dielinke-europa.eu Gabi Zimmer Cornelia Ernst Thomas Händel Vorsitzende der Sprecherin der Delegation Sprecher der Delegation der GUE/NGL Fraktion der LINKEN der LINKEN Jürgen Klute Sabine Lösing Martina Michels Titelbild: MEV-Verlag, Germany MEV-Verlag, Titelbild: Solidarität statt Konkurrenz Helmut Scholz Sabine Wils Die Industriepolitik der Europäischen Union Rue Wiertz 47| B-1047 Brüssel | Belgien V.i.S.d.P. Thomas Händel, Cornelia Ernst Wir erleben derzeit eine beschleunigte und immer autori- Entwicklung lediglich auf den alten Gleisen kapitalistischer tärere Krisenbewältigungsstrategie, die mit Kürzung der Profitmaximierung. Die Interessen der Betroffenen, der Arbeits- und Sozialeinkommen, Spardiktaten und dem Kommunen und Regionen, der Beschäftigten und Verbrau- verordneten Ausverkauf öffentlichen Eigentums gerade- cher stünden weiter hintenan. Deshalb muss die Gesell- wegs in die wirtschaftliche Rezession führt. Die Länder schaft auf allen Ebenen beteiligt werden. Instrumente wie der Europäischen Union drohen in wirtschaftlicher De- Rekommunalisierung, Gründung von Genossenschaften pression und sozialer Ungleichheit zu versinken. Allein in oder die Bildung von Energiebeiräten müssen in ein Zu- den Ländern der Eurozone hatten im November 2013 rund kunftsprogramm für Europa einfließen. 19,24 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter keine Arbeit. Mehr als ein Viertel – rund 125 Millionen – lebt in Zweifellos: akut kommt es darauf an, die richtigen Maßnah- Armut oder ist armutsgefährdet. Die Jugendarbeitslosigkeit men zur Re-Regulierung der Finanzmärkte und der Stabili- erreicht im Durchschnitt in der EU fast 24 Prozent – in sierung der Realwirtschaft rasch umzusetzen. Griechenland und Spanien sind gar mehr als die Hälfte aller jungen Menschen ohne Job. Armut ist längst in der Mitte der Gesellschaft angelangt. -

Strasbourg Strasbourg
EUROPEAN UNITED LEFT • NORDIC GREEN LEFT STRASBOURG FOCUS PLENARY SESSION PRIORITIES 13 - 16 November 2017 Gabi Zimmer - Winter conditions for asylum seekers The situation of asylum seekers and the full respect for their rights is a common European task, every member state has responsibilities. Winter is approaching in Europe and we all have to make sure that we do not see the same tragedies as last year. No lives should be lost again! Member states should finally show the long-needed solidarity and must return to European policies that respect human rights and international law. We can no longer have people trapped in camps and hotspots waiting for the EU to act according to its obligations. Relocation should speed up and a new, fair, and sustainable Dublin system should be adopted and implemented. All member states have to take all appropriate action in order to guarantee dignified condition for all refugees. Debate Wednesday Helmut Scholz - Protection against dumped and subsidised imports from non-EU countries For the first time, social and environmental dumping could be included in the Parliament’s legislation for trade defence instruments (TDIs). GUE/NGL has long been calling for this so it’s a welcome breakthrough. But the devil’s in the detail and the draft report remains inaccessible to the general public. I can tell you there’s never been more neoliberal puritanism through the listing of all the policy decisions in China that are hindering free market principles. We cannot allow this to become the benchmark - and my group will not support this. Debate Tuesday Matt Carthy - Rule of Law in Malta The Parliament will strongly condemn the assassination of the Maltese investigative journalist Daphne Caruana Galizia in a resolution on the rule of law in Malta. -

Protestparteien in Regierungsverantwortung
Universität Potsdam Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät Sommersemester 2006 Protestparteien in Regierungsverantwortung Die Grünen, die Alternative Liste, die STATT Partei und die Schill- Partei in ihrer ersten Legislaturperiode als kleine Koalitionspartner Dissertation Termin der Disputation: 14.06.2007 Betreuer/1.Gutachter: Prof. Dr. Jürgen Dittberner Zweitgutachter: Prof. Dr. Klaus Götz vorgelegt von: Adriana Wipperling Matrikelnummer: 129777 1 Impressum: Verantwortlich für den Inhalt: Adriana Wipperling Anschrift: Rosenweg 12 14772 Brandenburg Telefon: (03381) 70 71 91 Email: [email protected] Betreuende Einrichtung: Universität Potsdam Am Neuen Palais 10 14469 Potsdam Online veröffentlicht auf dem Publikationsserver der Universität Potsdam: http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2008/2703/ urn:nbn:de:kobv:517-opus-27030 [http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-27030] 2 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 6 1. 1. Problemstellung 6 1. 2. Stand der Forschung 7 1. 3. Aufbau und Methodik 10 2. Was ist eine Protestpartei? 12 2. 1. Definition des Begriffs „Politische Partei“ 12 2. 2. Protestparteien und soziale Bewegungen 15 2. 3. Protestparteien und Protestwähler 18 2. 4. Protest- vs. Milieupartei? 22 2. 4. 1. Die Entstehung sozialer Milieus 22 2. 4. 2. Grüne und PDS: Stamm- und Protestwähler 24 2. 4. 3. Die PDS zwischen Protest-, Milieu- und Regierungspartei 26 2. 4. 4. Die Grünen: Prototyp einer Bewegungspartei 30 2. 5. Das Basiskonsens-Konzept von Stöss 35 2. 6. Merkmale von Protestparteien 38 3. Regieren in Koalitionen 40 3. 1. Koalitionsbegriff und Koalitionstypen 41 3. 2. Großparteien und Kleinparteien 43 3. 3. Koalitionstheorie und Koalitionsmodelle 46 3. 3. 1. Das „Office-Seeking“-Theorem 46 3. 3. -
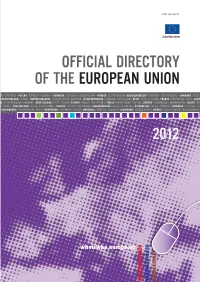
Official Directory of the European Union
ISSN 1831-6271 Regularly updated electronic version FY-WW-12-001-EN-C in 23 languages whoiswho.europa.eu EUROPEAN UNION EUROPEAN UNION Online services offered by the Publications Office eur-lex.europa.eu • EU law bookshop.europa.eu • EU publications OFFICIAL DIRECTORY ted.europa.eu • Public procurement 2012 cordis.europa.eu • Research and development EN OF THE EUROPEAN UNION BELGIQUE/BELGIË • БЪЛГАРИЯ • ČESKÁ REPUBLIKA • DANMARK • DEUTSCHLAND • EESTI • ΕΛΛΑΔΑ • ESPAÑA • FRANCE • ÉIRE/IRELAND • ITALIA • ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS • LATVIJA • LIETUVA • LUXEMBOURG • MAGYARORSZÁG • MALTA • NEDERLAND • ÖSTERREICH • POLSKA • PORTUGAL • ROMÂNIA • SLOVENIJA • SLOVENSKO • SUOMI/FINLAND • SVERIGE • UNITED KINGDOM • BELGIQUE/BELGIË • БЪЛГАРИЯ • ČESKÁ REPUBLIKA • DANMARK • DEUTSCHLAND • EESTI • ΕΛΛΑ∆Α • ESPAÑA • FRANCE • ÉIRE/IRELAND • ITALIA • ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS • LATVIJA • LIETUVA • LUXEMBOURG • MAGYARORSZÁG • MALTA • NEDERLAND • ÖSTERREICH • POLSKA • PORTUGAL • ROMÂNIA • SLOVENIJA • SLOVENSKO • SUOMI/FINLAND • SVERIGE • UNITED KINGDOM • BELGIQUE/BELGIË • БЪЛГАРИЯ • ČESKÁ REPUBLIKA • DANMARK • DEUTSCHLAND • EESTI • ΕΛΛΑΔΑ • ESPAÑA • FRANCE • ÉIRE/IRELAND • ITALIA • ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS • LATVIJA • LIETUVA • LUXEMBOURG • MAGYARORSZÁG • MALTA • NEDERLAND • ÖSTERREICH • POLSKA • PORTUGAL • ROMÂNIA • SLOVENIJA • SLOVENSKO • SUOMI/FINLAND • SVERIGE • UNITED KINGDOM • BELGIQUE/BELGIË • БЪЛГАРИЯ • ČESKÁ REPUBLIKA • DANMARK • DEUTSCHLAND • EESTI • ΕΛΛΑΔΑ • ESPAÑA • FRANCE • ÉIRE/IRELAND • ITALIA • ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS • LATVIJA • LIETUVA • LUXEMBOURG • MAGYARORSZÁG • MALTA • NEDERLAND -

Europas Neue Unordnung Eurokrise, Schuldenkrise – Droht Jetzt Die Politische Krise?
Einladung | Invitation 7. Mai 2015 | May 7, 2015 Europas neue Unordnung Eurokrise, Schuldenkrise – droht jetzt die politische Krise? Europe’s new Disorder Euro Crisis, Debt Crisis – now the political Crisis? europa forum European Parliament Brussels unter der Schirmherrschaft des Europäischen Parlaments Einladung Europas neue Unordnung Eurokrise, Schuldenkrise – droht jetzt die politische Krise? Sehr geehrte Damen und Herren, Zukunft Europas mit entscheiden. Die EU steht vor einem Superwahl- jahr. In zehn von 28 Mitgliedsstaaten wird 2015 ein neues Parlament das 18. Internationale wdr Europaforum greift Themen der euro- gewählt. Der proeuropäische Konsens in der Politik steht vor einer päischen Zukunftsdebatte auf und bietet am 7. Mai 2015 einen erneuten Bewährungsprobe. Gedankenaustausch mit hochrangigen Politikerinnen und Politikern aus ganz Europa. Die wirtschaftliche Entwicklung in Europa wird durch die militärischen Konflikte in der Ukraine und anderen Teilen der Welt belastet. Die Europa ist an einem kritischen Punkt. Die Situation in der Europä- europäische Sicherheitsarchitektur ist beschädigt. Seit Monaten ster- ischen Union hat sich verschärft. Sie ist bedroht durch wirtschaftliche, ben Menschen in der Ukraine. Offiziell gibt es einen Waffenstillstand. soziale und politische Risiken. Über die richtige Wirtschafts politik Aber der wird immer wieder gebrochen. zwischen Spar- und Investitionsprogrammen wird kontrovers debat- tiert. Mehr Investitionen sollen Europa aus der Krise führen. Viele Neue Krisen und Konflikte brechen aus. Hunderttausende fliehen vor Europapolitiker lehnen schuldenfinanzierte Investitionsprogramme Bürgerkrieg und Terror. Flüchtlinge drängen an Europas Außengrenzen ab, sind aber zu mehr Flexibilität bereit, solange die Regeln des und stellen die Gemeinschaft vor weitere Herausforderungen. Mehr Stabilitäts- und Wachstumspaktes gewahrt bleiben. denn je ist ein handlungsfähiges und aktives Europa gefordert. -

Download File
EUROPEAN UNITED LEFT • NORDIC GREEN LEFT STRASBOURG FOCUS PLENARY SESSION PRIORITIES 1-4 February 2016 February Council - Brexit & Refugees Gabi Zimmer, GUE/NGL President, Germany Concerning the UK’s plan for an in/out referendum, we defend the right of the British people to decide if they want to be member of the EU or not. But we oppose Prime Minister Cameron’s attempt to use this as leverage to weaken social standards in free movement and to make migrants the scapegoats for his disastrous austerity policies. On refugee policy, the EU heads of state and government must make the long overdue shift to a common humanitarian reception policy with safe routes for refugees. Blaming Greece and the threat to exclude it from Schengen is just another shabby political move to distract from the EU’s failure. Trade in Services Agreement (TiSA) Stelios Kouloglou - Greece The TiSA Agreement currently negotiated outside the WTO structures by 52 WTO Members, including the EU on behalf of the 28 EU member states, is aiming to further liberalise services beyond GATS rules. The European Parliament will adopt its recommendations for the EU Commission to negotiate within the plurilateral TiSA negotiations, which the GUE/NGL opposes. According to the current mandate, TiSA will boost the liberalisa- tion of services; open an opportunity to undermine the right of states to regulate; limit equal chances for mutual market access of SMEs under local and regional authorities; and call into question the quality of jobs. Our demands include: to limit the scope of TiSA; the exclusion of any standstill and ratchet clauses; social rights for development; protection of the environment; data protection and right to privacy; and an equal multilateral negotiated status for all WTO Member States with their legitimate interests to be included and guaranteed. -

Strasbourg Focus
STRASBOURG FOCUS 11-14 March 2019 PLENARY SESSION PRIORITIES More Info: David Lundy +32 485 505 812, Ben Leung +32 470 880 965, Nikki Sullings +32 483 035 575 or Ziyad Lunat +32 499 632 314 www.guengl.eu PRESS BRIEFING GUE/NGL PRESS BRIEFING Tuesday 12 March Journalists are welcome to question our MEPs on issues they are covering. @ 11.30 Interpretation: EN, FR, DE, ES, IT & PL EP Press Room LOW N-1/201 Gabi Zimmer - European Council Meeting and Brexit Lynn Boylan - Climate Change debate Helmut Scholz - Restarting EU-US trade negotiations Gabi Zimmer - European Council Meeting and Brexit Debate: Wednesday EU citizens should be free to decide on their economies, their investments and their political goals. But the European Semester does the exact opposite: a failed, authoritarian policy directed from the top. Member states are forced to implement austerity that have ushered in poverty, unemployment or precarious jobs upon citizens - especially in southern Europe. It prevents any improvement in social protection like investing in decent jobs. The European Parliament wasn’t even consulted - the EU Council did it all. We therefore call for a radical change in EU´s economic policy and the end of the European Semester. On climate change, the Commission calls for zero emissions of CO2 by 2050. EU governments should follow this ambitious goal. However, the transition to an environmentally-friendly economy must be socially fair in order to create sustainable change. We, along with the Greens and S&D, have invited young climate activists to the plenary in order to listen to their proposals on how to speed up the fight against global warming. -

Deutschland Im Ministerrat
Forschungspapier Lisa Brose Deutschland im Ministerrat Bestimmen deutsche Interessen die Europapolitik? 01. November 2016 Redaktionsleitung / Wissenschaftliche Koordination Dr. Kristina Weissenbach Tel. +49 (0) 203 / 379 – 3742 Fax. +49 (0) 203 / 379 - 3179 Sekretariat Anita Weber Tel. +49 (0) 203 / 379 - 2045 Fax +49 (0) 203 / 379 - 3179 [email protected] Herausgeber (V.i.S.d.P.) Univ. Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte Redaktionsanschrift Redaktion Regierungsforschung.de NRW School of Governance Institut für Politikwissenschaft Lotharstraße 53 47057 Duisburg [email protected] Zitationshinweis Brose, Lisa (2016): Deutschland im Ministerrat – Bestimmen deutsche Interessen die Europapolitik? Forschungs- papiere, Erschienen auf: regierungsforschung.de Deutschland im Ministerrat Bestimmen deutsche Interessen die Europapolitik? Von Lisa Brose1 Gabi Zimmer ist es. Manfred Weber ist es. Rebecca Harms und Martin Schulz sind es ebenfalls. Die meisten würden vermutlich auch ohne europapolitisches Wissen hier richtig raten: Die genannten Personen sind Deutsche. Und sie haben EU Spitzenpositionen inne. Allen voran Martin Schulz als Präsident des Europäischen Parlaments. Eingliedern in die Reihe erfolgreicher Deutschen kann sich auch Kanzlerin Angela Merkel, die sich derzeit kaum von einer hauptberuflichen Europapoli- tikerin unterscheiden lässt. An dieser Stelle drängt sich die Frage auf, ob diese scheinbare Macht- stellung deutscher Politikervertreter in Europa tatsächlich auf messbarem politischen Erfolg ba- siert. Die Fakten zeigen deutlich, dass Deutschland im Rat der EU in den analysierten Politikfel- dern Beschäftigungs- & Sozialpolitik, Wirtschaft & Finanzen sowie Justiz & Inneres überdurch- schnittlich oft von der Mehrheit überstimmt wird. Deutsche Führung in Europa Merkel, Schulz und Co. beherrschen die aktuelle mediale Aufmerksamkeit. Die Symbiose-artige Beziehung der deutschen Kanzlerin und des europäischen Gemeinschaftsverbundes verdeutlicht Der Spiegel schon im vergangenen Jahr mit seiner Titelgeschichte „Die Trümmerfrau. -

Mbrie Left Politics in Germany
Michael Brie Sailing against the wind Alliances for left politics “To be dialectic means to have the wind of history in one’s sails. The sails are the notions. However, it is not suffi- cient to have the sails. The art to set them that is the decisive thing.” Walter Benjamin 1 I. Alternative majorities are possible There are five factors which in their sum can generate sudden political changes – economic collapses, diminishing trust in social institutions, the solidarity of various social groups against the rulers, an ideology that effectively challenges the rulers, and finally, the division among the ruling classes themselves. 2 Due to the crisis of neoliberalism, a number of condi- tions for such a political change have emerged in Germany. There is deep pessimism con- cerning their personal prospects among large parts of the populations, a strong alienation toward the institutions of the Federal Republic seen mainly as instruments of power of the privileged classes. In the end of the year 2006, two thirds of the population had the opinion that things turned unjust in the Federal Republic; a third saw themselves on the losers’ side. For the first time, more citizens were dissatisfied with the functioning of democracy in Germany than were sat- isfied. 3 The economic recovery reached mainly the well-off. Almost everybody feels directly or indirectly threatened by the common insecurity. The ideology of neoliberalism has gotten into disrepute, even among the rulers. A turn of policy becomes possible. However, the con- ditions necessary for that yet have to be created. The Hartz reforms 4 were what brought the break.