Böll Stiftung: Jahresbericht 2013
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
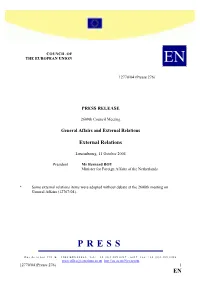
Council of the EU Press Release on Libya Embargo
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION EN 12770/04 (Presse 276) PRESS RELEASE 2609th Council Meeting General Affairs and External Relations External Relations Luxembourg, 11 October 2004 President Mr Bernard BOT Minister for Foreign Affairs of the Netherlands * Some external relations items were adopted without debate at the 2608th meeting on General Affairs (12767/04). P R E S S Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUSSELS Tel.: +32 (0) 2 285 8239 / 6319 Fax: +32 (0)2 285 8026 [email protected] http://ue.eu.int/Newsroom 12770/04 (Presse 276) 1 EN 11.X.2004 Main Results of the Council As part of a policy of engagement vis-à-vis Libya , the Council decided inter alia to lift the arms embargo against that country as well as to repeal a set of economic sanctions adopted by the EU in application of UNSC resolutions. The Council invited Libya to respond positively to this policy, notably with a view to the resolution of remaining EU concerns, in particular the case of the Bulgarian and Palestinian medical workers and other outstanding issues. The Council, addressing the situation in the Middle East , - condemned in the strongest terms the terrorist attacks perpetrated in the Sinai against innocent Egyptian and Israeli citizens; - expressed grave concern at the unprecedented cycle of retaliatory violence in Israel and the Occupied Territories, called on both parties to take steps to fulfil their Roadmap obligations and commitments and welcomed the proposals made by the EU Special Representative for an EU coordinating mechanism for donor assistance to the Palestinian Civil Police. -

Flyer: Anne-Klein-Frauenpreis
Vergabekriterien Informationen Vorschlagsberechtigt sind Personen und Initiativen. Eigenbe- werbungen sind nicht möglich. Mitglieder der Jury können nicht Wenn Sie das Anliegen des Anne-Klein-Frauenpreises teilen, nominiert werden. Aus den Vorschlägen wählt die fünfköpfige Jury freuen wir uns auch über weitere Spenden: Anne-Klein-Frauenpreis die Preisträgerin aus. Heinrich-Böll-Stiftung Nominierungskriterien Konto 307 67 02 Stichwort «Anne Klein» Kandidatinnen für den Anne-Klein-Frauenpreis der Heinrich-Böll- Bank für Sozialwirtschaft Stiftung sollen politisch engagiert und zivilgesellschaftlich vernetzt BLZ 100 205 00 sein sowie als Vorbilder andere Frauen und Mädchen zu geschlech- terdemokratischem Handeln ermutigen. Sie sollen sich durch heraus- IBAN: DE11 1002 0500 0003 0767 02 ragende Aktivitäten und Engagement nachweislich für Frauen und BIC: BFSW DE 33 BER Mädchen ausgezeichnet haben, insbesondere durch Verwirklichung der Geschlechterdemokratie Kontakt: Beseitigung von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts Heinrich-Böll-Stiftung und der geschlechtlichen Identität Anne-Klein-Frauenpreis politisches Engagement zur Verwirklichung von Frauen-, Ulrike Cichon Menschen- und Freiheitsrechten E [email protected] Förderung von Frauen und Mädchen in Wissenschaft T 030.285 34-112 und Forschung www.boell.de/annekleinfrauenpreis Nominierungswürdig sind Frauen, die als Pionierinnen mutig und hartnäckig ihr Anliegen verfolgen, gesellschaftliche Veränderungen bewirken und sich so auch durch Zivilcourage und Widerstand Besuchen sie auch das feministische -

Beyond Social Democracy in West Germany?
BEYOND SOCIAL DEMOCRACY IN WEST GERMANY? William Graf I The theme of transcending, bypassing, revising, reinvigorating or otherwise raising German Social Democracy to a higher level recurs throughout the party's century-and-a-quarter history. Figures such as Luxemburg, Hilferding, Liebknecht-as well as Lassalle, Kautsky and Bernstein-recall prolonged, intensive intra-party debates about the desirable relationship between the party and the capitalist state, the sources of its mass support, and the strategy and tactics best suited to accomplishing socialism. Although the post-1945 SPD has in many ways replicated these controversies surrounding the limits and prospects of Social Democracy, it has not reproduced the Left-Right dimension, the fundamental lines of political discourse that characterised the party before 1933 and indeed, in exile or underground during the Third Reich. The crucial difference between then and now is that during the Second Reich and Weimar Republic, any significant shift to the right on the part of the SPD leader- ship,' such as the parliamentary party's approval of war credits in 1914, its truck under Ebert with the reactionary forces, its periodic lapses into 'parliamentary opportunism' or the right rump's acceptance of Hitler's Enabling Law in 1933, would be countered and challenged at every step by the Left. The success of the USPD, the rise of the Spartacus move- ment, and the consistent increase in the KPD's mass following throughout the Weimar era were all concrete and determined reactions to deficiences or revisions in Social Democratic praxis. Since 1945, however, the dynamics of Social Democracy have changed considerably. -

Gründungsaufruf Des Kuratoriums Für Einen Demokratisch Verfassten Bund Der Länder
Am 16. Juni 1990 hat sich im Reichstag, Berlin, Das Kuratorium ist ein Forum für eine breite das KURATORIUM FÜR EINEN DEMOKRA- öffentliche Verfassungsdiskussion, eine TISCH VERFASSTEN BUND DEUTSCHER LÄN- Verfassunggebende Versammlung und für DER gegründet und folgenden Gründungsauf- eine gesamtdeutsche Verfassung mit Volks- ruf verabschiedet: entscheid. Um diesen Forderungen Nach- „Das KURATORIUM FÜR EINEN DEMOKRA- druck zu verleihen, führen wir eine Unter- TISCH VERFASSTEN BUND DEUTSCHER LÄN- schriftensammlung durch und rufen auf, DER hat sich gebildet, um eine breite öffentliche Ver- sich daran aktiv zu beteiligen. fassungsdiskussion zu fördern, deren Ergebnisse in eine Verfassunggebende Versammlung einmünden sol- „Ich will, daß die Menschen in der B R D und in der len. Auf der Basis des Grundgesetzes für die Bundes- D D R ihr politisches Zusammenleben selbst gestalten republik Deutschland, unter Wahrung der in ihm ent- und darüber in einer Volksabstimmung entscheiden haltenen Grundrechte und unter Berücksichtigung können. Die wichtigsten Weichenstellungen für die des Verfassungsentwurfs des Runden Tisches für die neue deutsche Republik dürfen nicht über die Köpfe DDR, soll eine neue gesamtdeutsche Verfassung aus- der Menschen hinweg getroffen werden. gearbeitet werden. Wir setzen uns dafür ein, daß die Deshalb muß unter Beteiligung der Bürgerinnen und Einberufung einer Verfassunggebenden Versammlung Bürger eine Verfassung ausgearbeitet und ,von dem zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen' Deutschen Demokratischen Republik verbindlich werden (Art. 146 GG). Diese Verfassung darf nicht festgeschrieben und die neue gesamtdeutsche Verfas- hinter das Grundgesetz der Bunderepublik Deutsch- sung von den Bürgerinnen und Bürgern durch Volks- land zurückfallen. Sie bietet vielmehr die Chance, entscheid angenommen wird." (verabschiedet auf der den hinzugekommenen Aufgaben entsprechend, die Gründungssitzung des Kuratoriums am 16. -

1 Claus Offe Crisis and Innovation of Liberal Democracy: Can Deliberation
Claus Offe Crisis and innovation of liberal democracy: Can deliberation be institutionalized? Liberal democracies, and by far not just the new ones among them, are not functioning well. While there is no realistic and normatively respectable alternative to liberal democracy in sight, the widely observed decline of democratic politics, as well as state policies under democracy, provides reasons for concern. This concern is a challenge for sociologically informed political theorists to come up with designs for remedial innovations of liberal democracy. In this essay, I am going to review institutional designs for democratic innovation. I shall proceed as follows. The first section addresses the question of the functions of liberal democracy. What are the fea- tures and expected outcomes of democracy which explain why liberal democracy is so widely considered today to be the most desirable form of political rule? The second section looks at the institutional structure and the constitutive mechanisms of democratic regimes. In either of these sections four relevant items are specified and discussed. Thirdly, I shall provide a very con- densed summary of critical accounts concerning democracy's actual failures and symptoms of malfunctioning. In a final section, I distinguish two families of institutional innovations that are currently being proposed as remedies for some of the observed deficiencies of democracy, with an emphasis on "deliberative" methods of political preference formation. (1) Four functional virtues of liberal democracy 1 The question is not often asked, as its answer appears quite obvious: What is democracy good for? In fact, there are several answers, corresponding to different schools of political theory. -

JAHRESBERICHT 2016 EUROPÄISCHES JUGENDPARLAMENT in DEUTSCHLAND E.V
JAHRESBERICHT 2016 EUROPÄISCHES JUGENDPARLAMENT IN DEUTSCHLAND e.V. Impressum Jahresbericht 2016 des Europäischen Jugendparlaments in Deutschland e.V. © Europäisches Jugendparlament in Deutschland e.V. (EJP) European Youth Parliament Germany V.i.S.d.P.: David Plahl, Janis Fifka Layout: Kira Lange Abbildungen: Eigentum des EJP, wenn nicht anders genannt. Sophienstraße 28-29, 10178 Berlin E-Mail: [email protected] Internet: www.eyp.de Telefon: +49 (0) 30 280 95 - 155 Fax: +49 (0) 30 280 95 - 150 Gestaltungsvorlage: European Youth Parliament c/o Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa Jonas Pruditsch David Plahl Vorstandsvorsitzender Sehr geehrte Damen und Herren, Liebe Freundinnen und Freunde des Europäischen Jugendparlaments, mit dem vergangenen Jahr 2016 liegt wohl eines der politisch erschütterndsten Jahre in Europa und welt- weit hinter uns. Gerade die Europäische Union erlebte in den vergangenen Monaten sehr bewegte Zeiten. Anhaltende Konflikte und soziale Ungleichgewichte drängten weiterhin viele Millionen von Menschen dazu, zu fliehen. Die Auswirkungen beschäftigten unser Europa im Jahr 2016 so sehr wie fast kein anderes Thema. Das Votum der Bürgerinnen und Bürger des Vereinigten Königreichs, die Europäische Union zu verlassen, hat den gesamten Kontinent erschüttert. Der Aufstieg populistischer und euroskeptischer Kräfte in vielen Ländern stellt die etablierten Parteien und auch die Europäische Union mit ihren Institutionen vor neue Herausforderungen. All diese Krisen erfordern eine starke Zivilgesellschaft, die sich der Bewältigung dieser aktiv annimmt. Es gilt Antworten zu finden und die Menschen wieder davon zu überzeugen, dass in vielen Bereichen eine europäische Lösung für alle Beteiligten vorteilhaft ist. Gerade für diese Diskussionen über aktuelle Fragen der Europapolitik bietet das Europäischen Jugendpar- lament Jugendlichen einen Rahmen. -

Solving the EU's Democratic Deficit Would Help Revive Democracy at the National Level
Solving the EU’s democratic deficit would help revive democracy at the national level blogs.lse.ac.uk/europpblog/2014/12/16/solving-the-eus-democratic-deficit-would-help-revive-democracy-at-the- national-level/ 16/12/2014 The European Union has often been accused of having a ‘democratic deficit’, but what measures would actually improve EU democracy? William Outhwaite writes on theoretical models of democracy and how they might be applied to EU politics. He notes that while the democratic problems associated with the EU policy process are very real, strong leadership from within the EU’s institutions could help bring about a revival of democracy at both the national and European levels. To paraphrase Jean-Jacques Rousseau, the EU is born free yet is everywhere in chains. Its member states have by law to be democratic (Hungary is currently pushing this particular envelope), but there is a discussion of principle about whether the Union itself needs democracy which it would be hard (and disturbing) to find in any member state. This uncertainty exists among both experts and the public. Citizens are prone to feel decisions ought to be made at the national level, while criticising the EU for its lack of democracy. Europe’s ‘democratic deficit’ The ‘democratic deficit’ in the EU has been a topic since the 1980s; a good source of an explanation is the ‘ gridlock’ model, in which an initially successful organisational model becomes an obstacle to further change. The tension between the Council, made up of (often, though not always, elected) politicians from member states on the one hand and the directly elected Parliament on the other is a structural feature of the EU; so is the tension between its formal decision-making structures and intergovernmental deals between (usually the larger) member states. -

European Union Objectives for the 2002 Kananaskis G8 Summit
European Union Objectives for the 2002 Kananaskis G8 Summit Political Data Government 1. EU Council Presidency: Spain (Jose Maria Aznar, Spanish Prime Minister) Secretary-General of the EU Council/ High Representative of the Common Foreign and Security Policy (CFSP): Javier Solana 2. EU Commission President Romano Prodi Vice-president; Administrative Reform Neil Kinnock Vice-president; Relations Loyola de Palacio with the European Parliament, Transport & Energy Competition Mario Monti Agriculture, Rural Franz Fischler Development & Fisheries Enterprise & Information Erkki Liikanen Society Internal Market; Taxation Frits Bolkestein and Customs Union Research Philippe Busquin Economic & Monetary Pedro Solbes Mira Affairs Development & Poul Nielson Humanitarian Aid Enlargement Günter Verheugen External Relations Chris Patten Trade Pascal Lamy Health & Consumer David Byrne Protection 1 Regional Policy Michel Barnier Education & Culture Viviane Reding Budget Michaele Schreyer Environment Margot Wallström Justice & Home Affairs Antonio Vitorino Employment & Social Anna Diamantopoulou Affairs 3. EU Parliament Country Representation Number of Seats President Pat Cox Belgium 25 (Verts/ ALE) Denmark 16 (ELDR) Germany 19 (PPE-DE) Greece 25 (PPE-DE), (PSE) Spain 64 (PPE-DE) France 86 (PSE) Ireland 15 (UEN) Italy 87 (PPE-DE) Luxembourg 6 (PPE-DE) Netherlands 31 (PPE-DE) Austria 21 (PPE-DE), (PSE) Portugal 25 (PSE) Finland 16 (PPE – DE), (ELDR) Sweden 22 (PPE – DE) Britain 87 (PPE – DE) Total Parliamentary 625 Seats Notes: 1. PPE-DE: Group of the European People’s Party (Christian Democrats) and European Democrats = 232 2. PSE: Group of the Party of European Socialists = 179 3. ELDR: Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party = 53 4. Verts/ ALE: Group of the Greens/ European Free Alliance = 45 5. -

Strengthening Democracy in Uncertain Times
CONFERENCE PROGRAM — STRENGTHENING DEMOCRACY IN UNCERTAIN TIMES 21ST FORUM 2000 CONFERENCE | 8—10 October 2017 | Prague and other cities www.forum2000.cz | #forum2000 SIDE EFFECTS: FAILURE TO USE THIS PRODUCT INCREASES THE RISK THAT SOMEONE ELSE WILL MISUSE IT. WARNING: IMPROPER HANDLING OF FREE ELECTIONS WILL CAUSE DETERIORATION OF DEMOCRACY. THIS PRODUCT IS SENSITIVE TO POPULISM. PLEASE KEEP IT OUT OF THE REACH OF IRRESPONSIBLE INDIVIDUALS. STRENGTHENING DEMOCRACY IN UNCERTAIN TIMES 21ST FORUM 2000 CONFERENCE | 8–10 October 2017 | Prague and other cities www.forum2000.cz | #forum2000 2 Conference App: #forum2000 3 SUNDAY — OCTOBER 8 4 11.00—12.30 Discussion (Faculty of Law, Charles University) d EN CHANGING INTERNATIONAL ORDER AND THE FUTURE OF OUR PLANET Opening remarks Prince Albert II of Monaco — Head of State, Monaco Remarks Karel Schwarzenberg — Chairman, Committee on Foreign Affairs, Chamber of Deputies, Parliament, Czech Republic t Mohamed Nasheed — Former President, Human Rights and Environmental Activist, Maldives Moderator Bedřich Moldan — Director, Environment Center, Charles University, Czech Republic 16.00—17.30 Panel (Embassy of Germany) d EN THE CHALLENGES OF THE TRANSATLANTIC RELATIONS AND THE IMPACT ON DEMOCRACY In cooperation with the Embassy of the Federal Republic of Germany and the Friedrich Naumann Foundation. By special invitation only. Welcome Guido Müntel — Spokesperson, German Embassy in Prague, Germany Panel discussion Claus Offe — Political Sociologist, Hertie School of Governance, Germany t Thomas Carothers — Senior Vice President for Studies, Carnegie Endowment for International Peace, USA t Yascha Mounk — Political Scientist, Harvard University, Germany t Karl-Heinz Paqué — Vice President, Friedrich Naumann Foundation, Germany Moderator Pavel Fischer — Director, STEM, Member, Program Council, Forum 2000 Foundation, Czech Republic 19.00—21.00 Ceremony and Reception (Prague Crossroads) d EN OPENING CEREMONY By special invitation only. -

FJNSB 2005 2.Pdf
Inhalt Forschungsjournal NSB, Jg. 18, 2/2005 1 EDITORIAL PULSSCHLAG .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 2 Strategisches Niemandsland 98 Helmut Martens Institution und soziale Bewegung: Strategi- AKTUELLE ANALYSE .................................................................................................................................... sche Herausforderung der Gewerkschaften 5 Gerd Mielke 105 Silke Brauers Auf der Suche nach der Gerechtigkeit Erfahrungswissen Älterer hoch im Kurs – Anmerkungen zur Programmdiskussion der ein internationaler Vergleich SPD in einer Zeit der Identitätskrise 110 Konstantin von Normann THEMENSCHWERPUNKT .................................................................................................................................... Die Evolution der Deutschen Tafeln 18 Rudolf Speth / Thomas Leif Eine Studie über eine junge Nonprofit- Thesen zum Workshop Organisation ,Strategiebildung und Strategieblockaden‘ 116 Marius Haberland 20 Rudolf Speth Protest und Vernetzung am Beispiel der Strategiebildung in der Politik ‚Initiative Berliner Sozialforum‘ 38 Andrea Nahles TREIBGUT Der Strategiebildungsprozess der SPD .................................................................................................................................... 121 Materialien, Notizen, Hinweise -

Technobureaucratic Capitalism
Luiz Carlos Bresser-Pereira TECHNOBUREAUCRATIC CAPITALISM São Paulo, 1990 2004 Introductory Note This book began with the translation, by Marcia Van Dyke, of my book A Sociedade Estatal e a Tecnoburocracia (São Paulo, Editora Brasiliense, 1981). A first version of it was submitted in 1983 to Cambridge University Press. After several months, the editor showed interest in the publication of the book, provided that I introduced major changes. Yet, in the meantime, I was called to political life, and was unable to make the required changes. In December 1987 I returned to academic life, and, after some time, reworked the originals, introducing the initial discussion of the state, and revising several parts, so as to become an integrated book instead of a collection of essays. This 1990 version was sent back to Cambridge University Press, but at that time they had lost the interest. This version was completed in mid 1990, when the collapse of Soviet Union was under way. It already acknowledged the breakdown of communism, but the disinterest of the publishing house let clear to me that more changes were required if I really wanted to publish the book in English. For years the ‘manuscript’ remained in my archives in digital form. Finally, in 2004, when I returned to the theme of this book by writing the paper “The Strategic Factor of Production in Technicians’ Capitalism” to be presented to the ‘John Kenneth Galbraith International Symposium’, to be held in Paris, September 23-25, I ‘rediscovered’ Technobureaucratic Capitalism. Since I have no short term plan of reworking the book¸ I decided to publish it in my web page in the original form. -

Protestparteien in Regierungsverantwortung
Universität Potsdam Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät Sommersemester 2006 Protestparteien in Regierungsverantwortung Die Grünen, die Alternative Liste, die STATT Partei und die Schill- Partei in ihrer ersten Legislaturperiode als kleine Koalitionspartner Dissertation Termin der Disputation: 14.06.2007 Betreuer/1.Gutachter: Prof. Dr. Jürgen Dittberner Zweitgutachter: Prof. Dr. Klaus Götz vorgelegt von: Adriana Wipperling Matrikelnummer: 129777 1 Impressum: Verantwortlich für den Inhalt: Adriana Wipperling Anschrift: Rosenweg 12 14772 Brandenburg Telefon: (03381) 70 71 91 Email: [email protected] Betreuende Einrichtung: Universität Potsdam Am Neuen Palais 10 14469 Potsdam Online veröffentlicht auf dem Publikationsserver der Universität Potsdam: http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2008/2703/ urn:nbn:de:kobv:517-opus-27030 [http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-27030] 2 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 6 1. 1. Problemstellung 6 1. 2. Stand der Forschung 7 1. 3. Aufbau und Methodik 10 2. Was ist eine Protestpartei? 12 2. 1. Definition des Begriffs „Politische Partei“ 12 2. 2. Protestparteien und soziale Bewegungen 15 2. 3. Protestparteien und Protestwähler 18 2. 4. Protest- vs. Milieupartei? 22 2. 4. 1. Die Entstehung sozialer Milieus 22 2. 4. 2. Grüne und PDS: Stamm- und Protestwähler 24 2. 4. 3. Die PDS zwischen Protest-, Milieu- und Regierungspartei 26 2. 4. 4. Die Grünen: Prototyp einer Bewegungspartei 30 2. 5. Das Basiskonsens-Konzept von Stöss 35 2. 6. Merkmale von Protestparteien 38 3. Regieren in Koalitionen 40 3. 1. Koalitionsbegriff und Koalitionstypen 41 3. 2. Großparteien und Kleinparteien 43 3. 3. Koalitionstheorie und Koalitionsmodelle 46 3. 3. 1. Das „Office-Seeking“-Theorem 46 3. 3.