Divided Government“ in Deutschland
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Dr. Otto Graf Lambsdorff F.D.P
Plenarprotokoll 13/52 Deutscher Bundestag Stenographischer Bericht 52. Sitzung Bonn, Donnerstag, den 7. September 1995 Inhalt: Zur Geschäftsordnung Dr. Uwe Jens SPD 4367 B Dr. Peter Struck SPD 4394B, 4399A Dr. Otto Graf Lambsdorff F.D.P. 4368B Joachim Hörster CDU/CSU 4395 B Kurt J. Rossmanith CDU/CSU . 4369 D Werner Schulz (Berlin) BÜNDNIS 90/DIE Dr. Norbert Blüm, Bundesminister BMA 4371 D GRÜNEN 4396 C Rudolf Dreßler SPD 4375 B Jörg van Essen F.D.P. 4397 C Eva Bulling-Schröter PDS 4397 D Dr. Gisela Babel F.D.P 4378 A Marieluise Beck (Bremen) BÜNDNIS 90/ Tagesordnungspunkt 1 (Fortsetzung): DIE GRÜNEN 4379 C a) Erste Beratung des von der Bundesre- Hans-Joachim Fuchtel CDU/CSU . 4380 C gierung eingebrachten Entwurfs eines Rudolf Dreßler SPD 4382A Gesetzes über die Feststellung des Annelie Buntenbach BÜNDNIS 90/DIE Bundeshaushaltsplans für das Haus- GRÜNEN 4384 A haltsjahr 1996 (Haushaltsgesetz 1996) (Drucksache 13/2000) Dr. Gisela Babel F.D.P 4386B Manfred Müller (Berlin) PDS 4388B b) Beratung der Unterrichtung durch die Bundesregierung Finanzplan des Bun- Ulrich Heinrich F D P. 4388 D des 1995 bis 1999 (Drucksache 13/2001) Ottmar Schreiner SPD 4390 A Dr. Günter Rexrodt, Bundesminister BMWi 4345 B Dr. Norbert Blüm CDU/CSU 4390 D - Ernst Schwanhold SPD . 4346D, 4360 B Gerda Hasselfeldt CDU/CSU 43928 Anke Fuchs (Köln) SPD 4349 A Dr. Jürgen Rüttgers, Bundesminister BMBF 4399B Dr. Hermann Otto Solms F.D.P. 4352A Doris Odendahl SPD 4401 D Birgit Homburger F D P. 4352 C Günter Rixe SPD 4401 D Ernst Hinsken CDU/CSU 4352B, 4370D, 4377 C Dr. -

Hamburger Kurs 1/2017 (Pdf)
1.2017 | Mitteilungen der SPD Hamburg Hamburger Kuvorrwsärts Guter Auftakt FÜR 2017 WIR SIND BEREIT FÜR DEN WAHLKAMPF Foto: Kirill Brusilovsky Kirill Foto: Martin Schulz beim Neumitgliederabend im Distrikt Oberalster mit dem Hörbuch der SPD Hamburg „150 Jahre SPD“ * Am 29. Januar hat der SPD-Bundesvorstand Martin Schulz Martin überreichte den jüngst eingetretenen Genossinnen die Handschrift der SPD. Er rief dazu auf, diese sozialdemo- einstimmig als Kanzlerkandidat und Parteichef nominiert. und Genossen ihre Parteibücher und nahm sich Zeit für per- kratischen Werte zu verteidigen und sich für soziale- und Damit wurde ein starkes Signal zum Aufbruch für das Wahl- sönliche Gespräche mit den Neumitgliedern an den Tischen Steuergerechtigkeit einzusetzen. jahr 2017 gesetzt. Allein im Verlauf seiner Wir treten mit Aydan Özoğuz, mitreißenden Rede konnten 200 On- Johannes Kahrs, Dorothee Mar- line-Neueintritte in die SPD verzeichnet tin, Niels Annen, Dr. Matthias werden. Seit der Bekanntgabe der Nomi- Bartke, Metin Hakverdi und den nierung von Martin Schulz haben sich die Kandidatinnen und Kandidaten Neueintritte sogar auf 5000 bundesweit der Landesliste für Hamburg an summiert - allein in Hamburg sind es 375 und freuen uns auf einen enga- neue Genossinnen und Genossen (Stand: gierten Wahlkampf, mit dem 16.2.2017). Ziel alle sechs hamburger Wahl- kreise für die SPD zu gewinnen. Wir freuen uns über jeden, der den Weg zu uns findet und uns in unserem Han- Die SPD-Landesorganisation deln und Wirken unterstützen möchte. stellt neben der Organisation Die vielen Neumitglieder sind eine große der Veranstaltungen mit Olaf Unterstützung für die SPD – nicht nur, SPD Hamburg Foto: Scholz und den jeweiligen Di- aber besonders im Wahlkampfjahr 2017. -

Plenarprotokoll 15/56
Plenarprotokoll 15/56 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 56. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 3. Juli 2003 Inhalt: Begrüßung des Marschall des Sejm der Repu- rung als Brücke in die Steuerehr- blik Polen, Herrn Marek Borowski . 4621 C lichkeit (Drucksache 15/470) . 4583 A Begrüßung des Mitgliedes der Europäischen Kommission, Herrn Günter Verheugen . 4621 D in Verbindung mit Begrüßung des neuen Abgeordneten Michael Kauch . 4581 A Benennung des Abgeordneten Rainder Tagesordnungspunkt 19: Steenblock als stellvertretendes Mitglied im a) Antrag der Abgeordneten Dr. Michael Programmbeirat für die Sonderpostwert- Meister, Friedrich Merz, weiterer Ab- zeichen . 4581 B geordneter und der Fraktion der CDU/ Nachträgliche Ausschussüberweisung . 4582 D CSU: Steuern: Niedriger – Einfa- cher – Gerechter Erweiterung der Tagesordnung . 4581 B (Drucksache 15/1231) . 4583 A b) Antrag der Abgeordneten Dr. Hermann Zusatztagesordnungspunkt 1: Otto Solms, Dr. Andreas Pinkwart, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Abgabe einer Erklärung durch den Bun- der FDP: Steuersenkung vorziehen deskanzler: Deutschland bewegt sich – (Drucksache 15/1221) . 4583 B mehr Dynamik für Wachstum und Be- schäftigung 4583 A Gerhard Schröder, Bundeskanzler . 4583 C Dr. Angela Merkel CDU/CSU . 4587 D in Verbindung mit Franz Müntefering SPD . 4592 D Dr. Guido Westerwelle FDP . 4596 D Tagesordnungspunkt 7: Krista Sager BÜNDNIS 90/ a) Erste Beratung des von den Fraktionen DIE GRÜNEN . 4600 A der SPD und des BÜNDNISSES 90/ DIE GRÜNEN eingebrachten Ent- Dr. Guido Westerwelle FDP . 4603 B wurfs eines Gesetzes zur Förderung Krista Sager BÜNDNIS 90/ der Steuerehrlichkeit DIE GRÜNEN . 4603 C (Drucksache 15/1309) . 4583 A Michael Glos CDU/CSU . 4603 D b) Erste Beratung des von den Abgeord- neten Dr. Hermann Otto Solms, Hubertus Heil SPD . -

Annual Report
ANNUAL REPORT European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH The European XFEL is organized as a non-profit company with limited liability under German law (GmbH) that has international shareholders. ANNUAL REPORT European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH CONTENTS 01 12 NEWS AND EVENTS 18 FACTS AND FIGURES 20 At a glance 44 Cooperation 02 22 Staff 51 User consortia 32 Organization chart 53 Short history of European XFEL 33 Budget 35 Shareholders 36 Organs and committees 64 FACILITY 66 Civil construction 03 71 Technical Services 74 IN-KIND CONTRIBUTIONS 76 IKC Overview 04 90 Accelerator Consortium 94 PHOTON BEAM SYSTEMS 96 Undulator Systems 122 Photon Systems Project Office 05 101 Simulation of Photon Fields 105 Theory 110 X-Ray Optics 114 Vacuum 118 X-Ray Photon Diagnostics 4 CONTENTS 126 SCIENTIFIC INSTRUMENTS AND EQUIPMENT 128 Scientific Instrument FXE 151 Optical Lasers 06 132 Scientific Instrument HED 155 Sample Environment 136 Scientific Instrument MID 159 Central Instruments Engineering Team 140 Scientific Instrument SCS 143 Scientific Instrument SPB/SFX 147 Scientific Instrument SQS 162 DETECTORS, CONTROLS, AND COMPUTING 164 Detector Development 07 167 Advanced Electronics 169 Control and Analysis Software 172 IT and Data Management 174 OPERATIONS 176 Facility 08 180 Experiments 184 Operation Statistics 186 SERVICES 188 Administrative Services 09 192 Internal Audit 193 Human Resources 195 Press and Public Relations 201 User Office 203 Safety and Radiation Protection 206 SCIENTIFIC RECORD AND GLOSSARY 208 European XFEL Users’ Meeting 10 209 RACIRI Summer School 210 Workshops 213 Seminars 216 Publications 230 Glossary 5 6 FOREWORD BY THE MANAGEMENT BOARD Left to right Serguei Molodtsov, Robert Feidenhans’l, Andreas S. -

Profile Persönlichkeiten Der Universität Hamburg Profile Persönlichkeiten Der Universität Hamburg Inhalt
FALZ FÜR EINKLAPPER U4 RÜCKENFALZ FALZ FÜR EINKLAPPER U1 4,5 mm Profile persönlichkeiten der universität hamburg Profile persönlichkeiten der universität hamburg inhalt 6 Grußwort des Präsidenten 8 Profil der Universität Portraits 10 von Beust, Ole 12 Breloer, Heinrich 14 Dahrendorf, Ralf Gustav 16 Harms, Monika 18 Henkel, Hans-Olaf 20 Klose, Hans-Ulrich 22 Lenz, Siegfried 10 12 14 16 18 20 22 24 Miosga, Caren 26 von Randow, Gero 28 Rühe, Volker 30 Runde, Ortwin 32 Sager, Krista 34 Schäuble, Wolfgang 24 26 28 30 32 34 36 36 Schiller, Karl 38 Schmidt, Helmut 40 Scholz, Olaf 42 Schröder, Thorsten 44 Schulz, Peter 46 Tawada, Yoko 38 40 42 44 46 48 50 48 Voscherau, Henning 50 von Weizsäcker, Carl Friedrich 52 Impressum grusswort des präsidenten Grußwort des Präsidenten der Universität Hamburg Dieses Buch ist ein Geschenk – sowohl für seine Empfänger als auch für die Universität Hamburg. Die Persönlichkeiten in diesem Buch machen sich selbst zum Geschenk, denn sie sind der Universität auf verschiedene Weise verbunden – als Absolventinnen und Absolventen, als ehemalige Rektoren, als prägende Lehrkräfte oder als Ehrendoktoren und -senatoren. Sie sind über ihre unmittelbare berufliche Umgebung hinaus bekannt, weil sie eine öffentliche Funktion wahrnehmen oder wahrgenommen haben. Die Universität Hamburg ist fern davon, sich selbst als Causa des beruflichen Erfolgs ihrer prominenten Alumni zu betrach- ten. Dennoch hat die Universität mit ihnen zu tun. Sie ist der Ort gewesen, in dem diese Frauen und Männer einen Teil ihrer Sozialisation erfahren haben. Im glücklicheren Fall war das Studium ein Teil der Grundlage ihres Erfolges, weil es Wissen, Kompetenz und Persönlichkeitsbildung ermöglichte. -

Bundesminister Christian Schmidt Ist Neuer Botschafter Des Bieres
S people Bundesminister Christian Schmidt ist neuer BoAutf desm Decutshchena Brafuerttag ein Brerlin übdergaeb Ces m ÖzdeBmiri dase Amrt an eseins en Nachfolger Berlin, 10. Juni 2015. Der Bundesminister für Ernäh - rung und Landwirtschaft, Christian Schmidt, wird neuer „Botschafter des Bieres“. Der Deutsche Brauer-Bund German Federal Minister zeichnete den CSU-Politiker beim Deutschen Brauertag Christian Schmidt is the am 11. Juni in Berlin mit dem Ehrentitel aus. Grünen- Parteichef Cem Özdemir, New Beer Ambassador 2014 gemeinsam mit der Berlin, June 10, 2015. The Moderatorin Sonya Kraus German Federal Minister zum „Botschafter des of Food and Agriculture, Bieres“ ernannt, übergab Christian Schmidt, becomes das Amt an seinen Nach - the new “Beer Ambassa - folger. dor”. The German Brewers Federation (GBF) awarded „Deutsches Bier und the CSU politician this seine vier natürlichen Zu - honorary title on June 10 at taten – Wasser, Hopfen, the German Brewers' Con - Malz und Hefe – sind seit gress in Berlin. The head of Jahrhunderten untrennbar the German Green Party, mit der Landwirtschaft ver- Cem Özdemir, who to- bunden. Hochwertigste gether with TV presenter Rohstoffe sichern die Qua- Sonya Kraus was appointed lität deut scher Biere“, er - “beer ambassador” in 2014, klärte der Präsident des Christian Schmidt, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft / handed over his office to his Deutschen Brauer-Bundes German Federal Minister of Food and Agriculture successor. Dr. Hans- Georg Eils. Als Minister setze sich Christian Schmidt dafür ein, dass “German beer and its four natural ingredients – water, Landwirtschaft und Brauwirtschaft auf europäischer hops, malt and yeast – have been inseparable from German wie auch auf nationaler Ebene weiterhin verlässliche agriculture for centuries. -

Plenarprotokoll 15/102
Plenarprotokoll 15/102 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 102. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 1. April 2004 Inhalt: Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Edelgard Bulmahn, Bundesministerin nung . 9147 A BMBF . 9160 A Absetzung der Tagesordnungspunkte 17, 20, Katherina Reiche CDU/CSU . 9160 C 23 h und 23 i . 9148 B Jörg Tauss SPD . 9163 A Nachträgliche Ausschussüberweisungen . 9148 B Katherina Reiche CDU/CSU . 9163 C Grietje Bettin BÜNDNIS 90/ Tagesordnungspunkt 3: DIE GRÜNEN . 9163 C a) Erste Beratung des von den Fraktionen Cornelia Pieper FDP . 9164 A der SPD und des BÜNDNISSES 90/ Christoph Hartmann (Homburg) FDP . 9165 A DIE GRÜNEN eingebrachten Ent- wurfs eines Gesetzes zur Sicherung Petra Pau fraktionslos . 9165 D und Förderung des Fachkräftenach- Dr. Ernst Dieter Rossmann SPD . 9166 D wuchses und der Berufsausbil- dungschancen der jungen Genera- Dagmar Wöhrl CDU/CSU . 9168 A tion (Berufsausbildungssicherungs- gesetz – BerASichG) Swen Schulz (Spandau) SPD . 9170 C (Drucksache 15/2820) . 9148 C b) Antrag der Abgeordneten Cornelia Pieper, Christoph Hartmann (Hom- Tagesordnungspunkt 4: burg), weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP: Ausbildungsplatz- Antrag der Abgeordneten Karl-Josef abgabe verhindern – Wirtschaft Laumann, Dagmar Wöhrl, weiterer Abge- nicht weiter belasten – Berufsausbil- ordneter und der Fraktion der CDU/CSU: dung stärken Weichen stellen für eine bessere Be- (Drucksache 15/2833) . 9148 D schäftigungspolitik – Wachstumspro- gramm für Deutschland Jörg Tauss SPD . 9149 A (Drucksache 15/2670) . 9172 A Friedrich Merz CDU/CSU . 9151 B Karl-Josef Laumann CDU/CSU . 9172 B Dr. Thea Dückert BÜNDNIS 90/ Klaus Brandner SPD . 9175 C DIE GRÜNEN . 9154 A Dirk Niebel FDP . 9176 A Cornelia Pieper FDP . 9155 B Karl-Josef Laumann CDU/CSU . -

Organizational Change in Office-Seeking Anti-Political
Adapt, or Die! Organizational Change in Office-Seeking Anti- Political Establishment Parties Paper for Presentation at the Annual General Meeting of the Canadian Political Science Association in Winnipeg, Manitoba, June 3-5, 2004. Amir Abedi, Ph.D. Dr. Steffen Schneider Department of Political Science Collaborative Research Center 597 – Western Washington University Transformations of the State 516 High Street, MS-9082 University of Bremen Bellingham, WA 98225-9082 P.B. 33 04 40 USA 28334 Bremen Germany Tel.: +1-360-650 4143 +49-421-218 8715 Fax: +1-360-650-2800 +49-421-218 8721 [email protected] [email protected] Draft version – not to be quoted – comments welcome I Introduction Over the last few years, the entry of radical right-wing parties into national governments in Austria, Italy and the Netherlands has made headlines around the world and sparked debates on the impact that the government participation of these formations might have on policy- making, political cultures and system stability in the affected countries (Hainsworth, 2000; Holsteyn and Irwin, 2003; Kitschelt, 1995; Luther, 2003; Minkenberg, 2001). There has been much less discussion about the effects of government participation on radical right-wing parties themselves. After all, they tend to portray themselves as challengers of the political establishment up to the moment of joining coalitions with their mainstream competitors. In this, they are comparable to new politics, left-libertarian or green parties, which began their life as challengers of the establishment as well but have joined national governments in Belgium, Finland, France, Germany and Italy over the last decade (Müller-Rommel, 1998; Taggart, 1994). -
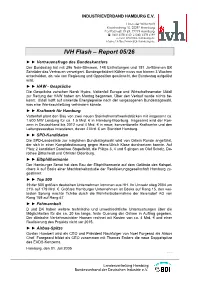
IVH Flash – Report 05/26
INDUSTRIEVERBAND HAMBURG E.V. Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10, 22297 Hamburg Postfach 60 19 69, 22219 Hamburg 040/ 6378-4120 040/ 6378-4199 e-mail: [email protected] Internet: http://www.BDI-Hamburg.de IVH Flash – Report 05/26 ► ► Vertrauensfrage des Bundeskanzlers Der Bundestag hat mit 296 Nein-Stimmen, 148 Enthaltungen und 151 Ja-Stimmen BK Schröder das Vertrauen verweigert. Bundespräsident Köhler muss nun binnen 3 Wochen entscheiden, ob, wie von Regierung und Opposition gewünscht, der Bundestag aufgelöst wird. ► ► HAW - Gespräche Die Gespräche zwischen Norsk Hydro, Vattenfall Europe und Wirtschaftssenator Uldall zur Rettung der HAW haben am Montag begonnen. Über den Verlauf wurde nichts be- kannt. Uldall hofft auf sinkende Energiepreise nach der vorgezogenen Bundestagswahl, was eine Werksschließung verhindern könnte. ► ► Kraftwerk für Hamburg Vattenfall plant den Bau von zwei neuen Steinkohlekraftwerksblöcken mit insgesamt ca. 1.600 MW Leistung für ca. 1.5 Mrd. € in Hamburg-Moorburg. Insgesamt wird der Kon- zern in Deutschland bis 2012 rund 4 Mrd. € in neue, konventionelle Kraftwerke und den Leitungssausbau investieren, davon 2 Mrd. € am Standort Hamburg. ► ► SPD-Kandidaten Die SPD-Landesliste zur möglichen Bundestagswahl wird von Ortwin Runde angeführt, der sich in einer Kampfabstimmung gegen Hans-Ulrich Klose durchsetzen konnte. Auf Platz 2 kandidiert Dorothee Stapelfeldt, die Plätze 3, 4 und 5 gingen an Olaf Scholz, Do- rothee Bittscheidt und Christel Oldenburg. ► ► Elbphilharmonie Der Hamburger Senat hat dem Bau der Elbphilharmonie auf dem Gelände des Kaispei- chers A auf Basis einer Machbarkeitsstudie der Realisierungsgesellschaft Hamburg zu- gestimmt. ► ► Top 500 39 der 500 größten deutschen Unternehmen kommen aus HH. Ihr Umsatz stieg 2004 um 21% auf 179 Mrd. -

Entschließungsantrag Der Abgeordneten Steffi Lemke, Ulrike Höfken, Michaele Hustedt Und Der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Deutscher Bundestag Drucksache 13/3634 13. Wahlperiode 31.01.96 Entschließungsantrag der Abgeordneten Steffi Lemke, Ulrike Höfken, Michaele Hustedt und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu der Großen Anfrage der Abgeordneten Peter Harry Carstensen (Nordstrand), Renate Blank, Peter Bleser, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der CDU/CSU sowie der Abgeordneten Dr. Hermann Otto Solms, Günther Bredehorn, Ulrich Heinrich, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der F.D.P. — Drucksachen 13/1633, 13/2583, 13/3044 (Berichtigung) — Lage der Fischerei Der Bundestag wolle beschließen: I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: Die Entwicklung der Fischbestände in Nordwest-Atlantik, im Nordost-Atlantik sowie in der Nord- und Ostsee ist seit Jahren rückläufig. Neben der jahrzehntelang überhöhten Schadstoff- einleitung in die Meere trägt die Fischereiwirtschaft die Haupt- verantwortung am rapiden Schrumpfen der Fischbestände und am ökologischen Ausverkauf der Meere. Aus der Nordsee werden seit langem mehr Fische entnommen als nachwachsen können. Dabei wird ein Drittel der Gesamtfangmenge als Abfall ins Meer zurückgeworfen (Discard), ein Viertel wird zu Fischöl oder Fischmehl verarbeitet (Industriefischerei). Die wichtigsten Speisefischarten Kabeljau, Schellfisch, Seelachs, Scholle, Seezunge und Makrele sind in der Nordsee bis zur biologisch kritischen Grenze dezimiert. Die Erholung der Be- stände ist akut gefährdet, da immer mehr Fische entnommen werden, bevor sie geschlechtsreif sind. Da das Durchschnitts- gewicht der Fische stetig abnimmt, verschlechtert sich auch das wirtschaftliche Ergebnis der Fischer. Die Fischereiwirt- schaft steht ökonomisch vor dem Aus, da sie sich selbst ihre Wirtschaftsgrundlage entzieht. Die deutsche Große Hochsee- fischerei ist aufgrund des massiven Ertragrückgangs bereits völlig eingestellt worden. Die Europäische Kommission erkennt an, daß die intensive Fischerei zur Überfischung geführt und sich das Verhältnis der Arten zueinander drastisch geändert hat. -

Der Bundesrat in Hamburg
PROGRAMM Sonntag, 5. Oktober 2008 MUSIK Musikalisches Programm ....................10.00 – 12.00, ab 17.00 Uhr mit „Peter und der Wüst“ Jugend-Band-Contest mit Hamburger Jugendbands Kellerchaos ...................................................................12.15 Uhr Misprint.........................................................................13.15 Uhr For our Sake ................................................................ 14.30 Uhr FEGER ......................................................................... 15.30 Uhr Bekanntgabe der Gewinnerband ............................... 16.45 Uhr INFORMATION Bundesratsquiz............................10.50, 11.30, 12.05, 16.15 Uhr Auslosung des Bundesratsquiz ................................. 16.45 Uhr Gewinn: „Reise nach Berlin für die ganze Familie“ D e r B u n d e s r a t i n H a m b u r g UNTERHALTUNG Das Programm des Bundesrates Talks und Gäste im Studio Bundesrat zum Tag der Deutschen Einheit in Hamburg Moderation: Stefan Schulze-Hausmann (ZDF/3sat) 3. bis 5. Oktober 2008 Michael Pohl ................................................................ 13.00 Uhr Geschäftsführer RTL Nord Elke Fischer ................................................................. 14.00 Uhr Vorsitzende der Kinder- und Jugendstiftung „JOVITA“ Till Demtrøder ...............................................................14.15 Uhr Schauspieler aus dem „Großstadtrevier“ Janina Delia Schmidt ....................................................15.15 Uhr Finalistin aus „Germany‘s next Topmodel“ Lilo Wanders -

Protestparteien in Regierungsverantwortung
Universität Potsdam Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät Sommersemester 2006 Protestparteien in Regierungsverantwortung Die Grünen, die Alternative Liste, die STATT Partei und die Schill- Partei in ihrer ersten Legislaturperiode als kleine Koalitionspartner Dissertation Termin der Disputation: 14.06.2007 Betreuer/1.Gutachter: Prof. Dr. Jürgen Dittberner Zweitgutachter: Prof. Dr. Klaus Götz vorgelegt von: Adriana Wipperling Matrikelnummer: 129777 1 Impressum: Verantwortlich für den Inhalt: Adriana Wipperling Anschrift: Rosenweg 12 14772 Brandenburg Telefon: (03381) 70 71 91 Email: [email protected] Betreuende Einrichtung: Universität Potsdam Am Neuen Palais 10 14469 Potsdam Online veröffentlicht auf dem Publikationsserver der Universität Potsdam: http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2008/2703/ urn:nbn:de:kobv:517-opus-27030 [http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-27030] 2 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 6 1. 1. Problemstellung 6 1. 2. Stand der Forschung 7 1. 3. Aufbau und Methodik 10 2. Was ist eine Protestpartei? 12 2. 1. Definition des Begriffs „Politische Partei“ 12 2. 2. Protestparteien und soziale Bewegungen 15 2. 3. Protestparteien und Protestwähler 18 2. 4. Protest- vs. Milieupartei? 22 2. 4. 1. Die Entstehung sozialer Milieus 22 2. 4. 2. Grüne und PDS: Stamm- und Protestwähler 24 2. 4. 3. Die PDS zwischen Protest-, Milieu- und Regierungspartei 26 2. 4. 4. Die Grünen: Prototyp einer Bewegungspartei 30 2. 5. Das Basiskonsens-Konzept von Stöss 35 2. 6. Merkmale von Protestparteien 38 3. Regieren in Koalitionen 40 3. 1. Koalitionsbegriff und Koalitionstypen 41 3. 2. Großparteien und Kleinparteien 43 3. 3. Koalitionstheorie und Koalitionsmodelle 46 3. 3. 1. Das „Office-Seeking“-Theorem 46 3. 3.