Materialband
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Erstreckungssatzung Auf Das Gebiet Der
Erstreckungssatzung auf das Gebiet der beteiligten Gemeinden Allmendingen, Altheim, Altheim/Alb, Amstetten, Asselfingen, Ballendorf, Balzheim, Beimerstetten, Berghülen, Bernstadt, Blaubeuren, Blaustein, Börslingen, Breitingen, Dietenheim, Dornstadt, Emeringen, Emerkingen, Erbach, Griesingen, Grundsheim, Hausen a.B., Heroldstatt, Holzkirch, Hüttisheim, Illerkirchberg, Illerrieden, Laichingen, Langenau, Lauterach, Lonsee, Merklingen, Munderkingen, Neenstetten, Nellingen, Nerenstetten, Oberdischingen, Obermarchtal, Oberstadion, Öllingen, Öpfingen, Rammingen, Rechtenstein, Rottenacker, Schelklingen, Schnürpflingen, Setzingen, Staig, Untermarchtal, Unterstadion, Unterwachingen, Weidenstetten, Westerheim und Westerstetten (Erstreckungssatzung Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt Ehingen (Donau)) Aufgrund des § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (Gem0) in Verbindung mit § 26 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) sowie in Verbindung mit § 2 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) hat der Gemeinderat der Stadt Ehingen (Donau) am 24.09.2020 folgende Satzung beschlossen: § 1 Erstreckung (1) Die „Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung von Gutachten durch den Gutachterausschuss (Gutachterausschussgebührensatzung)" der Stadt Ehingen (Donau) in ihrer jeweils gültigen Fassung gilt auf den Gemarkungen Allmendingen, Ennahofen, Grötzingen, Niederhofen, Weilersteußlingen, Altheim, Altheim/Alb, Amstetten, Bräunisheim, Hofstett-Emmerbuch, Reutti, Schalkstetten, Stubersheim, Asselfingen, Ballendorf, Balzheim, Oberbalzheim, -

54. Jahrgang 21. Januar 2021 KW 3
54. Jahrgang 21. Januar 2021 KW 3 Öffnungszeiten des Rathauses Apothekenbereitschaftsdienst Montag 9.00 – 12.00 Uhr / 15.00 – 18.00 Uhr Fr., 22.01.Marien-Apotheke, Ehingen Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr Sa., 23.01.St. Martins-Apotheke, Allmendingen Mittwoch 9.00 – 12.00 Uhr So., 24.01.7 Schwaben-Apotheke, Laupheim Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr / 15.00 – 17.00 Uhr Mo., 25.01.Alpha-Apotheke, Ehingen Durch Wahrnehmung von Terminen außerhalb des Di., 26.01.Apotheke am Bronner Berg, Laupheim Rathauses können Sprechzeiten des Bürgermeisters Mi., 27.01.Apotheke Dr. Mack, Munderkingen entfallen. Wichtige Termine, auch außerhalb der Do., 28.01.Schloss-Apotheke, Obermarchtal normalen Sprechzeiten, können jederzeit telefonisch vereinbart werden. Tel. dienstl. 1648 privat 07357/2672 Standesamtliche Nachrichten Wir gratulieren den Eltern Diana und Julian Rapp Ärztlicher Notfalldienst zur Geburt Ihrer Tochter Pauline am 12.01.2021 Bereitschaftsdienst: Notrufnummer 116 117 Bereitschaftsdienst-Zeiten: Mo, Di, Do ab 18 Uhr bis 8 Uhr des Folgetages; Mi ab 13 Uhr bis 8 Uhr des Folgetages; Abfallsammlungen Fr ab 16 Uhr bis 8 Uhr des Folgetages; Hausmüll: Mi, 27.01. Sa, So, Feiertage ab 8 Uhr bis 8 Uhr des Folgetages. Abholung Gelber Sack: Do, 28.01. Öffnungszeiten Notfallpraxis im Kreiskrankenhaus Ehingen (gegenüber Information am Haupteingang) Sa, So, Feiertage (auch 24./31.12.) 8 bis 22 Uhr. Terminvereinbarung nicht erforderlich. Notfallpraxis an normalen Werktagen geschlossen. Zahnärztlicher Notfalldienst Zu erfragen unter Tel . 01805 / 911 601 Zahnmedizinische -
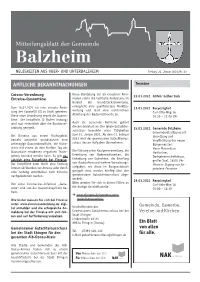
Mitteilungsblatt KW 03/21
Mitteilungsblatt der Gemeinde Balzheim NEUIGKEITEN AUS OBER- UND UNTERBALZHEIM Freitag, 22. Januar 2021/Nr. 03 AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN Termine Diese Bündelung der 55 einzelnen Kom- Corona-Verordnung 22.01.2021 Abfuhr Gelber Sack Einreise-Quarantäne munen stärkt die fachliche Kompetenz im Bereich der Grundstücksbewertung, ermöglicht eine qualifiziertere Marktbe- Zum 18.01.2021 ist eine erneute Ände- 23.01.2021 Recyclinghof wertung und lässt eine rechtssichere rung der CoronaVO EQ in Kraft getreten. Carl-Otto-Weg 16 Ableitung der Bodenrichtwerte zu. Diese neue Verordnung regelt die Quaran- 10.30 – 12.00 Uhr täne. Die Testpflicht (2 Stufen Testung) wird nun einheitlich über die Bundesver- Auch die Gemeinde Balzheim gehört diesem Gremium an. Der lokale Gutachter- ordnung geregelt. 25.01.2021 Gemeinde Balzheim ausschuss beendete seine Tätigkeiten Gemeinderatssitzung mit zum 31. Januar 2021. Ab dem 01. Februar Bei Einreise aus einem Risikogebiet Einsetzung und 2021 wird der gemeinsame Gutachteraus- besteht weiterhin grundsätzlich eine Verpflichtung des neuen schuss dessen Aufgaben übernehmen. zehntägige Quarantänepflicht, die frühe- Bürgermeisters stens mit einem ab dem fünften Tag der Herrn Maximilian Die Führung einer Kaufpreissammlung, die Quarantäne erhobenen negativen Tester- Hartleitner, Ermittlung von Bodenrichtwerten, die gebnis beendet werden kann. Es gilt zu- Dorfgemeinschaftshaus, Erstattung von Gutachten, die Erteilung sätzlich eine Testpflicht bei Einreise. großer Saal, 18:00 Uhr von Auskünften und weitere Verwaltungs- Der Testpflicht kann durch eine Testung Hinweis: Zugang nur für aufgaben, wie diese im Baugesetzbuch binnen 48 Stunden vor Anreise oder durch geladene Personen eine Testung unmittelbar nach Einreise geregelt sind, werden künftig über den nachgekommen werden. gemeinsamen Gutachterausschuss abge- wickelt. 29.01.2021 Recyclinghof Bitte wenden Sie sich in diesen Fällen an Von einer Coronavirus-Infektion „Gene- Carl-Otto-Weg 16 die dortige Geschäftsstelle: sene“ sind von der Quarantänepflicht be- 15:00 – 16:30 freit. -

Flüchtlinge Und Asylbewerberinnen/ Asylbewerber Im Alb-Donau-Kreis
Flüchtlinge und Asylbewerberinnen/ Asylbewerber im Alb-Donau-Kreis Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner Landratsamt Alb-Donau-Kreis – Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner Stand: 2. Oktober 2020 Inhaltsverzeichnis Fachdienst Flüchtlinge, Integration, staatliche Leistungen ............................................. 3 A. Integrationsmanagement ........................................................................................... 3 B. Leistungen für Asylbewerber/innen ........................................................................... 7 C. Vorläufige Unterbringung .......................................................................................... 8 D. Betreuung vor Ort ...................................................................................................... 8 Ausländerbehörde – Landratsamt Alb-Donau-Kreis....................................................... 9 Ausländerbehörde – Große Kreisstadt Ehingen ............................................................ 9 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge .......................................................................... 9 Jobcenter Alb-Donau ..................................................................................................... 9 Hilfestellung – An wen wende ich mich? ...................................................................... 11 2 Fachdienst Flüchtlinge, Integration, staatliche Leistungen Schillerstraße 30, 89077 Ulm Tel.: 0731/185 - Durchwahl Funktion Name Durchwahl Fachdienstleiter Sontheimer, Emanuel 4388 Stellvertretende -

Mitteilungsblatt KW 03
www.beimerstetten.de Nr. 03 Freitag, 22. Januar Jahrgang 2021 So schön kann Winter sein… Online-Informationsabend „Ausbau Containerbahnhof Ulm-Dornstadt“ Mittwoch, 27. Januar 2021 von 18 – 20 Uhr Die DB Netze plant den Ausbau und die Erweiterung des Containerbahnhofs Ulm-Dornstadt und bietet im Rahmen der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung interessierten Anwohnern an, sich noch vor dem Einreichen der Planfeststellungsun- terlagen über den aktuellen Sachstand zu informieren. Die Verantwortlichen stehen in einer Videokonferenz für Ihre Fragen rund um den geplanten Ausbau des Containerbahn- hofes zur Verfügung. • Ihre Fragen können Sie gerne vorab an [email protected] senden • Informationen im Internet erhalten Sie unter https:// bauprojekte.deutschebahn.com/p/ulm-dornstadt …genießen wir das, was wir haben! Die Veranstaltung findet über „Microsoft Teams“ statt. Alle näheren Informationen dazu finden Sie auf der Rückseite. Informationen zur Presseführung durch das Kreisimpfzentrum Ehingen am 19. Januar 2021 Landrat Heiner Scheffold: „Jede Impfdosis, die wir erhalten, wird verimpft“. Mit dem landesweiten Start der Kreisimpfzentren (KIZ) am 22. Januar 2021 beginnt auch der Betrieb des KIZ Ehingen. Die Priorität wird in der Anfangsphase zunächst bei den Impfungen in Pflegheimen liegen. „Mit der flächendeckenden Eröffnung von Kreisimpfzentren im ganzen Land treten wir in eine neue Phase der Pandemiebekämp- fung ein und können die Bevölkerung nun endlich auch aktiv vor dem Coronavirus schützen. Zwar werden wir uns auch die näch- Hinweis der Gemeinde: In diesem Zusammenhang sollen sten Wochen noch stark einschränken müssen, die Impfung ist auch Phasesüdlich der 1 unseresBrücke an Bauplans:der Dornstadter Straße weitere aber unsere Chance, die Pandemie in ihrer jetzigen Ausprägung Gleise erstellt werden. -

53. Jahrgang 1. Oktober 2020 KW 40
53. Jahrgang 1. Oktober 2020 KW 40 Öffnungszeiten des Rathauses Apothekenbereitschaftsdienst Montag 9.00 – 12.00 Uhr / 15.00 – 18.00 Uhr Fr., 02.10. Schloss-Apotheke, Obermarchtal Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr Sa., 03.10. Linden-Apotheke a. Sternplatz, Ehingen Mittwoch 9.00 – 12.00 Uhr So., 04.10. St. Martins-Apotheke, Allmendingen Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr / 15.00 – 17.00 Uhr Mo., 05.10. Apotheke Dr. Mack am Wenzelstein, Ehi. Durch Wahrnehmung von Terminen außerhalb des Di., 06.10. Rats-Apotheke, Ehingen Rathauses können Sprechzeiten des Bürgermeisters Mi., 07.10. Löwen-Apotheke, Oberdischingen entfallen. Wichtige Termine, auch außerhalb der Apotheke Dr. Mack am Marktplatz, Munderk. normalen Sprechzeiten, können jederzeit telefonisch Do., 08.10. Marien-Apotheke, Ehingen vereinbart werden. Tel. dienstl. 1648 privat 07357/2672 Abfallsammlungen Ärztlicher Notfalldienst Sperrmüllabfuhr: Do., 01.10. Bereitschaftsdienst: Abholung Gelber Sack: Di., 06.10. Notrufnummer 116 117 Hausmüll: Mi., 07.10. Bereitschaftsdienst-Zeiten: Voranzeige: Mo, Di, Do ab 18 Uhr bis 8 Uhr des Folgetages; Problemstoffsammlung: Fr., 9.10. Mi ab 13 Uhr bis 8 Uhr des Folgetages; Fr ab 16 Uhr bis 8 Uhr des Folgetages; Sa, So, Feiertage ab 8 Uhr bis 8 Uhr des Folgetages. Öffnungszeiten Notfallpraxis im Termine auf einen Blick Kreiskrankenhaus Ehingen SV Unterstadion – Abt. Jugendfußball (gegenüber Information am Haupteingang) Fr. 02.10., Sa. 03.10. Jugendspiele Sa, So, Feiertage (auch 24./31.12.) 8 bis 22 Uhr. Siehe auch unter Vereinsnachrichten Terminvereinbarung nicht erforderlich. Notfallpraxis an normalen Werktagen geschlossen. SV Unterstadion – Abt. Tischtennis Zahnärztlicher Notfalldienst Sa.03.10. Spieltag Siehe auch unter Vereinsnachrichten Zu erfragen unter Tel . -

Amstetten, Berghülen, Heroldstatt, Laichingen, Merklingen, Nellingen, Schelklingen, Westerheim
Ansprechpartner Landratsamt Alb-Donau-Kreis Fachdienst Bauen, Brand- und Katastrophenschutz Schillerstraße 30 89077 Ulm Kreisbaumeister Bezirk 1 Amstetten, Berghülen, Heroldstatt, Laichingen, Merklingen, Nellingen, Schelklingen, Westerheim Matthias Haumann Telefon: (0731) 185-1315 PC-Fax: (0731) 185-221315 Telefax: (0731) 185-1477 E-Mail: [email protected] Kreisbaumeisterin Bezirk 2a Beimerstetten, Dornstadt, Lonsee Petra Ruckgaber Telefon: (0731) 185-1278 PC-Fax: (0731) 185-221278 Telefax: (0731) 185-1477 E-Mail: [email protected] Kreisbaumeister Bezirk 2b Blaustein, Westerstetten Van Thanh Do Vo Telefon: (0731) 185-1277 PC-Fax: (0731) 185-221277 Telefax: (0731) 185-1477 E-Mail: [email protected] Kreisbaumeister Bezirk 3 Balzheim, Dietenheim, Erbach, Hüttisheim, Illerkirchberg, Illerrieden, Schnürpflingen, Staig Frank Rost Telefon: (0731) 185-1675 PC-Fax: (0731) 185-221675 Telefax: (0731) 185-1477 E-Mail: [email protected] Baurecht, Denkmalschutz Bezirk A Amstetten, Berghülen, Heroldstatt, Laichingen, Lonsee, Merklingen, Nellingen, Schelklingen, Westerheim, Westerstetten Thomas Langenbacher Telefon: (0731) 185-1279 PC-Fax: (0731) 185-221279 Telefax: (0731) 185-1477 E-Mail: [email protected] Baurecht, Denkmalschutz Bezirk B Balzheim, Beimerstetten, Blaustein, Dietenheim, Dornstadt, Illerrieden, Schnürpflingen Hans-Joachim Reinert Telefon: (0731) 185-1275 PC-Fax: (0731) 185-221275 Telefax: (0731) 185-1477 E-Mail: [email protected] -

MUNDERKINGER Donaubote 3
Munderkinger Donaubote AMTSBLATT DER STADT MUNDERKINGEN Freitag, 22. Januar 2021/Nr. 3 Abholservice in der Mediathek wieder möglich! Leider darf die Mediathek noch nicht für den Publikumsverkehr öffnen. Wir können aber ab sofort einen Abholservice von Medien kontaktlos anbieten. Sie schreiben uns eine E-Mail: [email protected] mit Ihren Medienwünschen. Oder Sie bestellen telefonisch unter: Tel.: 07393 /9534580. Bitte sprechen Sie auf den Anrufbeantworter. Bitte geben Sie dazu Ihren Namen oder Ihre Ausweisnummer an. Recherchieren Sie die verfügbaren Medien ganz einfach in unserem Online Katalog: wwwopac.rz-kiru.de/munderkingen Abholung und telefonische Bestellung der Medien: Jeden Dienstag: 16:00 - 18:00 Uhr Jeden Freitag: 10:00 - 12:00 Uhr Abholung nach Absprache Unser Rückgabeautomat ist rund um die Uhr geöffnet. Die Rückgabe der Medien ist willkommen, aber nicht zwingend notwendig. Wir verlängern während der Dauer der Schließung weiterhin alle Medien automatisch. Spruch des Tages Weiterhin besteht für aktuelle Nutzer der Mediathek Alles Große in der Welt geschieht die Möglichkeit, kostenlos über: www.onleihe.de/neckar-alb nur, weil jemand mehr tut, als er online auszuleihen. muss. (Hermann Gmeiner) 2 MUNDERKINGER Donaubote Freitag, 22. Januar 2021 ÖFFENTLICHE DIENSTSTELLEN Bürgermeisteramt Munderkingen Mediathek Zentrale Telefon: 07393 598-0, Fax: 07393 598-130 Alter Schulhof 2, 89597 Munderkingen, Telefon 07393 9534580 Internet: www.munderkingen.de, E-Mail: [email protected] Wir haben für Sie wie folgt geöffnet: Montag: -

54. Jahrgang 30. Juni 2021 KW 26
54. Jahrgang 30. Juni 2021 KW 26 Öffnungszeiten des Rathauses Apothekenbereitschaftsdienst Montag 9.00 – 12.00 Uhr / 15.00 – 18.00 Uhr Do., 01.07. Alpha-Apotheke, Ehingen Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr Fr., 02.07. Apotheke Dr. Mack, MVZ, Munderkingen Mittwoch 9.00 – 12.00 Uhr Sa., 03.07. Schloss-Apotheke, Obermarchtal Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr / 15.00 – 17.00 Uhr So., 04.07. Vitalis Apotheke, Ehingen Durch Wahrnehmung von Terminen außerhalb des Mo., 05.07. Rats-Apotheke, Laupheim Rathauses können Sprechzeiten des Bürgermeisters Di., 06.07. Apotheke Dr. Mack am Wenzelstein, Ehi. entfallen. Wichtige Termine, auch außerhalb der Mi., 07.07. Rats-Apotheke, Ehingen normalen Sprechzeiten, können jederzeit telefonisch Do., 08.07. Linden-Apotheke am Sternplatz, Ehingen vereinbart werden. Tel. dienstl. 1648 privat 07357/2672 Abfallsammlungen Ärztlicher Notfalldienst Hausmüll: Mi, 07.07. Bereitschaftsdienst: Notrufnummer 116 117 Bereitschaftsdienst-Zeiten: Voranzeige Mo/ Di/ Do: 18.00 – 8.00 Uhr des Folgetages, Alteisensammlung: Sa, 10.07. ab 8.00 Uhr Mi: 13.00 – 8.00 Uhr des Folgetages, Siehe Vereinsnachrichten MV Lyra Fr: 16.00 – 8.00 Uhr des Folgetages, Sa/ So/ Feiertage: 8.00 – 8.00 Uhr des Folgetages. Öffnungszeiten Notfallpraxis im Kreiskrankenhaus Ehingen Wichtige Rufnummern (gegenüber Information am Haupteingang) Polizeinotruf (Unfall, Überfall) 110 Sa, So, Feiertage (auch 24./31.12.) 8.00 – 22.00 Uhr. Polizeiposten Munderkingen 91560 Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Polizeirevier Ehingen 07391/5880 An Werktagen ist die Notfallpraxis nicht besetzt. Notruf (Feuerwehr/Rettungsdienst) 112 Kommandant U. Hipper 01746825586 Zahnärztlicher Notfalldienst ausschließl. Krankentransporte 0731/19222 Zu erfragen unter Tel . 01805 / 911 601 Kreiskrankenhaus Ehingen 07391/5860 Zahnmedizinische Patientenberatung Tel. -

Übersichtskarte Osterried Teilkarte 1
Natura 2000-Managementplan LSG FFH-Gebiet: 7623-341 Allmendingen Tiefental und Schmiechtal L E G E N D E Schutzkategorien Natura 2000 LSG FFH-Gebiet 7625-311 "Donau zwischen Munderkingen und Ulm und Ehingen NSG nördliches Illertal" LSG Hausener Berg / Das Gebiet ist ein Zusammenschluß der drei FFH-Gebiete: Allmendingen 7724-341 „Donau zwischen Munderkingen und Erbach“ Büchelesberg 7625-341 "Donautal bei Ulm" 7726-341 "Illertal" LSG benachbarte FFH-Gebiete NSG Erbach Hausener Berg / LSG benachbarte Vogelschutzgebiete (VSG) NSG Büchelesberg Erbach Umenlauh Natur- und Landschaftsschutzgebiete LSG Naturschutzgebiet (NSG) Allmendingen Landschaftsschutzgebiet (LSG) FFH-Gebiet: 7623-341 LSG Waldschutzgebiete Tiefental und Schmiechtal Oberdischingen LSG Schonwald Ehingen FFH-Gebiet:7622-341 Großes Lautertal LSG und Landgericht Ehingen NSG Ehinger Galgenberg NSG Blauer Steinbruch LSG Erbach FFH-Gebiet: 7623-341 LSG Tiefental und Schmiechtal Zwei Donau- LSG altwässer FFH-Gebiet:7625-311 Öpfingen Donau zwischen Munderkingen und Ulm LSG Ehingen und nördliches Illertal LSG Ehingen LSG LSG Drei Donaualt- Griesingen wässer (Ehingen) NSG LSG Sulzwiesen- Griesingen Lüssenschöpfle LSG Ehingen FFH-Gebiet:7622-341 Großes Lautertal und Landgericht NSG Pfaffenwert Grundlage: Topographische Karte 1:500.000 (UK500) LSG Topographische Karte 1:25.000 (TK25) Ehingen © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL) (www.lgl-bw.de) Az.: 2851.9-1/19 LSG VS-Gebiet: LSG Rottenacker Munder- 7624-441 kingen Täler der Mittleren 0 500 1.000 2.000 -

54. Jahrgang 14.Juli 2021 KW 28
54. Jahrgang 14.Juli 2021 KW 28 Öffnungszeiten des Rathauses Apothekenbereitschaftsdienst Montag 9.00 – 12.00 Uhr / 15.00 – 18.00 Uhr Do., 15.07. Apotheke am Bronner Berg, Laupheim Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr Fr., 16.07. Schloss-Apotheke, Obermarchtal Mittwoch 9.00 – 12.00 Uhr Sa., 17.07. Vitalis Apotheke, Ehingen Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr / 15.00 – 17.00 Uhr So., 18.07. Rats-Apotheke, Laupheim Durch Wahrnehmung von Terminen außerhalb des Mo., 19.07. Apotheke Dr. Mack, Rottenacker Rathauses können Sprechzeiten des Bürgermeisters Di., 20.07. Rats-Apotheke, Ehingen entfallen. Wichtige Termine, auch außerhalb der Mi., 21.07. Linden-Apotheke am Sternplatz, Ehingen normalen Sprechzeiten, können jederzeit telefonisch Do., 22.07. Apotheke Dr. Mack, Rottenacker vereinbart werden. Tel. dienstl. 1648 privat 07357/2672 Wir gratulieren zum Geburtstag Ärztlicher Notfalldienst 15.07. Theodor Lamp 74 Jahre Bereitschaftsdienst: Notrufnummer 116 117 19.07. Sieglinde Fesseler 73 Jahre Bereitschaftsdienst-Zeiten: Mo/ Di/ Do: 18.00 – 8.00 Uhr des Folgetages, Mi: 13.00 – 8.00 Uhr des Folgetages, Abfallsammlungen Fr: 16.00 – 8.00 Uhr des Folgetages, Sa/ So/ Feiertage: 8.00 – 8.00 Uhr des Folgetages. Hausmüll: Mittwoch, 21.07. Öffnungszeiten Notfallpraxis im Kreiskrankenhaus Ehingen (gegenüber Information am Haupteingang) Termine auf einen Blick Sa, So, Feiertage (auch 24./31.12.) 8.00 – 22.00 Uhr. Kirchengemeinde und Landfrauen Unterstadion Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Terminänderung Seniorenkaffee vor der Kirche An Werktagen ist die Notfallpraxis nicht besetzt. Aufgrund des schlechten Wetters wird der Termin verschoben auf Montag, 19. Juli um 14.30 Uhr Zahnärztlicher Notfalldienst Zu erfragen unter Tel . -

Obermarchtal
MUNDERKINGEN OBERMARCHTAL OBERSTADION EMERINGEN EMERKINGEN Stuttgart A8 Munderkingen Ulm A81 A8 GRUNDSHEIM B30 München Biberach A96 www.donauschleife.de Memmingen Singen Meersburg Friedrichshafen Wangen HAUSEN AM BUSSEN Lindau DIE DONAUSCHLEIFE Bodensee Marktstraße 7 89597 Munderkingen LAUTERACH Telefon 07393 598-300 Telefax 07393 598-260 [email protected] RECHTENSTEIN www.donauschleife.de ROTTENACKER UNTERMARCHTAL UNTERSTADION Ishchenko Alexander A7606369, Dieses Projekt wurde von der LEADER Aktionsgruppe Oberschwaben gefördert. Panthermedia 01144821, Marcus Bosch Marcus 01144821, Panthermedia Panthermedia Panthermedia UNTERWACHINGEN Europäischer Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER): Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete. NEUES ENTDECKEN DER ERLEBNIS Erlebnis Donauschleife Grundsheim DonauschleifeEingebettet im Herzen von Oberschwaben und der Schwäbischen Alb liegt die Inhalt Seite 2/3 Seite 18/19 Donauschleife in einer der abwechslungsreichsten Regionen Deutschlands. Regionales sehen und erleben Hausen am Bussen Erleben Sie dabei in den Gemeinden an der Donauschleife eine nahezu Seite 4/5 Seite 20/21 unberührte und vielfältige Naturlandschaft wie aus dem Bilderbuch. Überregionales sehen und erleben Lauterach Seite 6/7 Seite 22/23 Munderkingen Rechtenstein Eigenwillig und faszinierend erstreckt sich die Donauschleife durch Wiesen, Seite 8/9 Seite 24/25 Felder, Städte und Gemeinden als Naturwahrzeichen der Region. Für Natur- Obermarchtal Rottenacker Seite 10/11 Seite 26/27 liebhaber, Genießer