Deutscher Bundestag Drucksache 18/8131 18
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lorbeer Und Sterne
Thema: Strittige Arzneimittelstudien AMERIKA HAT GEWÄHLT EUROPA IM DILEMMA Überraschungssieger Trump schockt Der EU-Handelsvertrag Ceta und die Bundestag beschließt Gesetz SEITE 1-3 die Eliten weltweit SEITE 4,5 Tücken der Mitwirkung SEITE 9 Berlin, Montag 14. November 2016 www.das-parlament.de 66. Jahrgang | Nr. 46-47 | Preis 1 € | A 5544 KOPF DER WOCHE Überraschend Wahlsieger Vorrang für die Forschung Donald Trump Er ist einer der spektakulärsten Wahlsieger der US-Geschichte: Der Immobilien- milliardär und Republikaner Donald Trump siegte GESUNDHEIT Bundestag erweitert Möglichkeiten für klinische Arzneimittelstudien an Demenzkranken bei der Präsidenten- wahl gegen die aller- meisten Vorhersagen eichskanzler Otto von Bis- über die favorisierte marck (1815-1898) soll demokratische Geg- mal gesagt haben, je weni- nerin Hillary Clinton. ger die Leute davon wüss- Der oft polternde ten, wie Würste und Geset- Trump hatte sich im ze gemacht werden, desto Wahlkampf als An- besserR könnten sie schlafen. Das Bonmot walt der von der Glo- stammt allerdings aus einer Zeit, als die balisierung bedrohten parlamentarischen und demokratischen © picture-alliance/dpa und „vergessenen“ Gepflogenheiten in Deutschland noch un- Amerikaner profiliert und dabei auch illegale Im- terentwickelt waren. Heute wird bei der migranten und Muslime mit scharfen Worten ins Gesetzgebung meist auf eine breite Beteili- Visier genommen. Wofür er letztlich innen- und gung und Transparenz geachtet, allerdings außenpolitisch steht, blieb unklar. In jedem Fall kommt es vor, dass -

Deutscher Bundestag
Deutscher Bundestag 44. Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 27.Juni 2014 Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 4 Entschließungsantrag der Abgeordneten Caren Lay, Eva Bulling-Schröter, Dr. Dietmar Bartsch, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. zu der dritten Beratung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur grundlegenden Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und zur Änderung weiterer Bestimmungen des Energiewirtschaftsrechts - Drucksachen 18/1304, 18/1573, 18/1891 und 18/1901 - Abgegebene Stimmen insgesamt: 575 Nicht abgegebene Stimmen: 56 Ja-Stimmen: 109 Nein-Stimmen: 465 Enthaltungen: 1 Ungültige: 0 Berlin, den 27.06.2014 Beginn: 10:58 Ende: 11:01 Seite: 1 Seite: 2 Seite: 2 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Stephan Albani X Katrin Albsteiger X Peter Altmaier X Artur Auernhammer X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Julia Bartz X Günter Baumann X Maik Beermann X Manfred Behrens (Börde) X Veronika Bellmann X Sybille Benning X Dr. Andre Berghegger X Dr. Christoph Bergner X Ute Bertram X Peter Beyer X Steffen Bilger X Clemens Binninger X Peter Bleser X Dr. Maria Böhmer X Wolfgang Bosbach X Norbert Brackmann X Klaus Brähmig X Michael Brand X Dr. Reinhard Brandl X Helmut Brandt X Dr. Ralf Brauksiepe X Dr. Helge Braun X Heike Brehmer X Ralph Brinkhaus X Cajus Caesar X Gitta Connemann X Alexandra Dinges-Dierig X Alexander Dobrindt X Michael Donth X Thomas Dörflinger X Marie-Luise Dött X Hansjörg Durz X Jutta Eckenbach X Dr. Bernd Fabritius X Hermann Färber X Uwe Feiler X Dr. Thomas Feist X Enak Ferlemann X Ingrid Fischbach X Dirk Fischer (Hamburg) X Axel E. -

Plenarprotokoll 18/240
Plenarprotokoll 18/240 Deutscher Bundestag Stenografscher Bericht 240. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 22. Juni 2017 Inhalt: Gedenken an Bundeskanzler a. D. Dr. Helmut Elisabeth Scharfenberg (BÜNDNIS 90/ Kohl DIE GRÜNEN) ...................... 24489 A Präsident Dr. Norbert Lammert ........... 24479 A Hermann Gröhe, Bundesminister BMG ..... 24491 B Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Harald Weinberg (DIE LINKE) ........... 24493 A nung. 24530 D Dr. Karl Lauterbach (SPD) ............... 24493 D Absetzung der Tagesordnungspunkte 13, 14 c, 14 d und 15 b. 24484 A Nadine Schön (St. Wendel) (CDU/CSU) .... 24495 A Mechthild Rawert (SPD). 24496 B Zur Geschäftsordnung ................. 24484 B Erich Irlstorfer (CDU/CSU) .............. 24497 A Petra Crone (SPD) ...................... 24498 A Tagesordnungspunkt 7: a) – Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Ent- Tagesordnungspunkt 8: wurfs eines Gesetzes zur Reform der a) Unterrichtung durch die Bundesregie- Pfegeberufe (Pfegeberufereformge- rung: Bericht zur Umsetzung der High- setz – PfBRefG) tech-Strategie – Fortschritt durch For- Drucksachen 18/7823, 18/12847 ..... 24484 C schung und Innovation – Stellungnahme – Bericht des Haushaltsausschusses ge- der Bundesregierung zum Gutachten mäß § 96 der Geschäftsordnung zu Forschung, Innovation und techno- logischer Leistungsfähigkeit Deutsch- Drucksache 18/12848 ............. 24484 C lands 2017 b) Beschlussempfehlung und Bericht des Drucksache 18/11810 ................ 24499 C Ausschusses für Gesundheit zu dem Antrag -

Antragsheft 2
6. Parteitag, 2. Tagung und Bundesvertreterinnen- und Bundesvertreterversammlung der Partei DIE LINKE Bonn, 22. bis 24. Februar 2019 Antragsheft 2 Inhaltsverzeichnis Materialien für die 2. Tagung des 6. Parteitags Anträge ................................................................................................... Seite 7 Anträge mit überwiegendem Bezug zur Gesellschaft ............... Seite 9 Anträge mit überwiegendem Bezug zur Partei .......................... Seite 21 Anträge zur Finanzordnung und Ordnung für die Tätigkeiten der Finanzrevisionskommissionen .......................................... Seite 31 Berichte ................................................................................................... Seite 33 Bericht der Fraktion GUE/NGL ................................................. Seite 35 Bericht des Bundesausschusses ............................................ Seite 45 Bericht des Ältestenrates ........................................................ Seite 49 Bericht der Bundesfinanzrevisionskommission ........................ Seite 53 Materialien für die Vertreterinnen- und Vertreterversammlung Kandidaturen zur Aufstellung der Liste ............................................................ Seite 61 Impressum/Kontakt Bundesgeschäftsstelle der Partei DIE LINKE Kleine Alexanderstr. 28 10178 Berlin www.die-linke.de Redaktionsschluss: 10. Januar 2019 Materialien für die 2. Tagung des 6. Parteitages - Seite 5 - - Seite 6 - Anträge an die 2. Tagung des 6. Parteitages - Seite 7 - - Seite 8 - Anträge mit überwiegendem -

Migration, Integration, Asylum: Political Developments in Germany 2015 Grote, Janne; Müller, Andreas; Vollmer, Michael
www.ssoar.info Migration, Integration, Asylum: Political Developments in Germany 2015 Grote, Janne; Müller, Andreas; Vollmer, Michael Veröffentlichungsversion / Published Version Forschungsbericht / research report Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Grote, J., Müller, A., & Vollmer, M. (2016). Migration, Integration, Asylum: Political Developments in Germany 2015. (Annual Policy Report / Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Forschungszentrum Migration, Integration und Asyl (FZ)). Nürnberg: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Forschungszentrum Migration, Integration und Asyl (FZ); Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Nationale Kontaktstelle für das Europäische Migrationsnetzwerk (EMN). https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-68289-3 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine This document is made available under Deposit Licence (No Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt. Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive, non- Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, transferable, individual and limited right to using this document. persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses This document is solely intended for your personal, non- Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für commercial use. All of the copies of this documents must retain den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. all copyright information and other information regarding legal Auf sämtlichen Kopien dieses -

Nein-Stimmen: 32 Enthaltungen: 13 Ungültige: 0
Deutscher Bundestag 89. Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 27.Februar 2015 Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1 Antrag des Bundesministeriums der Finanzen Finanzhilfen zugunsten Griechenlands; Verlängerung der Stabilitätshilfe Einholung eines zustimmenden Beschlusses des Deutschen Bundestages nach § 3 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 2 Nummer 2 des Stabilisierungsmechanismusgesetzes auf Verlängerung der bestehenden Finanzhilfefazilität zugunsten der Hellenischen Republik Drs. 18/4079 und 18/4093 Abgegebene Stimmen insgesamt: 586 Nicht abgegebene Stimmen: 45 Ja-Stimmen: 541 Nein-Stimmen: 32 Enthaltungen: 13 Ungültige: 0 Berlin, den 27.02.2015 Beginn: 11:05 Ende: 11:10 Seite: 1 Seite: 2 Seite: 2 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Stephan Albani X Katrin Albsteiger X Peter Altmaier X Artur Auernhammer X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Günter Baumann X Maik Beermann X Manfred Behrens (Börde) X Veronika Bellmann X Sybille Benning X Dr. Andre Berghegger X Dr. Christoph Bergner X Ute Bertram X Peter Beyer X Steffen Bilger X Clemens Binninger X Peter Bleser X Dr. Maria Böhmer X Wolfgang Bosbach X Norbert Brackmann X Klaus Brähmig X Michael Brand X Dr. Reinhard Brandl X Helmut Brandt X Dr. Ralf Brauksiepe X Dr. Helge Braun X Heike Brehmer X Ralph Brinkhaus X Cajus Caesar X Gitta Connemann X Alexandra Dinges-Dierig X Alexander Dobrindt X Michael Donth X Thomas Dörflinger X Marie-Luise Dött X Hansjörg Durz X Jutta Eckenbach X Dr. Bernd Fabritius X Hermann Färber X Uwe Feiler X Dr. Thomas Feist X Enak Ferlemann X Ingrid Fischbach X Dirk Fischer (Hamburg) X Axel E. -
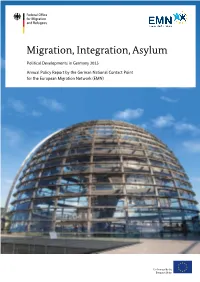
Migration, Integration, Asylum
Migration, Integration, Asylum Political Developments in Germany 2015 Annual Policy Report by the German National Contact Point for the European Migration Network (EMN) Co-financed by the European Union Migration, Integration, Asylum Political Developments in Germany 2015 Annual Policy Report by the German National Contact Point for the European Migration Network (EMN) Federal Office for Migration and Refugees 2016 Summary 5 Summary The German Bundestag passed a number of amendments The 2015 Policy Report of the German National Contact over the course of 2015, which include Point for the European Migration Network (EMN) provides an overview of the most important political dis- ■■ the Act on the redefinition of the right to stay and cussions as well as political and legislative developments the termination of residence (entry into force: in the areas of migration, integration, and asylum in the 1 August 2015), Federal Republic of Germany in the year 2015. The report ■■ Act on the Acceleration of Asylum Procedures – refers specifically to measures taken by the Federal Asylum Package I (entry into force: 24 October 2015), Republic of Germany to implement the Global Approach ■■ Act to improve accommodation, care and assistance to Migration and Mobility, the EU Strategy towards for foreign children and young persons (entry into the Eradication of Trafficking in Human Beings and the force: 1 November 2015), European Agenda for the Integration of Third-Country ■■ Third Victims’ Rights Reform Act (entry into force: Nationals. The report also describes the general struc- 31 December 2015). ture of the political and legal system in Germany. In addition to the legislation of the Bundestag, the Federal Ministry for Labour and Social Affairs (BMAS) revised the The jump in asylum migration and how to deal with it Employment Ordinance (BeschV) in 2015, which forms the was the central migration, integration and asylum issue basis for allowing immigrants in certain occupations and in 2015. -
Musterstimmzettel Wahlkreis 61 Bundestagswahl 2013
Stimmzettel für die Wahl zum Deutschen Bundestag im Wahlkreis 61 Potsdam - Potsdam-Mittelmark II - Teltow-Fläming II am 22. September 2013 Sie haben 2 Stimmen X X hier 1 Stimme hier 1 Stimme für die Wahl für die Wahl eines/einer einer Wahlkreisabgeordneten Landesliste (Partei) - maßgebende Stimme für die Verteilung der Sitze insgesamt auf die einzelnen Parteien - Erststimme Zweitstimme 1 Müller, Norbert DIE LINKE DIE LINKE 1 Student DIE LINKE DIE LINKE Diana Golze, Thomas Nord, Potsdam Dr. Kirsten Tackmann, Harald Petzold, Birgit Wöllert 2 Wicklein, Andrea Sozialdemokratische Sozialdemokratische Partei 2 Dipl.-Ökonomin Partei Deutschlands Deutschlands SPD SPD Dr. Frank-Walter Steinmeier, Dagmar Ziegler, Nuthetal Ulrich Freese, Andrea Wicklein, Stefan Zierke 3 Reiche, Katherina Christlich Christlich Demokratische Union 3 Dipl.-Chemikerin Demokratische Union Deutschlands Deutschlands CDU CDU Michael Stübgen, Katherina Reiche, Luckenwalde Jens Koeppen, Andrea Voßhoff, Hans-Georg von der Marwitz 4 Krüger, Jacqueline Freie Freie Demokratische Partei 4 Dipl.-Geoökologin Demokratische Partei FDP FDP Prof. Dr. Martin Neumann, Max Koziolek, Potsdam Jacqueline Krüger, Jörg Rathmer, Alice Magdalena Löning 5 Baerbock, Annalena BÜNDNIS 90/ BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 5 DIE GRÜNEN Völkerrechtlerin GRÜNE/ GRÜNE/ B 90 Annalena Baerbock, Wolfgang Renner, Potsdam B 90 Yvonne Plaul, Gerhard Kalinka, Maria Heider 6 Stein, Florian Nationaldemokra- Nationaldemokratische Partei 6 Verwaltungswissenschaftler tische Partei Deutschlands Deutschlands NPD NPD Klaus Beier, Stella Hähnel, Ronny Zasowk, Schöneiche bei Berlin Manuela Kokott, Dieter Brose 7 Everding, Cornelius Piratenpartei Piratenpartei Deutschland 7 Deutschland Regierungsdirektor PIRATEN PIRATEN Veit Göritz, Anke Domscheit-Berg, Berlin Christoph Brückmann, Holger Kipp, Dr. Katharina Kühnel DIE REPUBLIKANER 8 REP Heiko Müller, Marc Linde, Peter Kleemann, Uwe Dreyer Marxistisch-Leninistische Partei 9 Deutschlands MLPD Dr. -

European Central Bank Executive Board 60640 Frankfurt Am Main Germany Brussels, 30 August 2017 Confirmatory Application to Th
The European Parliament Fabio De Masi - European Parliament - Rue Wiertz 60 - WIB 03M031 - 1047 Brussels European Central Bank Executive Board 60640 Frankfurt am Main Germany Brussels, 30 August 2017 Confirmatory application to the ECB reply dated 3 August 2017 Reference: LS/PT/2017/61 Dear Sir or Madam, We hereby submit a confirmatory application (Art. 7 (2) ECB/2004/3) based on your reply dated 3 August 2017, in which you fully refused access to the legal opinion “Responses to questions concerning the interpretation of Art. 14.4 of the Statute of the ESCB and of the ECB”. We submit the confirmatory application on the following grounds that the ECB has a legal obligation to disclose documents based on Article 2 (1) ECB/2004/3 in conjunction with Article 15 (3) TFEU. Presumption of the exceptions set out in Article 4 (2) ECB/2004/3 (undermining of the protection of court proceedings and legal advice) and Article 4 (3) ECB/2004/3 (undermining of the deliberation process) is unlawful. 1. Protection of legal advice, no undermining of legitimate interests – irrelevance of intentions, future deliberations and ‘erga omnes’ effects In your letter you state, “In the case at hand, public release of the legal opinion – which was sought by the ECB’s decision-making bodies and intended exclusively for their information and consideration – would undermine the ECB’s legitimate interest in receiving frank, objective and comprehensive legal advice. This especially so since this legal advice was not only essential for the decision-making bodies to feed -
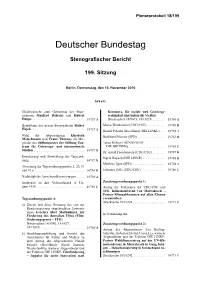
Plenarprotokoll 18/199
Plenarprotokoll 18/199 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 199. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 10. November 2016 Inhalt: Glückwünsche zum Geburtstag der Abge- Kommerz, für soziale und Genderge- ordneten Manfred Behrens und Hubert rechtigkeit und kulturelle Vielfalt Hüppe .............................. 19757 A Drucksachen 18/8073, 18/10218 ....... 19760 A Begrüßung des neuen Abgeordneten Rainer Marco Wanderwitz (CDU/CSU) .......... 19760 B Hajek .............................. 19757 A Harald Petzold (Havelland) (DIE LINKE) .. 19762 A Wahl der Abgeordneten Elisabeth Burkhard Blienert (SPD) ................ 19763 B Motschmann und Franz Thönnes als Mit- glieder des Stiftungsrates der Stiftung Zen- Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/ trum für Osteuropa- und internationale DIE GRÜNEN) ..................... 19765 C Studien ............................. 19757 B Dr. Astrid Freudenstein (CDU/CSU) ...... 19767 B Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Sigrid Hupach (DIE LINKE) ............ 19768 B nung. 19757 B Matthias Ilgen (SPD) .................. 19769 A Absetzung der Tagesordnungspunkte 5, 20, 31 und 41 a ............................. 19758 D Johannes Selle (CDU/CSU) ............. 19769 C Nachträgliche Ausschussüberweisungen ... 19759 A Gedenken an den Volksaufstand in Un- Zusatztagesordnungspunkt 1: garn 1956 ........................... 19759 C Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD: Klimakonferenz von Marrakesch – Pariser Klimaabkommen auf allen Ebenen Tagesordnungspunkt 4: vorantreiben Drucksache 18/10238 .................. 19771 C a) -

Auszug Aus Dem Plenarprotokoll 18/155
Textrahmenoptionen: 16 mm Abstand oben Plenarprotokoll 18/155 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 155. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 18. Februar 2016 Inhalt: Glückwünsche zum Geburtstag der Abgeord- Dr. Gerhard Schick (BÜNDNIS 90/ neten Dr. Ernst Dieter Rossmann, Bernhard DIE GRÜNEN) ................... 15214 A Schulte-Drüggelte, Dr. Karl Lamers und Christian Petry (SPD) .................. 15215 B Alois Gerig .......................... 15201 A Dr. Frank Steffel (CDU/CSU) ............ 15216 D Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- nung. 15201 B Absetzung der Tagesordnungspunkte 5 und Zusatztagesordnungspunkt 2: 14. 15201 D Antrag der Abgeordneten Monika Lazar, Luise Nachträgliche Ausschussüberweisungen ... 15202 A Amtsberg, Volker Beck (Köln), weiterer Abge- ordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Demokratie stärken – Dem Hass Tagesordnungspunkt 4: keine Chance geben Drucksache 18/7553 ................... 15218 B Erste Beratung des von der Bundesregie- rung eingebrachten Entwurfs eines Ersten Dr. Anton Hofreiter (BÜNDNIS 90/ Gesetzes zur Novellierung von Finanz- DIE GRÜNEN) ..................... 15218 B marktvorschriften auf Grund europäischer Marian Wendt (CDU/CSU) .............. 15219 D Rechtsakte (Erstes Finanzmarktnovellie- rungsgesetz – 1. FiMaNoG) Katja Kipping (DIE LINKE) ............ 15221 D Drucksache 18/7482 ................... 15202 C Uli Grötsch (SPD) ..................... 15223 C Dr. Michael Meister, Parl. Staatssekretär Dr . Volker Ullrich (CDU/CSU) ........... 15224 D BMF ............................ -

Deutscher Bundestag Beschlussempfehlung Und Bericht
Deutscher Bundestag Drucksache 18/1948 18. Wahlperiode 01.07.2014 Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung (1. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeordneten Irene Mihalic, Dr. Konstantin von Notz, Luise Amtsberg, Volker Beck (Köln), Frank Tempel, Jan Korte, Ulla Jelpke, Martina Renner, Jan van Aken, Agnes Alpers, Kerstin Andreae, Annalena Baerbock, Dr. Dietmar Bartsch, Marieluise Beck (Bremen), Herbert Behrens, Karin Binder, Matthias W. Birkwald, Heidrun Bluhm, Dr. Franziska Brantner, Agnieszka Brugger, Christine Buchholz, Eva Bulling-Schröter, Roland Claus, Sevim Da÷delen,Dr.DietherDehm,EkinDeligöz,KatMaDörner,KatharinaDröge, Harald Ebner, Klaus Ernst, Dr. Thomas Gambke, Matthias Gastel, Wolfgang Gehrcke, Kai Gehring, Katrin Göring-Eckardt, Diana Golze, Annette Groth, Dr. Gregor Gysi, Heike Hänsel, Dr. André Hahn, Anja Hajduk, Britta Haßelmann, Dr. Rosemarie Hein, Inge Höger, Bärbel Höhn, Dr. Anton Hofreiter, Andrej Hunko, Sigrid Hupach, Dieter Janecek, Susanna Karawanskij, Kerstin Kassner, Uwe Kekeritz, Katja Keul, Sven-Christian Kindler, Katja Kipping, Maria Klein-Schmeink, Tom Koenigs, Sylvia Kotting-Uhl, Jutta Krellmann, Oliver Krischer, Stephan Kühn (Dresden), Christian Kühn (Tübingen), Renate Künast, Katrin Kunert, Markus Kurth, Caren Lay, Monika Lazar, Sabine Leidig, Steffi Lemke, Ralph Lenkert, Michael Leutert, Stefan Liebich, Dr. Tobias Lindner, Dr. Gesine Lötzsch, Thomas Lutze, Nicole Maisch, Peter Meiwald, Cornelia Möhring, Niema Movassat, Beate Müller-Gemmeke, Özcan Mutlu, Thomas Nord, Omid Nouripour, Cem Özdemir, Friedrich Ostendorff, Petra Pau, Lisa Paus, Harald Petzold (Havelland), Richard Pitterle, Brigitte Pothmer, Tabea Rößner, Claudia Roth (Augsburg), Corinna Rüffer, Manuel Sarrazin, Elisabeth Scharfenberg, Ulle Schauws, Dr. Gerhard Schick, Michael Schlecht, Dr. Frithjof Schmidt, Kordula Schulz-Asche, Dr. Petra Sitte, Kersten Steinke, Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn, Hans-Christian Ströbele, Dr.