Modulkatalog Für Die Studienvariante „Recht Und Wirtschaft“ (LL.B.)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Akkreditierungakkreditierung
Z 12916 F Postvertriebsstück Entgelt bezahlt Wienands PrintMedien GmbH hlb Linzer Straße 140 Hochschullehrerbund e.V. 53604 Bad Honnef ISSN 0340-448 x Band 44 G Heft 5 G Okt. 2003 Die neue Hochschule für anwendungsbezogene Wissenschaft und Kunst AKKREDITIERUNGAKKREDITIERUNG I Hans-Jürgen Brackmann Akkreditierung I Lothar Schüssele Qualitätssicherung durch Akkreditierung I Nikolas P. Sokianos Akkreditierung zum Master of Science I H. F. Binner Systematische Qualitätsentwicklung I Mathias Graumann Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle I Herman Blom Managementparadoxien NACHRICHTEN G MEINUNGEN G BERICHTE Die Riester-Rente Das Versorgungsniveau sinkt Private Vorsorge wird immer wichtiger Ab dem 1. Januar 2003 gilt, dass sich die Versorgungsbezüge bei den Besoldungs- und Versorgungsanpassungen in den 8 Jah- ren von 2003 bis 2010 abflachen. Hierzu werden die jährlichen Steigerungen von Besoldung und Versorgung jeweils abge- senkt. Somit würden die aktiven und die Ruhestandsbeamten zum Beispiel bei einer Erhöhung der Bezüge um 2% nur rund 1,6 % erhalten. Änderungen der Beamtenversorgung ab 2003 G Senkung des Versorgungsniveaus auf 71,75% G Senkung des Steigerungssatzes auf 1,79375 % G Senkung der Hinterbliebenenversorgung auf 55 % Der hlb hat mit der Bayerischen Beamten Lebensversicherung (BBV) ein Riester-Renten-Angebot für hlb-Mitglieder ausge- arbeitet, das eine höhere Rente als ein Einzelvertrag garantiert. Das hlb-Modell sieht einen konstanten Beitrag in der Höhe vor, der gesetzlich erst für 2008 vorgeschrieben ist. Der Vorteil: Höhere -

Genealogische Betrachtungen Der Jüdischen Familien in Bergheim/Erft
Genealogien der Bergheimer Jüdischen Familien Unter Einbeziehung der jüdischen Einwohner aus denn ehemaligen Gemeinden Büsdorf, Glessen, Fliesteden, Kenten, Niederaussem, Oberaussem, Paffendorf , Quadrath, Ichendorf und Zieverich. Sefer Sikaron Das Buch der Erinnerung an die ehemaligen Juden der heutigen Bügermeisterei Bergheim, Paffendorf und Hüchelhoven. Ihre Seelen seien eingebunden im Bündel des Lebens Gerd Friedt, München 2013 Alle Rechte vorbehalten. Fotomechanische Wiedergabe auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verfassers. Nachdruck verboten. Copyright Inhaltsverzeichniss Vorwort Einleitung Juden seit 1603 in Bergheim Juden 1799 – 1801 in Bergheim und Nachbarorten Namensannahme der Juden in Paffendorf 1808 Hausvorstände 1810 Juden 1815 im heutigen Stadtgebiet von Bergheim Hausvortsände 1847 Juden in der Bürgermeisterei Paffendorf 1849 Steuerpflichtige Juden 1876 Juden im Adressbuch 1898 Juden in Adressbuch 1911 Juden in Adressbuch 1934 Beschneidungen im Raume Bergheim Beschreibung der Stammtafeln / Description Familie Ajacoby, Bergheim Familie Baum, Heidt, Lucas, Paffendorf u. Niederaussem Familie Blum; Kenten Familie Brünell, Oberaussem Familie Cohen I, Bergheim- Kenten Familie Harff und Fleck Einschub Familie Cohen II, Bergheim-Kenten Familie Cohen III und Schallenberg, Kenten Familie Cohen IV, Bergheim Familie Cohen / Cahn V, Bergheim und Quadrath Familie Dahl, Bergheim Familie Falk, Bergheim Familie Heumann Büsdorf Familie Levy; Bergheim Familie Levi / Gordon, Bergheim Familie Horn in Bergheim und Niederembt -

Die Bundeswehr Im War for Talent Welches Erfolgspotential Hat Die Youtube-Serie „Mali“ Für Die Personalgewinnung Der Bundeswehr?
Hochschule Ruhr West in Mülheim an der Ruhr Internationale Wirtschaft - Emerging Markets Die Bundeswehr im War for Talent Welches Erfolgspotential hat die YouTube-Serie „Mali“ für die Personalgewinnung der Bundeswehr? Bachelorthesis zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Arts Eingereicht bei: Erstgutachter: Prof. Dr. phil. Lijun Tang Zweitgutachter: Dipl. Staatswiss. Univ. Rudolf Röhrl Abgabetermin: 2. Januar 2020 Vorgelegt von: Ute Schneider Matrikel-Nummer: 10005316 I Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis ........................................................................................................................ I Abkürzungsverzeichnis ............................................................................................................. II Abbildungsverzeichnis ............................................................................................................. III Anhangsverzeichnis .................................................................................................................. IV 1. Einleitung ............................................................................................................................... 1 2. Theorie ................................................................................................................................... 4 2.1 Der War for Talent und seine Ursachen ......................................................................... 4 2.1.1 Begriffsdefinition und Auslöser des War for Talent ............................................ -

The German Question
Part II The German Question Gorbachev and the GDR 145 Chapter 7 Gorbachev and the GDR Daniel S. Hamilton The German Democratic Republic (GDR) was the illegitimate off- spring of the Cold War, in the words of one writer, the “state that can- not be.”1 Even after forty years of separate existence, the GDR never became a nation; it was never seen as a 1egitimate state by its own people, by West Germans or even by its own superpower patron, the Soviet Union.2 The illegitimate nature of the East German regime proved to be an incurable birth defect. It was also a characteristic that distinguished East Germany from its socialist neighbors. Unlike Polish, Hungarian or Czechoslovak rulers, the GDR regime could not fall back on distinct national traditions or a sense of historical continuity binding its citi- zens to its leaders. The Finnish diplomat Max Jacobson captured the essence of the GDR’s precarious position: The GDR is fundamentally different from all other Warsaw Pact members. It is not a nation, but a state built on an ideological con- cept. Poland will remain Poland, and Hungary will always be Hun- gary, whatever their social system. But for East Germany, main- taining its socialist system is the reason for its existence.3 As J.F. Brown put it, “history has been full of nations seeking state- hood, but the GDR was a state searching for nationhood.”4 This lack of legitimacy afflicted the regime during the entire 40-year existence of the East German state. Without legitimacy, the regime could never consolidate its internal authority or its external stability. -

Kirche Und Kommunikation | Ausgabe 02
sinnstiftermag.de | Kirche und Kommunikation | Ausgabe 02 editorial Sinnstiftermag – zweite Ausgabe Sinnstiftermag ist ein Zusammenschluss von Zeitanalytikern, Werbern, Designern und Fotografen, die von einer gemeinsamen Beobachtung ausgehen: dem enormen Sinnstiftungspotential der alten und neuen Medien. Medien transportieren sinnhafte Inhalte und sind in dieser medialen Funktion vor allem selbst sinnhaft. Sie können gar nicht anders. Damit sind sie religionsproduktiv. In Partnerschaft mit Akteuren aus Kommunikation und Kirche sucht sinnstiftermag nach den Analogien religiöser und medialer Kommunikation. titelstory Wo ist der Ort der Kirche in der Medienarena? Medien sind Bühnen, keine Kanzeln. Und das Publikum sind Einzelne, keine Massen, schreibt Michael Behrent. Medien muss man instrumentalisieren, ohne sie kontrollieren zu wollen. Dabei hat Kirche zur Kenntnis zu nehmen, dass die Medien vielen Menschen Orientierung geben. Kirchliche Kommunikation, so Behrent, muss deshalb nicht nur Seelsorge in Hinblick auf das konkrete Gemeindeleben vor Ort sein, sondern auch permanente Medienkritik. interview Fragen an Professor Dr. Wolfgang Stock Prof. Dr. Wolfgang Stock hat jahrelang als Journalist gearbeitet, u.a. für Die Welt, FAZ und Focus. Er ist zudem Autor einer Biografie über die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Im Interview übt Wolfgang Stock Kritik am TV-Auftritt der katholischen und evangelischen Kirche. file:///D|/1 Webseiten/sinnstifter/ausgabe_02/TMPonwxq7tap9.htm (1 von 31)28.10.2006 00:40:27 sinnstiftermag.de | Kirche und Kommunikation -

Ethnic German Refugees and Expellees in (West) Germany, 1945 - 2008
White 1 Stories of Integration: Ethnic German Refugees and Expellees in (West) Germany, 1945 - 2008 by Janine White Henry Rutgers Scholars A thesis in partial fulfillment of the requirements of the Henry Rutgers Scholars Program Written under the direction of Belinda Davis and Jochen Hellbeck Departments of History and German Rutgers College April 2008 White 2 Table of Contents Introduction...................................................................................................................................3 1. The Flight, Expulsion and Integration of Refugees and Expellees into the Federal Republic of Germany.........................................................................................20 2. Crabwalk: A Literary Perspective on the Story of Flight............................................................42 3. The Contemporary Challenge to Commemorate this Past..........................................................73 4. Two Refugees' Stories of Integration........................................................................................11 Conclusion.................................................................................................................................146 Bibliography..............................................................................................................................153 White 3 Introduction As the Red Army advanced westward and the Allies shifted Europe's borders at the end of World War II, approximately 12-14 million ethnic Germans living throughout Central -

June 26 – 30, 2007 – Berlin, Germany
The German Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons announces: The 14th International Congress of the International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery June 26 – 30, 2007 – Berlin, Germany Final Program 38th Annual Meeting of DGPRÄC 12th Annual Meeting of VDÄPC Deutsche Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen www.ipras2007berlin.com ETHICON and ETHICON ENDO-SURGERY partnering with IPRAS 2007 Berlin and plastic surgeons to bring innovation to aesthetic and reconstructive Table of Contents procedures. Welcoming Messages 04 Committees 08 The Societies: IPRAS, DGPRÄC, VDÄPC 14 Schedule at a Glance 17 Program Overview 18 Tuesday, June 26, 2007 23 Wednesday, June 27, 2007 37 Thursday, June 28, 2007 55 Friday, June 29, 2007 71 Saturday, June 30, 2007 87 Master Classes 95 Company Training Courses 96 National and International Business Meetings 101 Your Posters 102 Aesthetic 103 Body of Work Anti-Aging 104 Burns 104 Inspires Craniofacial 105 Ours Hands 106 Precisely raise flaps Mamma 107 Reconstructive 111 with a device that Research / Experimental 113 simultaneously Tumours 116 cuts and coagulates The Conference Venue 118 using ultrasonic vibration Sponsors 120 Exhibition Overview 121 Social Program 124 JonUsai t our Booth Sightseeing Tours 128 for a anH s-On d e s D at mon n tr io General Information A – Z 133 ofr ou Ne r du wPocs t Maps 138 All information as of June 05, 2007, date of print. 2 3 Dear Colleagues, Dear Colleagues and Friends, the last year was the most diffi cult one in the history of IPRAS. -

Turkish-German Representations of Berlin by Ela Eylem Gezen a Dissertation Submitted in Partial F
Writing and Sounding the City: Turkish-German Representations of Berlin by Ela Eylem Gezen A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Germanic Languages and Literatures) in The University of Michigan 2012 Doctoral Committee: Associate Professor Vanessa Agnew, Co-Chair Associate Professor Kader Konuk, Co-Chair Associate Professor Kerstin Barndt Associate Professor Mark Clague Associate Professor Johannes von Moltke © Ela E. Gezen 2012 Anneme ve Babama ii Acknowledgements Writing this dissertation has been a long journey, which I could not have embarked on and endured without the support of many people and institutions. First I would like to thank my “Doktormütter” Kader Konuk and Vanessa Agnew. Their support, academic and emotional, has been unconditional, invaluable and indispensible. I tremendously benefited from and always admired their ability to identify points at which I needed a push in the right direction—to dig deeper, and to think bigger and further. I could not have done it without them. I am grateful to my committee members. Kerstin Barndt provided encouragement, and advice from the earliest stages to the very end. She has helped me out of dead ends when most needed. Johannes von Moltke was always available to discuss my ideas and work. The clarity and poignancy of his feedback never ceases to impress me. Mark Clague provided encouragement and guidance in listening to and discussing music together, which was greatly appreciated and integral to my analysis. My colleagues and friends at the University of Michigan have helped me to feel at home in Ann Arbor emotionally as well as intellectually. -

Wikipedia Und Geschichtswissenschaft
Thomas Wozniak, Jürgen Nemitz und Uwe Rohwedder (Hrsg.) Wikipedia und Geschichtswissenschaft Wikipedia und Geschichts- wissenschaft Herausgegeben von Thomas Wozniak, Jürgen Nemitz und Uwe Rohwedder ISBN 978-3-11-037634-0 e-ISBN (PDF) 978-3-11-037635-7 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-039871-7 Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative-Commons-Attribution-ShareAlike-3.0-Lizenz. Weitere Informationen finden Sie unter http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data A CIP catalog record for this book has been applied for at the Library of Congress. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar. © 2015 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston Dieses Buch ist als Open-Access-Publikation verfügbar unter www.degruyter.com. Einbandabbildung: By © Ralf Roletschek – Fahrradtechnik und Fotografie (Own work) [FAL, GFDL] Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck ♾ Gedruckt auf säurefreiem Papier Printed in Germany www.degruyter.com In memoriam Peter Haber 1964–2013 Vorwort Als vom23. bis 26.September 2014 in Göttingen der 50.Historikertag stattfand,war dort auch erstmalseine Sektion vertreten, die sich ausschließlich aufdas Thema „Wikipedia und Geschichtswissenschaft – eine Zwischenbilanz“ konzentriert hatte. Die Sektion warlangevorher geplant und beantragt worden, aber im Frühjahr 2014 hatte die breit geführte Debatte um das Seeschlachtenbuch des C.H.Beck-Verlages die Notwendigkeit einer Auseinandersetzungmit der Thematik deutlich gezeigt. Damals fanden sich wörtliche, aber nicht gekennzeichnete, Passagen ausder Wikipedia im 2013 erschienenen Werk „Große Seeschlachten: Wendepunkte der Weltgeschichte vonSalamis bis Skagerrak“ des VerlagesC.H. -

Glauben Zeitgemäß Kommunizieren
Glauben zeitgemäß kommunizieren nur für den persönlichen Gebrauch, nicht zur Veröffentlichung! © Netbreeze - Seite 2 © Prof. Dr. Wolfgang Stock [email protected] Welche Medien sind heute und morgen entscheidend? Seite 2 • Studium der Geschichte und Politischen Wissenschaften in Würzburg und Oxford. Promotion an der Universität Oxford über die Rolle der Länder in der deutschen Europapolitik (Stipendium der „F.A.Z.“). " •! 1988 bis 1996: Frankfurter Allgemeine Zeitung. " •! 1996 bis 1998: Leitender Redakteur der „Berliner Zeitung“. " •! 1998 bis 2001: Politischer Korrespondent von „Focus“ in Bonn/Berlin. " •! 2001 bis 2003: Politik-Chef/Geschäftsführender Redakteur „Welt am Sonntag“. " •! 2003 bis 2004 Chefredakteur des „Medien Tenor-Forschungsberichtes“." •! seit 2005 Kommunikationsberater (Convincet GmbH) in Berlin." •! Universitätsprofessor für Journalistik: # Lehraufträge an der Europa-Universität Viadrina, Frankfurt, und# Evangelischen Hochschule Tabor, Marburg." 2009 - 2011 20 Mio. .. 2010 ..... 24 ...alles vor 12 Monaten noch unvorstellbar! Seite 2 Medien in Deutschland im Vergleich 38 Mio. 30 25 Spiegel & 20 Focus Wikipedia FAZ & SZ & HB & FTD 10 BILD Verbreitung PV lt. WikiWatch Nutzer lt. Forsa •! mehr als 2 Milliarden Aufrufe pro Tag (2010) •! pro Minute werden mehr als 35 Stunden Videomaterial auf die Plattform hochgeladen Warum sterben die gedruckten Tageszeitungen seit 2000 ? 1) Rückgang der Leser 2) Rückgang der Werbung 74% 14-jährig 1995 20-jährig 14-jährig 1985 30-jährig 20-jährig 14-jährig 1975 40-jährig 30-jährig 20-jährig 1965 14-jährig 50-jährig 40-jährig 30-jährig 20-jährig 1955 ! Zeitungsleser nach Alter 60-jährig 50-jährig 40-jährig 30-jährig Jahrgang 1945 Quelle: Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalysen, AWA 1980 - 2008 AWA Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalysen, Quelle: Junge Menschen lesen nicht mehr! Rückgang der Leser junge Leser Rückgang der Werbe-Einnahmen - 50% Paradigmenwechsel in Qualitätsmedien seit 2000 Handelsblatt, 15. -
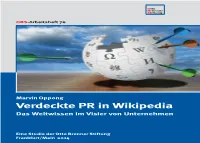
Verdeckte PR in Wikipedia
Otto Brenner Stiftung OBS-Arbeitsheft 76 OBS-Arbeitsheft 76 Verdeckte PR in Wikipedia Marvin Opp0ng Verdeckte PR in Wikipedia Das Weltwissen im Visier von Unternehmen Eine Studie der Otto Brenner Stiftung www.otto-brenner-stiftung.de Frankfurt/Main 2014 Die Otto Brenner Stiftung … Aktuelle Ergebnisse der Forschungsförderung in der Reihe „OBS-Arbeitshefte“ ... ist die gemeinnützige Wissen- zugänglich und veröffentlicht schaftsstiftung der IG Metall. z. B. die Ergebnisse ihrer For- Sie hat ihren Sitz in Frankfurt am schungsförderung in der Reihe OBS-Arbeitsheft 76 Main. Als Forum für gesellschaft- „OBS-Arbeitshefte“. Die Arbeits- liche Diskurse und Einrichtung hefte werden, wie auch alle an- Marvin Opp0ng der Forschungsförderung ist sie deren Publikationen der OBS, Verdeckte PR in Wikipedia OBS-Arbeitsheft 76 dem Ziel der sozialen Gerechtig- kostenlos abgegeben. Über die Das Weltwissen im Visier von Unternehmen ISSN 1863-6934 (Print) keit verpflichtet. Besonderes Homepage der Stiftung können Augenmerk gilt dabei dem Aus- sie auch elektronisch bestellt OBS-Arbeitsheft 75 gleich zwischen Ost und West. werden. Vergriffene Hefte halten Olaf Hoffjann, Jeannette Gusko Herausgeber: wir als PDF zum Download be- ... initiiert den gesellschaftli- reit. Der Partizipationsmythos Otto Brenner Stiftung chen Dialog durch Veranstaltun- Wie Verbände Facebook, Twitter & Co. nutzen Jupp Legrand gen, Workshops und Koopera- … freut sich über jede ideelle Un- tionsveranstaltungen (z. B. im terstützung ihrer Arbeit. Aber OBS-Arbeitsheft 74 Wilhelm-Leuschner-Straße -

Multilevel Networks in British and German Foreign Policy, 1990-95
MULTILEVEL NETWORKS IN BRITISH AND GERMAN FOREIGN POLICY, 1990-95 A Ph.D. Thesis submitted by Elke Krahmann 2000 University of London London School of Economics UMI Number: U127079 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. Dissertation Publishing UMI U127079 Published by ProQuest LLC 2014. Copyright in the Dissertation held by the Author. Microform Edition © ProQuest LLC. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 7 m<£S£ 5 f 7 goo ‘A r ~7166U^ Abstract In the 1990s a consensus has emerged in international relations and foreign policy analysis according to which it has become necessary to move from single-level approaches towards multilevel theorising. The thesis suggests that the network approach is especially suited for the development of a multilevel theory of foreign policy decision-making because it has already been successfully applied to national, transnational and international levels of analysis. The thesis expands the scope of the network approach by proposing a ‘multilevel network theory’ that combines all three levels. Moreover, the thesis addresses the widespread criticism that network models fail to explain the process of decision-making by putting forward testable hypotheses regarding the exercise of pressure and the changing preferences among political actors.