Umsetzungskonzept
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
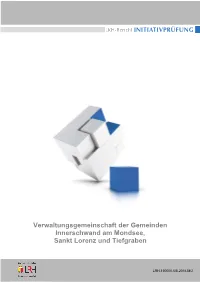
Initiativprüfung Verwaltungsgemeinschaft Der
Verwaltungsgemeinschaft der Gemeinden Innerschwand am Mondsee, Sankt Lorenz und Tiefgraben LRH-150000-6/8-2016-MÜ Auskünfte Oberösterreichischer Landesrechnungshof A-4020 Linz, Promenade 31 Tel.: (+43 732) 7720-11426 Fax: (+43 732) 7720-214089 E-Mail: [email protected] www.lrh-ooe.at Impressum Herausgeber: Oberösterreichischer Landesrechnungshof A-4020 Linz, Promenade 31 Redaktion: Oberösterreichischer Landesrechnungshof Herausgegeben: Linz, im Februar 2016 Verwaltungsgemeinschaft der Gemeinden Innerschwand am Mondsee, Sankt Lorenz und Tiefgraben Februar 2016 INHALTSVERZEICHNIS Kurzfassung ............................................................................................................................ 1 Struktur der drei Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft .......................................... 13 Eckdaten und Lageplan .................................................................................................... 13 Raumordnung und strukturelle Entwicklung ..................................................................... 14 Örtliche Entwicklungskonzepte ................................................................................................. 14 Bodenpolitik und Baulandverfügbarkeit .................................................................................... 15 Vorschreibung von Aufschließungs- und Erhaltungsbeiträgen ................................................. 17 Organisation der Verwaltungsgemeinschaft ..................................................................... 18 Allgemeines ..................................................................................................................... -

Abteilung Gemeinden
Abteilung Gemeinden ¾ Gemeindeaufsicht Sicherstellung der Gesetzmäßigkeit der Gemeindeselbstverwaltung ein- schließlich der Finanzkontrolle ¾ Gemeindefinanzen Umsetzung des Finanzausgleiches durch Zuteilung der Gemeinde- ertragsanteile und sonstiger Finanz- ausgleichsmittel Gewährung projektbezogener Bedarfs- zuweisungen ¾ Personenstandswesen Klärung von Rechtsfragen im Personen- standswesen, insbesondere bei Auslandsberührungen Aufsicht über die Standesämter und Vollziehung des Namensrechtes ¾ Staatsbürgerschaftsrecht Durchführung von Verfahren zum Erwerb und Verlust, zur Beibehaltung und Feststellung der österreichischen Staatsbürgerschaft ¾ Wahlen Organisation und Leitung von Wahlen und Bürgerrechtsverfahren aufgrund bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften "Status und Perspektiven der interkommunalen Kooperation aus Sicht der Länder – das Beispiel Oberösterreich" Dr. Michael Gugler Amt der oö. Landesregierung Abt. Gemeinden 1 interkommunale Zusammenarbeit/ Gemeindekooperationen - warum? • Wünsche nach neuen Infrastruktureinrichtungen steigen laufend – in Gemeinden und Städten zunehmend Leistungs- und Kostendruck • finanzielle Rahmenbedingungen ändern sich massiv – Ausgaben steigen – sinkende freie Budgetmittel bei den Gemeinden – Steuereinnahmen nur begrenzt ausweitbar Ausgaben der Gemeinden Ausgaben der Gemeinden in OÖ 2.500 Ausgaben steigen 2.000 Finanz, Wi_ Förd. 1.500 Dienstleistung Straßen, Wasserbau Mio. € 1.000 Soziales, Gesundheit Sozialausgaben Unterricht, Kultur Verwaltung Sicherheit 500 Ausgaben der Gemeinden in OÖ 135 -

Bgbl. Nr. 477/1995
6411 Jahrgang 1995 Ausgegeben am 21. Juli 1995 151. Stück 477. Übereinkommen zum Schutz der Alpen (Alpenkonvention) samt Anlage (NR: GP XVm RV 1022 AB 1344 S. 150. BR: AB 4719 S. 579.) 477. Der Nationalrat hat beschlossen: 1. Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages samt Anlage wird genehmigt. 2. Dieser Staatsvertrag ist im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG durch Erlassune von Gesetzen zu erfüllen. ÜBEREINKOMMEN ZUM SCHUTZ DER sind im Gefolge der Ergebnisse der ersten ALPEN (ALPENKONVENTION) Alpenkonferenz der Umweltminister vom 9. bis l I.Oktober 1989 in Berchtesgaden wie folgt Die Bundesrepublik Deutschland, übereingekommen : die Französische Republik, die Italienische Republik, das Fürstentum Liechtenstein, Artikel l die Republik Österreich, Anwendungsbereich die Schweizerische Eidgenossenschaft, die Republik Slowenien sowie (1) Gegenstand dieses Übereinkommens ist das die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft — Gebiet der Alpen, wie es in der Anlage beschrieben im Bewußtsein, daß die Alpen einer der größten und dargestellt ist. zusammenhängenden Naturräume Europas und ein (2) Jede Vertragspartei kann bei der Hinterle- durch seine spezifische und vielfältige Natur, Kultur gung ihrer Ratifikations-, Annahme- oder Geneh- und Geschichte ausgezeichneter Lebens-, Wirt- migungsurkunde oder jederzeit danach durch eine schafts-, Kultur- und Erholungsraum im Herzen an die Republik Österreich als Verwahrer gerichtete Europas sind, an dem zahlreiche Völker und Länder Erklärung die Anwendung dieses Übereinkommens' teilhaben, auf weitere Teile -

SALZBURG- Austria GERMANY
320000 330000 340000 350000 360000 370000 380000 12°40'0"E 12°50'0"E 13°0'0"E 13°10'0"E 13°20'0"E 13°30'0"E Oichten Hilprechtsham Burgkirchen Schweiber EU TARANIS 2013 Activation ID: EMSN-005 Trostberg Kirchberg bei Mattighofen Kolming Thalhausen Eglsee Unterweiß au Product N.: 01 Salzburg, v1 Gumperding Aug Zipf Engertsham Abtenham Trimmelkam Schönberg Wendling Oberweißau Riedersbach Rudersberg Teichstätt Höcken SALZBURG- Austria 0 Dorfbeuern Bergham 0 0 Weilham Pietling Bergham 0 0 Michaelbeuern Scherschham Schneegattern 0 0 Hinterbuch 0 Bach Friedburg Mittererb Fornach 2 Breitenlohe 2 EU TARANIS 2013 N Krenwald " 3 Palting Untererb 3 0 5 Törring Ainhausen 5 ' Lindach Altenmarkt an der Alz Vorau Sankt Ulrich Pfaffing 0 Wildshut ° Sankt Pantaleon Reith REFERENCE Map - Overview 8 Palling Intenham Holz Kühbichl 4 Perw ang am Grabensee Fridolfing Lochen am See Lengau Forstern Production date: 25/06/2013 Lauterbach Stullerding Czech Republic Tengling Au Feldbach Ameisberg Bergham Berndorf bei Salzburg Utzweih Plain N Fasanenjäger Sankt Georgen bei Salzburg " Burg Vöcklamarkt 0 Anning Berndorf bei Salzburg ' Slovakia Lamprechtshausen 0 Germ any Reitsberg Pinswag Igelsberg Pöndorf ° Stein an der Traun Stein Schwöll 8 Offling Kirchham 4 Bürmoos Maierhof Tannberg Brunn Untergeisenfelden Eisping Austr ia Irsing Katzwalchen Untermühlham Hungary St. Georgen Weisbrunn Frankenmarkt Mollstätten Untereching Holzleiten Reitsham Schwaigern Haßmoning Oberwalchen Straßwalchen Steinbach Switzerland Obereching Hainbach Groß enegg Traunreut Altsberg Eck Slovenia -
General Information Mondseeland, Mondsee-Irrsee
Discover the lakes, enjoy the nature. culture & tradition awesome nature hiking paradise GENERAL INFORMATION MONDSEELAND, MONDSEE-IRRSEE www.mondsee.at Familiy holiday DEAR VISITOR CONTENTS Welcome to MondSeeLand, the region around Lakes Mondsee History 04 and Irrsee. MondSeeLand is just a 20-minute drive from the city of Salzburg and is one of the gateways to the Salzkammergut. Pile dwellings: Unesco World Heritage Site 05 Lakes Mondsee and Irrsee are the warmest lakes for bathing in the Salzkammergut region, with water temperatures of up to Unmissable sights 06 27°C/80°F All about MondSeeLand 07 The wide range of leisure activities is one of the region’s great as- sets: we have something for everyone – for families and individual Boat trips on Lake Mondsee 08 guests; for sporting enthusiasts and those in search of peace and relaxation. MondSeeLand has so much to experience, discover and enjoy, not to mention our famous Austrian hospitality. Boat hire 08 We hope you enjoy your stay in MondSeeLand. Swimming / bathing spots 09 Tourismusverband MondSeeLand tourist information team, Sport in MondSeeLand 09 - 11 Mondsee-Irrsee Hiking and hillwalking 11 - 14 Great events 16 IMPRINT: Publisher: Tourismusverband MondSeeLand, Mondsee-Irrsee Pictures: TV MondSeeLand, Oberösterreich Tourismus, Fotografie Schwamberger, Culinary treats 17 Fotostudio Meindl, Foto Weinhäupl, Kuratorium Pfahlbauten Print: Fuchs Druck GmbH All information without guarantee, changes and misprints! Usefull information 18-19 2 3 History Pile dwellings: Unesco World Heritage Site The history of MondSeeLand stretches back 6000 years. Ruins of settlements In the Mondsee, Attersee and Seewalchen communities, you can now visit were found underwater near the banks of Lake Mondsee near Scharfling, and the new information pavilions on the UNESCO WORLD HERITAGE SITE Prehi- a rich array of Neolithic pottery and stone and bone tools were excavated. -

VERKEHRSPROGNOSE ÖSTERREICH 2025+ Endbericht Beschreibung Des Verkehrsmodells (Personenverkehr Und Güterverkehr)
VERKEHRSPROGNOSE ÖSTERREICH 2025+ Endbericht Teil/Kapitel 3 Beschreibung des Verkehrsmodells (Personenverkehr und Güterverkehr) Wien, Juni 2009 Autorenteam VPÖ2025+ TRAFICO - IVWL UNI GRAZ - IVT ETH ZÜRICH - PANMOBILE - JOANNEUM RESEARCH – WIFO Projektleitung: TRAFICO / Verkehrsplanung Käfer GmbH, A-1060 Wien, Fillgradergasse 6/2, T: +43 1 586 41 81, F: +43 1 586 41 81-10, E-Mail: [email protected], www.terminal.co.at Verkehrsprognose Österreich 2025+ Endbericht Auftraggeber: BMVIT, Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie Abt. V / INFRA 5 Internationale Netze und GVP-Ö vertreten durch: Dipl.-Ing. Dr. techn. Thomas Spiegel A-1031 Wien, Radetzkystraße 2 T: +43 1 71162-651104, F: +43 1 71162-1199 M: [email protected] Bearbeiterteam: Käfer A. (Projektleiter) Steininger K. (stellvertretender Projektleiter) Axhausen K. Burian E. Clees L. Fritz O. Fürst B. Gebetsroither B. Grubits C. Huber P. Kurzmann R. Molitor R. Ortis G. Palme G. Peherstorfer H. Pfeiler D. Schönfelder S. Siller K. Streicher G. Thaller O. Wiederin S. Zakarias G. TRAFICO - Verkehrsplanung Käfer GmbH (Konsortialführung) A-1060 Wien, Fillgradergasse 6/2, T: +43 1 586 41 81, F: +43 1 586 41 81-10, M: [email protected] IVWL - Universität Graz, Institut für Volkswirtschaftslehre / Prof. Dr. Karl Steininger A-8010 Graz, Universitätsstraße 15, T: +43 316 380-3451, F: +43 316 380-9520 ETH Zürich - Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme / Prof. K.W. Axhausen CH-8093 Zürich, Hönggerberg, T:+41 1633 3943, F : +41 1633 1057 PANMOBILE - Ingenieurbüro für Verkehrswesen und Infrastrukturplanung A-7000 Eisenstadt, Axerweg 29, T : +43 2682 754 29, F : +43 2682 75 429 JOANNEUM RESEARCH Forschungsges mbH A-8010 Graz, Elisabethstraße 20, T : +43 316 876-1427, F : +43 316 876-1480 WIFO – Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung / Dr. -
Leben in Ober- Österreich
LAND OBERÖSTERREICH Leben in Ober- österreich Zahlenspiegel Ergebnisse der Volkszählung 2001 in Oberösterreich Eine Publikation der Abteilung Statistik beim Land OÖ. Impressum Medieninhaber und Herausgeber: Land Oberösterreich, Abteilung Statistik, Altstadt 30a, 4021 Linz Tel.: +43 (732) 7720-13283 E-Mail: [email protected] Redaktion: Mag. Michael Schöfecker, RR Irmtraud Steidl, Elke Larndorfer Grafik: Presseabteilung / DTP-Center [2005424] Fotos: BilderBox.com, Landespresse Druck: Friedrich VDV, Linz 1. Auflage 2005 Leben in Ober- österreich Zahlenspiegel Ergebnisse der Volkszählung 2001 in Oberösterreich Eine Publikation der Abteilung Statistik beim Land Oberösterreich Volkszählungsdaten als wichtige Entscheidungsgrundlage Die Ergebnisse von Volkszählungen bilden immer wieder umfassende und unverzichtbare Entscheidungsgrundlagen für die Politik. Die Aufarbeitung der Volkszählung 2001 ist nahezu abgeschlossen. Für alle relevanten Lebens- bereiche wird entsprechendes Datenmaterial angeboten. Die vorliegende Broschüre stellt zunächst wich- tige Ergebnisse zur Struktur unserer Bevölkerung und ihrer räumlichen Verteilung in Oberösterreich dar. Diese haben eine weitrei- chende Bedeutung: Basierend auf diesen Ergebnissen werden die Ertragsanteile im Rahmen des Finanzausgleichs zwi- schen Bund, Ländern und Gemeinden, die Zahl der Mandate für Nationalrat, Bundesrat und Landtag oder die Verteilung der Wohnbauförderungsmittel auf die einzelnen Bundesländer berechnet. Weiters beinhaltet die Broschüre Ergebnisse zum Bildungsstand der Bevölkerung, -

Und 2. Mondsee MTB-Challenge (23.06.2018)
32. Mondsee 5-Seen Radmarathon (24.06.2018) und 2. Mondsee MTB-Challenge (23.06.2018) Tour C - 75 km Results by Class 24.06.2018 Rk No Name YoB NOC City Club Time Diff Pace D U40 1 2462 LETZ Philine 1997 GER Bargfeld-Stegen Racing Team WINAX - food artists 2:01:16.3 37.10 km/h 2 2156 FELLNER Victoria 1997 AUT Mondsee RadUNION Salzburg 2:01:35.0 37.00 km/h 3 2472 MITTEREGGER Eva 1994 AUT Schlitters Union Raiffeisen Radteam Tirol 2:05:15.5 35.90 km/h 4 2184 PLANK Claudia 1991 AUT Oberwölz RC Pekomo 2:07:25.1 35.30 km/h 5 2431 EBNER Melanie 1994 AUT Oberalm 2:07:25.4 35.30 km/h 6 1360 SZABÓ Adrienn 1987 HUN Budapest Team FaTe 2:07:34.1 35.30 km/h 7 2185 ROSSI Marion 1985 AUT Hellmonsödt RC ARBÖ SK VÖEST 2:07:34.8 35.30 km/h 8 2186 HÖLLNSTEINER Manuela 1985 AUT St. Georgen im Attergau 2:07:37.9 35.30 km/h 9 2439 SCHMIDT Tamara 1996 AUT Bergheim 1. TTC Innsbruck 2:07:51.0 35.20 km/h 10 2476 STÖGERMAYR Verena 1990 AUT Wolfsegg 2:11:01.4 34.30 km/h 11 1310 ECKERSTORFER Karin 1995 AUT Attnang Team Melasan Sport 2:14:55.3 33.40 km/h 12 2477 STÄBLER Barbara 1985 AUT Eugendorf Team Mohrenwirt 2:15:07.1 33.30 km/h 13 2182 GLANZ Martina 1987 AUT St. Bernhard Frauenhofen ULC Horn 2:16:18.4 33.00 km/h 14 2461 NAGY Szabina 1983 HUN Budapest 575 Team 2:20:51.8 31.90 km/h 15 2194 HESS Julia 1982 AUT Wien 2:23:38.8 31.30 km/h 16 2437 JAHN Michaela 1978 AUT Wien 2:24:27.8 31.10 km/h 17 2475 KORBEL Milica 1984 AUT Wien ÖBB-Produktion GmbH 2:24:37.0 31.10 km/h 18 2324 HERRMANN Markus 1974 GER Erding 2:24:53.2 31.10 km/h 19 2467 LASSACHER Sabrina 1987 AUT Oberwölz -

Wien, Am 18.09.2013 Ausschreibungsunterlage Im
Telekom-Control-Kommission Mariahilfer Straße 77-79 1060 Wien F 1/13 Wien, am 18.09.2013 Ausschreibungsunterlage im Verfahren betreffend einer regionalen Frequenzzuteilung im Frequenzbereich 3,4 - 3,6 GHz F1/13 Ausschreibungsunterlage regionale Frequenzvergabe 3,4-3,6 GHz 1 Inhaltsverzeichnis 1. Rechtliche Rahmenbedingungen .................................................................................... 4 1.1. Innerstaatliche Rahmenbedingungen ........................................................................... 4 1.2. Frequenzzuteilungsverfahren ....................................................................................... 4 1.3. Kollusion ...................................................................................................................... 4 1.4. Aufhebung der Ausschreibung, Einstellung des Verfahrens ......................................... 5 1.5. Frequenzzuteilung ........................................................................................................ 5 1.6. Überlassung von Frequenzen ...................................................................................... 5 1.7. Mitbenutzung nach TKG 2003 ...................................................................................... 5 2. Auktionsgegenstand ....................................................................................................... 6 2.1. Verfügbares Spektrum ................................................................................................. 6 2.2. Nutzungsbeginn und Nutzungsdauer .......................................................................... -

Entwicklung Der Stadt Salzburg
Amt für Stadtplanung und Verkehr Die zukünftige Entwicklung der Stadt Salzburg Räumliches Entwicklungskonzept der Stadt Salzburg REK 2007 Ziele und Maßnahmen | Strukturuntersuchung und Problemanalyse Beschluss des Gemeinderates vom 17.12.2008 Schriftenreihe zur Salzburger Stadtplanung Heft 35 | Textteile Herausgeber Amt für Stadtplanung und Verkehr, Magistrat Stadt Salzburg. Schriftenreihe zur Salzburger Stadtplanung Heft 35 (Textteile) Erscheinungsjahr 2009, 1. Auflage www.stadt-salzburg.at/rek2007 Layout und Grafik Info-Z Druck Laber Druck, 5110 Oberndorf, www.laberdruck.at Räumliches Entwicklungskonzept der Stadt Salzburg REK 2007 Ziele und Maßnahmen Strukturuntersuchung und Problemanalyse Erläuterungen zu den Zielen und Maßnahmen Textteile Beschluss des Gemeinderates vom 17.12.2008 Bürgermeister Heinz Schaden Planungsstadtrat Johann Padutsch Mitglieder des Planungsaus- schusses unter Vorsitz von Michael Wanner Projektteam der Magistratsabteilung 5 Raumplanung und Baubehörde Abteilungsvorstand Herbert Lechner Jurist Gerhard Hemetsberger Projektleiter Andreas Schmidbaur Projektkoordination Brigitte Neubauer Allgemeines Funktionskonzept Helene Bernroitner, Brigitte Neubauer Freiraumkonzept Sabine Pinterits Siedlungs- u. Ortsbildkonzept Stephan Kunze Verkehrskonzept Heinz Kloss, Sebastian Tschinder Technisches und soziales Infrastrukturkonzept Josef Reithofer Mit Beiträgen von Michael Buttler Martin Eckschlager Ludwig Graupner Veronika Hirner Hermann Jell Franz Lungelhofer Robert Magoy Reinhard Medicus Manfred Peterbauer Andrea Wirrer Pläne und Statistik Thomas Krechler Hannes Lammerhuber Gerhard Matschl Unter Mitarbeit von Renate Berger Patricia Eigl Evelyn Kastner Brigitte Lindenthaler Andrea Pederiva Martin Philipp Laura Soreanu Georg Sulzberger Renate Wallner-Modesto REK 2007 | Seite 1 Inhalt I Die Grundlagen des REK 2007 . 11 I.A. Das REK als Basis der Gemeindeentwicklung . 11 I.B. Mehr Konsequenz notwendig . 11 I.C. Gesetzliche Verpflichtung, neue Rahmenbedingungen . 13 I.D. Salzburg ist keine Raumordnungs-Insel . 13 I.E. -

LINZER ZEITUNG Folge 17A 19
www.alz.ooe.gv.at AMTLICHE www.land-oberoesterreich.gv.at ALZ LINZER ZEITUNG Folge 17a 19. August 2021 AMTSBLATT FÜR OBERÖSTERREICH SONDERDRUCK 10. Scheiblberger Gertraud, 1966, 23. Zoidl Riccardo, 1988, Radrenn- Landtagsabgeordnete u. Dipl. Ge- fahrer, 4083 Haibach ob der Landeswahlbehörde sundheits- u. Krankenpflegerin, Donau 4150 Rohrbach-Berg für Oberösterreich 24. Reisegger Günther, 1974, Direktor 11. Mag. Aspalter Regina, 1974, Land- Landesmusikschule Mattighofen, Gemäß § 36c der Landtagswahlord- wirtin, BHS-Lehrerin, Landtags- 4984 Weilbach nung in der Fassung des Landesgeset- abgeordnete, 4443 Maria Neustift zes LGBl. Nr. 93/2020 werden die ein- 25. Renner Sandra, 1975, Dipl. Ge- gebrachten und abgeschlossenen 12. Platzer Alexandra, MBA, 1986, Ho- sundheits- u. Krankenpflegerin, Landeswahlvorschläge wie folgt ver- telfachfrau u. Gastronomin, 4600 4892 Fornach öffentlicht: Wels 26. Angerer Julian, 2001, Landes- 13. Mag. Ebner Franz, 1979, Landes- schulsprecher, 4643 Pettenbach geschäftsführer OÖ Senioren- Liste Liste Landeshauptmann bund, Nebenerwerbslandwirt, 27. Mag. Veitschegger Thomas Wolf- ÖVP 1 Thomas Stelzer – OÖVP 4502 St. Marien gang, 1965, Apotheker, 4190 Bad Leonfelden 14. Grünberger Florian, 1980, Unter- 1. Mag. Stelzer Thomas, 1967, Lan- nehmer, 4792 Münzkirchen 28. Berger Walter, 1956, Pensionierter deshauptmann, 4493 Wolfern Lehrer, 4192 Schenkenfelden 15. Haider Johanna, 1970, Landwirtin, 2. Mag. Haberlander Christine, 1981, 4209 Engerwitzdorf Zustellungsbevollmächtigter Landeshauptmann-Stellvertrete- Vertreter: rin, 4470 Enns 16. Dr. Königswieser Tilman, 1968, Dr. Hattmannsdorfer Wolfgang, Arzt, 4563 Micheldorf OÖVP-Landesgeschäftsführer, Com- 3. Dr. Hattmannsdorfer Wolfgang, mendastraße 5, 4040 Linz 1979, OÖVP-Landesgeschäftsfüh- 17. Mayr Verena, 1995, Heeressportle- rer, Landtagsabgeordneter, 4040 rin, Leichtathletik-Mehrkämpfe- Linz rin, 4060 Leonding 4. Mag. Kirchmayr Helena, 1982, 18. Dipl.-Päd. Weber Michael, BEd, Liste FPÖ Oberösterreich – FPÖ Landtagsabgeordnete, 4501 Neu- 1979, Lehrer, 4623 Gunskirchen 2 Dr. -

VEREINBARUNG Nachfolgender Gemeinden
VEREINBARUNG nachfolgender Gemeinden des politischen Bezirkes Braunau am Inn: Altheim, Aspach, Auerbach, Braunau am Inn, Burgkirchen, Eggelsberg, Feldkirchen bei Mattighofen, Geretsberg, Gilgenberg am Weilhart, Haigermoos, Handenberg, Helpfau-Uttendorf, Hochburg-Ach, Höhnhart, Kirchberg bei Mattighofen, Lengau, Lochen am See, Maria Schmolln, Mauerkirchen, Mining, Moosbach, Moosdorf, Munderfing, Neukirchen an der Enknach, Palting, Perwang am Grabensee, Pischelsdorf am Engelbach, Polling im Innkreis, Roßbach, St.Georgen am Fillmannsbach, St.Johann am Walde, St.Pantaleon, St.Radegund, St.Veit im Innkreis, Schalchen, Schwand im Innkreis, Tarsdorf, Treubach, Überackern, Weng im Innkreis; nachfolgender Gemeinden des politischen Bezirkes Gmunden: Altmünster, Bad Goisern, Bad Ischl, Ebensee, Gmunden, Gosau, Grünau im Almtal, Gschwandt, Kirchham, Laakirchen, Obertraun, Ohlsdorf, Pinsdorf, Roitham am Traunfall, Scharnstein, St.Konrad, St.Wolfgang im Salzkammergut., Traunkirchen, Vorchdorf und nachfolgender Gemeinden des politischen Bezirkes Vöcklabruck: Ampflwang im Hausruckwald, Atzbach, Aurach am Hongar, Berg im Attergau, Desselbrunn, Fornach, Frankenburg am Hausruck, Frankenmarkt, Gampern, Innerschwand, Manning, Mondsee, Neukirchen an der Vöckla, Niederthalheim, Nußdorf am Attersee, Oberhofen am Irrsee, Oberndorf b.Schwanenstadt, Oberwang, Ottnang am Hausruck, Pfaffing, Pilsbach, Pitzenberg, Pöndorf, Puchkirchen am Trattberg, Redlham, Regau, Rüstorf, Rutzenham, St.Georgen im Attergau, Sankt Lorenz, Schlatt, Schörfling am Attersee, Steinbach