Raumeinheit Mondseer Flyschberge
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
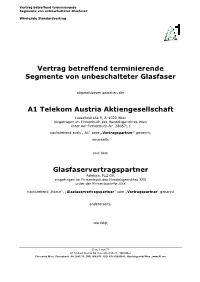
Vertrag Betreffend Terminierende Segmente Von Unbeschalteter Glasfaser
Vertrag betreffend terminierende Segmente von unbeschalteter Glasfaser Wholesale Standardvertrag Vertrag betreffend terminierende Segmente von unbeschalteter Glasfaser abgeschlossen zwischen der A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft Lassallestraße 9, A-1020 Wien eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien unter der Firmenbuch-Nr. 280571 f nachstehend auch „ A1“ oder „Vertragspartner“ genannt, einerseits und dem Glasfaservertragspartner Adresse, PLZ Ort eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichtes XXX unter der Firmenbuch-Nr.XXX nachstehend „Name“, „Glasfaservertragspartner” oder „Vertragspartner“ genannt andererseits, wie folgt Seite 1 von 71 A1 Telekom Austria AG ; Lassallestraße 9 ; 1020 Wien Firmensitz Wien ; Firmenbuch - Nr. 280571f ; DVR: 0962635 ; UID: ATU 62895905 ; Handelsgericht Wien ; www.A1.net Vertrag betreffend terminierende Segmente von unbeschalteter Glasfaser Version 04.03.2015 Allgemeiner Teil Allgemeiner Teil 1. Grundsätzliches Der vorliegende Rahmenvertrag von A1 stützt sich auf den Bescheid M 1.5/2012-135 der Telekom-Control-Kommission vom 28.07.2014. Der Vertrag richtet sich an Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes und/oder öffentlichen Telekommunikationsdienstes im Sinne von § 3 Z1, Z2, Z3 und Z 21 TKG 2003, die die Bereitstellung ihres öffentlichen Telekommunikationsnetzes und/oder öffentlichen Telekommunikationsdienstes gemäß § 15 TKG 2003 bei der Regulierungsbehörde angezeigt haben oder gemäß § 133 (4) TKG 2003 über eine Bestätigung der Konzessionsurkunde verfügen und die vertragsgegenständlichen -
Salzkammergut Wintercard 2020/21 English
WINTER CARD 2020/21 ATTERSEE-ATTERGAU AUSSEERLAND BAD ISCHL DACHSTEIN FUSCHLSEEREGION MONDSEE-IRRSEE TRAUNSEE-ALMTAL WOLFGANGSEE WINTERCARD AT A GLANCE You can find all partner enterprises of the Salzkammergut Card listed according to destinations on the following pages: Benefits with the card: Up to 25% discount on museums, swimming pools/wellness facilities, Overview of partner businesses listed according to topics 4 horse-drawn carriage rides, salt mines, ski rental, ski schools, shopping and other Attergau - Attersee Holiday Region - Salzkammergut 6 - 7 leisure time and sports activities. Ausseerland Holiday Region - Salzkammergut 8 - 12 Available: Bad Ischl - Salzkammergut 12 - 17 Free of charge if you stay at least three nights and issued by all tourist Dachstein Holiday Region - Salzkammergut 17 - 18 information offices and information points of the Salzkammergut. Permanent campers, second-home owners and locals can buy the Card at the regular price of Fuschlsee Holiday Region - Salzkammergut 19 - 20 EUR 4.90. Holiday Region Mondsee-Irrsee - Salzkammergut 20 - 21 Holiday Region Traunsee-Almtal - Salzkammergut 21 - 26 Valid: Period: 01 November 2020 to 30 April 2021 Holiday Region Wolfgangsee - Salzkammergut 26 - 28 Guests can enjoy the advantages offered by the Salzkammergut Winter Card for Salzburg and Salzburg Surroundings 28 - 30 the entire duration of their stay. For locals and owners of second homes, the Card Featured Ski Areas 32 - 38 is valid for 21 days from the issue date. The Card is personalised and non-transferable. The Card is only valid once the back is completed in full. Children under 14 do not need their own card. They can take advantage of the reduced rates when accompanied by an adult with a Winter Card. -

Ingenieurgeologie 61
Ingenieurgeologie 61 INGENIEURGEOLOGIE Von Gerhard Forstinger Auf Anregung von Frau Dr. G. Th. Mayer wurde versucht, eine möglichst um- fassende Liste der unveröffentlichten Arbeiten aus dem Bereich der ange- wandten Geologie (Baugeologie, Hydrogeologie, Rohstoffgeologie, Umwelt- geologie) für den Zeitraum von 1980 - 1990 zu erstellen. Da ein Erfolg dieses Vorhabens zum Großteil von der Auskunftsbereitschaft der im oberösterreichi- schen Raum arbeitenden selbstständigen Geologen abhängt und darüber hinaus keine Möglichkeit besteht, tatsächlich alle Selbstständigen, Ingenieurbüros und Institutionen zu eruieren, die ingenieurgeologisch in diesem Raum tätig waren, muß damit gerechnet werden, daß die nachfolgende Liste mit Sicherheit unvollständig ist. Rückblickend auf den Zeitraum vor 1980 soll hier noch auf die große Anzahl unveröffentlichter angewandt-geologischer Arbeiten der oberösterreichischen Autoren Prof. Dr. J. SCHADLER, Linz, Prof. Dr. F. WIESER, Linz, Univ. -Doz. Dr. H. HÄUSLER, Linz, Univ. -Doz. Dr. H. KOHL, Linz und Dr. E. HEHENWARTER, Traunkirchen hingewiesen wer- den, deren umfangreiche Archive wertvolle Daten enthalten. Eine ausführliche Literaturliste mit großen Anteilen unveröffentlichter Arbeiten aus dem Bereich der Hydrogeologie bis 1973 ist zu finden in: VOHRYZKA,K. , 1973: Hydro- geologie von Oberösterreich. - Amt der oö. Landesregierung, 80 S. Seit 1978 ist der Bereich der Ingenieurgeologie als eigene Fachrichtung in die Österreichische Ingenieurkammer integriert und somit deren Gesetzen und Befugniseinteilungen unterworfen. -

SALZBURG- Austria GERMANY
320000 330000 340000 350000 360000 370000 380000 12°40'0"E 12°50'0"E 13°0'0"E 13°10'0"E 13°20'0"E 13°30'0"E Oichten Hilprechtsham Burgkirchen Schweiber EU TARANIS 2013 Activation ID: EMSN-005 Trostberg Kirchberg bei Mattighofen Kolming Thalhausen Eglsee Unterweiß au Product N.: 01 Salzburg, v1 Gumperding Aug Zipf Engertsham Abtenham Trimmelkam Schönberg Wendling Oberweißau Riedersbach Rudersberg Teichstätt Höcken SALZBURG- Austria 0 Dorfbeuern Bergham 0 0 Weilham Pietling Bergham 0 0 Michaelbeuern Scherschham Schneegattern 0 0 Hinterbuch 0 Bach Friedburg Mittererb Fornach 2 Breitenlohe 2 EU TARANIS 2013 N Krenwald " 3 Palting Untererb 3 0 5 Törring Ainhausen 5 ' Lindach Altenmarkt an der Alz Vorau Sankt Ulrich Pfaffing 0 Wildshut ° Sankt Pantaleon Reith REFERENCE Map - Overview 8 Palling Intenham Holz Kühbichl 4 Perw ang am Grabensee Fridolfing Lochen am See Lengau Forstern Production date: 25/06/2013 Lauterbach Stullerding Czech Republic Tengling Au Feldbach Ameisberg Bergham Berndorf bei Salzburg Utzweih Plain N Fasanenjäger Sankt Georgen bei Salzburg " Burg Vöcklamarkt 0 Anning Berndorf bei Salzburg ' Slovakia Lamprechtshausen 0 Germ any Reitsberg Pinswag Igelsberg Pöndorf ° Stein an der Traun Stein Schwöll 8 Offling Kirchham 4 Bürmoos Maierhof Tannberg Brunn Untergeisenfelden Eisping Austr ia Irsing Katzwalchen Untermühlham Hungary St. Georgen Weisbrunn Frankenmarkt Mollstätten Untereching Holzleiten Reitsham Schwaigern Haßmoning Oberwalchen Straßwalchen Steinbach Switzerland Obereching Hainbach Groß enegg Traunreut Altsberg Eck Slovenia -

Geologische Übersicht
_ _ _ _ _ _ Geologische Übersicht Schwarzenberg Klaffer Ulrichsberg 3 Julbach Aigen-Schlägl Nebelberg St. Oswald Peilstein Leopoldschlag Kollerschlag Lichtenau Oepping Windhaag Kristallin Rohrbach-Berg St. Stefan-Afiesl Haslach Oberkappel Rainbach Molasse Freinberg Sarleinsbach Sandl Flysch Reichenthal Vorderweißenbach Grünbach Kalkalpin Atzesberg Esternberg Helfenberg 13 Auberg B.Leonfelden Liebenau Schardenberg Pfarrkirchen Arnreit Vichtenstein St. Peter 5 Hörbich Waldburg Neustift Freistadt Engelhartszell Putzleinsdorf St. Oswald Weitersfelden Wernstein St. Johann Legende: 19 Lembach Neufelden Schenkenfelden Hirschbach St. Roman Altenfelden Lasberg St. Ulrich Brunnenthal Oberneukirchen Münzkirchen 22 Reichenau Kaltenberg Hofkirchen Zwettl Niederkappel St. Veit Ottenschlag St. Aegidi Sonnberg Schärding Kleinzell Rainbach St. Leonhard Unterweißenbach Grundwasservorrangflächen Niederwaldk. Kefermarkt Kopfing Waldkirchen Haibach Kirchberg Hellmonsödt Neumarkt Wasserschongebiete (rechtskräftig) Gutau _ Herzogsdorf _ St. Florian Haibach Diersbach Neukirchen St. Martin Kirchschlag Schönau Königswiesen Nr rechtskr. Wasserschongebiet - Kernzone Suben Taufkirchen Natternbach Eidenberg Alberndorf Sigharting Eschenau Enzenkirchen Nr rechtskr. Wasserschongebiet - Randzone St. Agatha St. Gotthard Hagenberg Hartkirchen Gramastetten Altenberg 14 St. Marienk. Unterweitersdorf St. Georgen/W. Pierbach Nr rechtskr. Wasserschongebiet Lichtenberg Pregarten St. Willibald Heiligenberg Aschach BadZell Andorf Gallneukirchen Eggerding 1 Feldkirchen Antiesenhofen -

Physiotherapeutinnen Ohne Vertrag 2021
HINWEIS: Diese Listen finden Sie auch auf unserer Homepage www.oegk.at (Vertragspartner-Service-Therapeutensuche) PhysiotherapeutInnen ohne Vertrag 2021 Wir erlauben uns Sie darauf hinzuweisen, dass Wahltherapeuten nicht verpflichtet sind uns Änderungen mitzuteilen und die Daten daher nicht immer den letzten Stand entsprechen. BRAUNAU Name Straße Ort TelefonNr. 2. TelefonNr. E-Mail Zusatzausbildungen HB weitere Informationen AUER Harald Braunauerstr. 17 4962 Mining 0664/73069927 [email protected] HB AUGUSTIN Barbara Hofstätterstr. 7 5274 Burgkirchen 0699/11876315 [email protected] MLD HB BARTH Christian Weilhartstraße 40 5121 Ostermiething 06278/7117 0179/1204601 [email protected] MLD BARTOSCH-DICK Ursula Auerbach 18 5222 Auerbach 07747/20030 Erwachsenenbobath HB BAUCHINGER Jürgen Salzburgerstr. 120 5280 Braunau 0676/4622327 [email protected] MLD nein BAUER Christian Leithen 12 4933 Wildenau 0680/3256602 [email protected] HB BEINHUNDNER Silvia Pischelsdorf 56 5233 Pischelsdorf 07742/7075 0650/6680212 [email protected] HB BREITENBERGER Christina Davidstraße 17 5145 Neukirchen 0650/9208214 [email protected] Erwachsenenbobath HB BURGSTALLER Christoph Straussweg 7 5211 Friedburg 0660/3160350 [email protected] HB CHRISTL Birgit Dr. Finsterer Weg 6/2 5252 Aspach 0664/9509960 [email protected] Erwachsenenbobath HB siehe auch Ried/I. DAXER Johannes Rieder Hauptstrasse 42 5212 Schneegattern 0677/63156023 [email protected] MLD, Bindegewebsmass. HB DEMM Tanja Mitterweg 1 5230 Mattighofen 0664/2119110 [email protected] Kinderbobath HB siehe auch Linz Stadt und in Neudorf 22 5231 Schalchen DENK Wiebke Mittererb 5 5211 Friedburg 07746/2795 MLD DENK Gertraud Aham 2 4963 St. Peter/Hart 07722/62666 DENK Daniela Kerschham 26 5221 Lochen 0680/2353433 [email protected] MLD HB siehe auch Ried/I. -
General Information Mondseeland, Mondsee-Irrsee
Discover the lakes, enjoy the nature. culture & tradition awesome nature hiking paradise GENERAL INFORMATION MONDSEELAND, MONDSEE-IRRSEE www.mondsee.at Familiy holiday DEAR VISITOR CONTENTS Welcome to MondSeeLand, the region around Lakes Mondsee History 04 and Irrsee. MondSeeLand is just a 20-minute drive from the city of Salzburg and is one of the gateways to the Salzkammergut. Pile dwellings: Unesco World Heritage Site 05 Lakes Mondsee and Irrsee are the warmest lakes for bathing in the Salzkammergut region, with water temperatures of up to Unmissable sights 06 27°C/80°F All about MondSeeLand 07 The wide range of leisure activities is one of the region’s great as- sets: we have something for everyone – for families and individual Boat trips on Lake Mondsee 08 guests; for sporting enthusiasts and those in search of peace and relaxation. MondSeeLand has so much to experience, discover and enjoy, not to mention our famous Austrian hospitality. Boat hire 08 We hope you enjoy your stay in MondSeeLand. Swimming / bathing spots 09 Tourismusverband MondSeeLand tourist information team, Sport in MondSeeLand 09 - 11 Mondsee-Irrsee Hiking and hillwalking 11 - 14 Great events 16 IMPRINT: Publisher: Tourismusverband MondSeeLand, Mondsee-Irrsee Pictures: TV MondSeeLand, Oberösterreich Tourismus, Fotografie Schwamberger, Culinary treats 17 Fotostudio Meindl, Foto Weinhäupl, Kuratorium Pfahlbauten Print: Fuchs Druck GmbH All information without guarantee, changes and misprints! Usefull information 18-19 2 3 History Pile dwellings: Unesco World Heritage Site The history of MondSeeLand stretches back 6000 years. Ruins of settlements In the Mondsee, Attersee and Seewalchen communities, you can now visit were found underwater near the banks of Lake Mondsee near Scharfling, and the new information pavilions on the UNESCO WORLD HERITAGE SITE Prehi- a rich array of Neolithic pottery and stone and bone tools were excavated. -

Generalversammlung 2017 Tätigkeitsberichte Aus Den Sektionen
GENERALVERSAMMLUNG 2017 TÄTIGKEITSBERICHTE AUS DEN SEKTIONEN + FUßBALL + + STOCKSPORT + + TISCHTENNIS + + FRAUENTURNEN + + SKI & RAD + SEKTION FRAUENTURNEN / -GYMNASTIK Ich glaube, dass allen bekannt ist, wie fit unsere Damen sind. Das kommt natürlich nicht von alleine, sondern durch das ständige und vor allem vielseitige Bewegen. Ca. 12 bis 16 Damen besuchen jeden Dienstagabend von 19 bis 20 Uhr unsere Gymnastik nach musikalischen Klängen. Nach kurzer Aufwärmphase beginnen wir spezielle Körperregionen zu stärken, es werden flüssige Bewegungen eingebaut sowie die für die Muskulatur sehr wichtigen Dehnungsphasen durchgeführt um die Beweglichkeit der Gelenke zu verbessern. Es sollen damit Verletzungen bei der Ausübung und Durchführung anderer Sportarten verhindert werden. Durch das Stärken der Muskulatur und das Halten des Gleichgewichtes besteht bei eventuellen Stürzen weniger Gefahr einer schweren Verletzung. Es gibt genügend Gründe unsere Gymnastikstunde zu besuchen. Außerdem kommt der gesellschaftliche Teil bei uns nicht zu kurz! Im Sommer machen wir wöchentlich sehr schöne Ausflüge (ca. 30-40 km) in unserer Umgebung und das erfreulicherweise ohne Verletzungen. Nordic - Walking steht ebenfalls wöchentlich auf dem Programm sowie jährlich 4 bis 5 Ausflüge mit der Gruppe "Almrausch" (heuer Födinger Alm, Maria Plain, Bad Aussee- Koppental). Wir wünschen allen ein schönes Weihnachtsfest und Glück sowie Gesundheit im Jahr 2018! Christa Falkner Die Sektion Frauenturnen des TSV bietet weiter die Teilnahme bei STEP- AEROBIC unter der Leitung -

Zell Am Moos
- Prüfungsbericht der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck über die Einschau in die Gebarung der Gemeinde Zell am Moos 2019-472826 Impressum Medieninhaber: Land Oberösterreich Bahnhofplatz 1, 4021 Linz [email protected] Herausgeber, Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck Gestaltung und Graphik: 4840 Vöcklabruck, Sportplatzstraße 1-3 Herausgegeben: Linz, im Juli 2020 2 Die Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck hat in der Zeit vom 4. November 2019 bis 17. Dezember 2019 durch 3 Prüfungsorgane gemäß § 105 Oö. Gemeindeordnung 1990 (Oö. GemO 1990) in Verbindung mit § 1 der Oö. Gemeindeprüfungsordnung 2019 eine Einschau in die Gebarung der Gemeinde Zell am Moos vorgenommen. Zur Prüfung wurden die Jahre 2016 bis 2018 und der Voranschlag für das Jahr 2019 herangezogen. Der Bericht analysiert die Gebarungsabwicklung der Gemeinde Zell am Moos und beinhaltet Feststellungen im Hinblick auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verwaltung, der öffentlichen und sozialen Einrichtungen und unterbreitet Vorschläge zur Verbesserung des Haushaltsergebnisses. Die im Bericht kursiv gedruckten Passagen stellen die Empfehlungen der Bezirkshaupt- mannschaft Vöcklabruck dar und sind als solche von den zuständigen Organen der Gemeinde Zell am Moos umzusetzen. 3 Inhaltsverzeichnis KURZFASSUNG ................................................................................................................... 6 DETAILBERICHT ................................................................................................................11 DIE GEMEINDE .................................................................................................................................... -

Naturraumkartierung Oberösterreich
Naturraumkartierung Oberösterreich Landschaftserhebung Gemeinde Straß im Attergau Endbericht Naturraumkartierung Oberösterreich Landschaftserhebung Gemeinde Straß im Attergau Endbericht Kirchdorf an der Krems, März 2005 Projektleitung: Kurt Rußmann Projektbetreuung: Martina Auer, Günter Dorninger Auftragnehmer: coopNATURA Büro für Ökologie und Naturschutz Kremstalstraße 77 3500 Krems Bearbeitung: Claudia Ott, Barbara Thurner, Johann Pfeiler. im Auftrag des Landes Oberösterreich, Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ Redaktion: Marlies Aigner, Martina Auer, Günter Dorninger, Kurt Rußmann Fotos der Titelseite: Claudia Ott Foto links: Bach nördlich von Straß mit klarem Wasser; Brunnenkresseflur, in Ufergehölz und Bachstaudenflur mit Pestwurz eingebettet. Foto Mitte: Altes Hofgebäude in Powang. Foto rechts: Schön ausgebildetes Bachgehölz nördlich von Straß, reich an verschiedenen Weidenarten, teils schöne Altbäume. Impressum: Medieninhaber: Land Oberösterreich Herausgeber: Amt der O ö. Landesregierung Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich 4560 Kirchdorf an der Krems Tel.: +43 7582 685 533 Fax: +43 7582 685 399 E-Mail: [email protected] Herstellung: Eigenvervielfältigung Kirchdorf a. d. Krems, 2005 © Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung oder Verwertung bleiben dem Land Oberösterreich vorbehalten Landschaftserhebung Straß im Attergau Inhaltsverzeichnis 1. VORBEMERKUNGEN 1 1.1. Allgemeines 1 1.2. Beschreibung des Bearbeitungsgebietes 1 2. BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILGEBIETE 5 2.1. Teilgebiet 1: Flachwelliges Hügelland mit Acker-Grünlandnutzung 7 2.2. Teilgebiet 2: Geschlossenes Waldgebiet über Flysch 9 2.3. Teilgebiet 3: Reliefierte Moränenlandschaft mit hohem Grünlandanteil 11 3. ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG 13 3.1. Überblick 13 3.2. Begründung für die Gliederung in Teilgebiete 13 3.3. Landwirtschaftliche Nutzung 14 3.4. Strukturelemente 14 3.5. Flur- und Siedlungsformen 15 3.6. Statistik 16 3.7. Zusammenfassung landschaftliche Besonderheiten 18 3.8. -

Die Alte Straße Von Vöcklabruck Nach Mondsee. A
©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter www.biologiezentrum.at Die alte Straße von Vöcklabruck nach Mondsee. A. Die Teilstrecke von Vöcklabruck nach St. Georgen i. A. Von Herbert Jandaurek. In dem vom Verfasser in den,, Oberösterreichischen Heimatblättern1)" veröffentlichten Beitrag über die Römerstraße zwischen Wels und Vöckla= brück wurde unter anderem eine Straßentrasse besprochen, die von Puch= heim über Schloß Wagrain am linken Ufer der Vöckla läuft und beim Vöcklbauer den Fluß überschreitet. Der Weiterverlauf wurde nach Ober= thalheim angenommen. Von hier führt nach der alten Katastralmappe ein gerader, schmaler Weg an den Häusern von Straß vorbei gegen die Haltestelle Ober= thalheim der Bahnlinie Vöcklabruck—Kammer. Dieser Weg, ehedem eine Straße, wurde durch den Bahnbau zum Großteil zerstört. Knapp nach der Haltestelle sehen wir einen auffallend großen, säulenartigen, gemauerten Bildstock, der in der Weggabel zwischen der nach Timelkam führenden Bundesstraße und einem Fahrweg steht, der in der Verlängerung des vor= hin erwähnten Weges nach Südwesten verläuft. Dieser Fahrweg heißt, wie so viele andere alte Straßen, Mitterweg. Berlinger, der ehe* malige, bereits verstorbene Schulleiter von Timelkam, hat den beschriebe= nen Fahrweg als Römerstraße angesprochen2). Schnurgerade führt dieser Weg eineinhalb Kilometer bis zur Dürren Ager, die hier durch einen bogenförmigen Einbruch den Fahrweg aus seiner geraden Richtung verdrängt und dieser nun erzwungenermaßen im Bogen nach Obergalla= berg führt. Die beschriebene Trasse wird in der Grenzbeschreibung des Josephini= sehen Katasters der Katastralgemeinde Pichlwang gegenüber Timelkam als Alte Poststraße (Parzelle 841 der Kat.=Gem. Pichlwang) und spä= ter als M i 11 e r w e g bezeichnet. Das Joseph. Lagebuch der Kat.=Gem. -

Gemeindeliste Sortiert Nach Gemeindekennziffer, Gebietsstand 2015 Erstellt Am: 21.05.2015 14:29:08
Gemeindeliste sortiert nach Gemeindekennziffer, Gebietsstand 2015 Erstellt am: 21.05.2015 14:29:08 Gemeinde Gemeinde PLZ des Gemeindename Status weitere Postleitzahlen kennziffer code Gem.Amtes 10101 Eisenstadt 10101 SS 7000 10201 Rust 10201 SS 7071 10301 Breitenbrunn am Neusiedler See 10301 M 7091 10302 Donnerskirchen 10302 M 7082 10303 Großhöflein 10303 M 7051 10304 Hornstein 10304 M 7053 2491 10305 Klingenbach 10305 7013 10306 Leithaprodersdorf 10306 2443 10307 Mörbisch am See 10307 7072 10308 Müllendorf 10308 7052 10309 Neufeld an der Leitha 10309 ST 2491 10310 Oggau am Neusiedler See 10310 M 7063 10311 Oslip 10311 7064 10312 Purbach am Neusiedler See 10312 ST 7083 10313 Sankt Margarethen im Burgenland 10313 M 7062 10314 Schützen am Gebirge 10314 7081 10315 Siegendorf 10315 M 7011 10316 Steinbrunn 10316 M 7035 2491 10317 Trausdorf an der Wulka 10317 7061 10318 Wimpassing an der Leitha 10318 2485 10319 Wulkaprodersdorf 10319 M 7041 10320 Loretto 10320 M 2443 10321 Stotzing 10321 2443 10322 Zillingtal 10322 7034 7033 7035 10323 Zagersdorf 10323 7011 10401 Bocksdorf 10401 7551 10402 Burgauberg-Neudauberg 10402 8291 8292 10403 Eberau 10403 M 7521 7522 10404 Gerersdorf-Sulz 10404 7542 7540 10405 Güssing 10405 ST 7540 7542 10406 Güttenbach 10406 M 7536 10407 Heiligenbrunn 10407 7522 10408 Kukmirn 10408 M 7543 10409 Neuberg im Burgenland 10409 7537 10410 Neustift bei Güssing 10410 7540 10411 Olbendorf 10411 7534 10412 Ollersdorf im Burgenland 10412 M 7533 8292 Q: STATISTIK AUSTRIA 1 / 58 Gemeindeliste sortiert nach Gemeindekennziffer, Gebietsstand