Entwicklung Der Stadt Salzburg
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
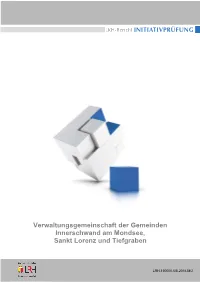
Initiativprüfung Verwaltungsgemeinschaft Der
Verwaltungsgemeinschaft der Gemeinden Innerschwand am Mondsee, Sankt Lorenz und Tiefgraben LRH-150000-6/8-2016-MÜ Auskünfte Oberösterreichischer Landesrechnungshof A-4020 Linz, Promenade 31 Tel.: (+43 732) 7720-11426 Fax: (+43 732) 7720-214089 E-Mail: [email protected] www.lrh-ooe.at Impressum Herausgeber: Oberösterreichischer Landesrechnungshof A-4020 Linz, Promenade 31 Redaktion: Oberösterreichischer Landesrechnungshof Herausgegeben: Linz, im Februar 2016 Verwaltungsgemeinschaft der Gemeinden Innerschwand am Mondsee, Sankt Lorenz und Tiefgraben Februar 2016 INHALTSVERZEICHNIS Kurzfassung ............................................................................................................................ 1 Struktur der drei Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft .......................................... 13 Eckdaten und Lageplan .................................................................................................... 13 Raumordnung und strukturelle Entwicklung ..................................................................... 14 Örtliche Entwicklungskonzepte ................................................................................................. 14 Bodenpolitik und Baulandverfügbarkeit .................................................................................... 15 Vorschreibung von Aufschließungs- und Erhaltungsbeiträgen ................................................. 17 Organisation der Verwaltungsgemeinschaft ..................................................................... 18 Allgemeines ..................................................................................................................... -

Bürgerhaus Müllner Hauptstraße 28 Pdf, 519 KB
BÜRGERHÄUSER IN SALZBURG Editorial Geschichten hinter der Geschichte Die Auszeichnung „Weltkulturerbe“ wurde der Altstadt von Salzburg im Jahr 1996 von der UNESCO verliehen. Kirchliche und weltliche Bauten aus vielen Jahrhunderten, an beiden Ufern der Salzach gelegen und von den Stadtbergen umrahmt, bilden das einzigartige Salzburger Welterbe-Ensemble; fast tausend Gebäude mit ihrer Historie vom Mittelalter bis Heute gehören dazu. Hinter den Fassaden dieser Häuser stecken oft erstaunliche Geschichten, die beweisen, dass Tradition höchst lebendig ist - und immer schon in Bewegung war: Das kulturelle Erbe ist zugleich Teil unserer Gegenwart, und der sorgsame Umgang damit prägt unser Selbstverständnis als Stadt. Ich lade Sie herzlich ein, das Salzburger Weltkulturerbe im Heute zu erleben und auf den folgenden Seiten die „Geschichten hinter der Geschichte“ zu entdecken! The Old Town of Salzburg was granted the distinction “World Cultural Heritage” in 1996 by the UNESCO. Religious and secular buildings from various centuries on both sides of the Salzach, framed by the cities mountains constitute the unique World Heritage ensemble, amongst them up to thousand buildings with their history from the medieval times to this day. Surprising stories hide behind their facade, which show tradition is alive and has always been in motion. Our cultural heritage is also part of our present and treating it with care is important to us. I invite you cordially to experience the Salzburg World Heritage today and discover the “stories behind the story”. Heinz Schaden, Bürgermeister der Stadt Salzburg/Mayor of City Salzburg Ein Haus in Mülln In der Vorstadt am Wasser Das Haus Müllner Hauptstraße 28/Bärengässchen 14 steht im Herzen von Mülln – in jenem nördlich an das historische Zentrum Salzburgs anschließenden Stadtteil. -

Adventivflora Einer Mitteleuropäischen Stadt Am Beispiel Von
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Sauteria-Schriftenreihe f. systematische Botanik, Floristik u. Geobotanik Jahr/Year: 2004 Band/Volume: 13 Autor(en)/Author(s): Schröck Christian, Pilsl Peter, Stöhr Oliver, Nowotny Günther, Blaschka Albin, Kaiser Roland Artikel/Article: Adventivflora einer mitteleuropäischen Stadt am Beispiel von Salzburg (Österreich)- Vorstellung eines laufenden Projektes der Salzburger Botanischen Arbeitsgemeinschaft 347-363 © Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at Sauteria 13, 2004 Beiträge zur Flora von Salzburg 347-363 Adventivflora einer mitteleuropäischen Stadt am Beispiel von Salzburg (Österreich) - Vorstellung eines laufenden Projektes der Salzburger Botanischen Arbeitsgemeinschaft The alien flora of a Central European town demonstrated by the example of Salzburg (Austria) - presentation of a current project of the botanical working group from Salzburg Christian S c h r ö c k , Peter P i l s l , Oliver S t ö h r , Günther N o w o tn y , Albin Blaschka & Roland K a is e r Schlagwörter: Salzburg-Stadt, Österreich, Rasterkartierung, Adventivpflanzen, Neophyten Key words: City of Salzburg, Austria, gridmapping, alien plant species Zusammenfassung: Im Jahre 2002 wurde mit einer Rasterkartierung der Adven tivpflanzen in der Stadt Salzburg begonnen. Als erstes Ergebnis werden Verbreitungskarten von Cotoneaster divaricatus, Geranium purpureum, Iberis umbellata -

Abteilung Gemeinden
Abteilung Gemeinden ¾ Gemeindeaufsicht Sicherstellung der Gesetzmäßigkeit der Gemeindeselbstverwaltung ein- schließlich der Finanzkontrolle ¾ Gemeindefinanzen Umsetzung des Finanzausgleiches durch Zuteilung der Gemeinde- ertragsanteile und sonstiger Finanz- ausgleichsmittel Gewährung projektbezogener Bedarfs- zuweisungen ¾ Personenstandswesen Klärung von Rechtsfragen im Personen- standswesen, insbesondere bei Auslandsberührungen Aufsicht über die Standesämter und Vollziehung des Namensrechtes ¾ Staatsbürgerschaftsrecht Durchführung von Verfahren zum Erwerb und Verlust, zur Beibehaltung und Feststellung der österreichischen Staatsbürgerschaft ¾ Wahlen Organisation und Leitung von Wahlen und Bürgerrechtsverfahren aufgrund bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften "Status und Perspektiven der interkommunalen Kooperation aus Sicht der Länder – das Beispiel Oberösterreich" Dr. Michael Gugler Amt der oö. Landesregierung Abt. Gemeinden 1 interkommunale Zusammenarbeit/ Gemeindekooperationen - warum? • Wünsche nach neuen Infrastruktureinrichtungen steigen laufend – in Gemeinden und Städten zunehmend Leistungs- und Kostendruck • finanzielle Rahmenbedingungen ändern sich massiv – Ausgaben steigen – sinkende freie Budgetmittel bei den Gemeinden – Steuereinnahmen nur begrenzt ausweitbar Ausgaben der Gemeinden Ausgaben der Gemeinden in OÖ 2.500 Ausgaben steigen 2.000 Finanz, Wi_ Förd. 1.500 Dienstleistung Straßen, Wasserbau Mio. € 1.000 Soziales, Gesundheit Sozialausgaben Unterricht, Kultur Verwaltung Sicherheit 500 Ausgaben der Gemeinden in OÖ 135 -

Bgbl. Nr. 477/1995
6411 Jahrgang 1995 Ausgegeben am 21. Juli 1995 151. Stück 477. Übereinkommen zum Schutz der Alpen (Alpenkonvention) samt Anlage (NR: GP XVm RV 1022 AB 1344 S. 150. BR: AB 4719 S. 579.) 477. Der Nationalrat hat beschlossen: 1. Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages samt Anlage wird genehmigt. 2. Dieser Staatsvertrag ist im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG durch Erlassune von Gesetzen zu erfüllen. ÜBEREINKOMMEN ZUM SCHUTZ DER sind im Gefolge der Ergebnisse der ersten ALPEN (ALPENKONVENTION) Alpenkonferenz der Umweltminister vom 9. bis l I.Oktober 1989 in Berchtesgaden wie folgt Die Bundesrepublik Deutschland, übereingekommen : die Französische Republik, die Italienische Republik, das Fürstentum Liechtenstein, Artikel l die Republik Österreich, Anwendungsbereich die Schweizerische Eidgenossenschaft, die Republik Slowenien sowie (1) Gegenstand dieses Übereinkommens ist das die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft — Gebiet der Alpen, wie es in der Anlage beschrieben im Bewußtsein, daß die Alpen einer der größten und dargestellt ist. zusammenhängenden Naturräume Europas und ein (2) Jede Vertragspartei kann bei der Hinterle- durch seine spezifische und vielfältige Natur, Kultur gung ihrer Ratifikations-, Annahme- oder Geneh- und Geschichte ausgezeichneter Lebens-, Wirt- migungsurkunde oder jederzeit danach durch eine schafts-, Kultur- und Erholungsraum im Herzen an die Republik Österreich als Verwahrer gerichtete Europas sind, an dem zahlreiche Völker und Länder Erklärung die Anwendung dieses Übereinkommens' teilhaben, auf weitere Teile -

The German Rome
n Roman City n Capital and Residence testant citizens from the city. It was also during his reign that Salzburg was transformed from a Medieval to an Early Baroque The oldest traces of human habitation of what is now the City Following the separation from its motherland, Bavaria, in the city. Private homes were razed to make room for prestigious ar- of Salzburg date from the Middle Paleolithic period. By 15 B.C., 14th century, Salzburg was the capital of an archbishopric, a chitecture and spacious squares meant to display the archbishop’s the Celtic settlements atop the city’s hills were deserted and de- small state within the Holy Roman Empire, and residence of the wealth and status. Wolf Dietrich and his successors hired Italian tailed plans were being drawn up for construction of an exten- archbishop who was simultaneously the head of government of artists to realize these projects. An artistic reorientation took sive Roman community: Iuvavum. At around 45 A.D., Iuvavum this city. Citizen autonomy was limited. The court was the most place at the turn of the 18th century under Johann Ernst von was a largely self-governing municipality; the outlying territory important employer. Merchants who grew wealthy doing busi- Thun, who brought the great Austrian architect Fischer von Er- under its jurisdiction far exceeded the contemporary Province ness with Venice became benefactors who subsidized various lach to Salzburg. The edifices, domes and spires he built in of Salzburg. After Rome pulled out in 488, most of the remai- social welfare facilities and also demanded a say in how the city Austrian Baroque style are still the highlights of the city’s skyline. -
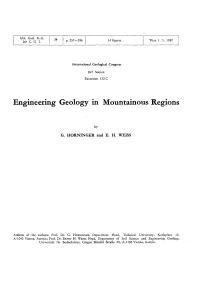
Engineering Geology in Mountainous Regions
Abh. Geol. B.-A. 34 26e C. G. I. p. 257—286 14 figures Wien 1. 5. 1980 International Geological Congress 26th Session Excursion 132 C Engineering Geology in Mountainous Regions by G. HORNINGER and E. H. WEISS Address of the authors: Prof. Dr. G. HORNINGER, Department Head, Technical University, Karlsplatz 13, A-1040 Vienna, Austria; Prof. Dr. ERNST H. WEISS, Head, Department of Soil Science and Engineering Geology, Universität für Bodenkultur, Gregor Mendel Straße 33, A-1180 Vienna, Austria. Introduction window" to the east of the valley, and the overriding western complex of the austro-alpine ötztal gneiss- The basic idea to this excursion is to take the partici mass. The rocks bordering the said overthrust plane are pants to structures that offered special problems, either heavily solicitated, partly down to loamlike ultramylo- to the design or, as in most cases, to construction, last nites (see stop 1.2, Stefansbrücke, pit for brickloam and but not least even to the state of exploitation on grounds gravel pit). Additional solicitations derived from se of long-term security measures and permanent moni condary displacements along parts of the overthrust, toring. i. e. "Silltal fault", dipping under medium angles to the Because of the necessity to fix the final schedule to SW to W. Just in the site area this fault runs exactly this excursion quite early the itinerary in the first line along the morphological valley axis but it is locally had to provide for already completed structures. How covered by recent alluvial deposits of the Sill river. ever, it is expected as well to visit several sites still The fault was not hit by excavation works for the under construction. -

SALZBURG- Austria GERMANY
320000 330000 340000 350000 360000 370000 380000 12°40'0"E 12°50'0"E 13°0'0"E 13°10'0"E 13°20'0"E 13°30'0"E Oichten Hilprechtsham Burgkirchen Schweiber EU TARANIS 2013 Activation ID: EMSN-005 Trostberg Kirchberg bei Mattighofen Kolming Thalhausen Eglsee Unterweiß au Product N.: 01 Salzburg, v1 Gumperding Aug Zipf Engertsham Abtenham Trimmelkam Schönberg Wendling Oberweißau Riedersbach Rudersberg Teichstätt Höcken SALZBURG- Austria 0 Dorfbeuern Bergham 0 0 Weilham Pietling Bergham 0 0 Michaelbeuern Scherschham Schneegattern 0 0 Hinterbuch 0 Bach Friedburg Mittererb Fornach 2 Breitenlohe 2 EU TARANIS 2013 N Krenwald " 3 Palting Untererb 3 0 5 Törring Ainhausen 5 ' Lindach Altenmarkt an der Alz Vorau Sankt Ulrich Pfaffing 0 Wildshut ° Sankt Pantaleon Reith REFERENCE Map - Overview 8 Palling Intenham Holz Kühbichl 4 Perw ang am Grabensee Fridolfing Lochen am See Lengau Forstern Production date: 25/06/2013 Lauterbach Stullerding Czech Republic Tengling Au Feldbach Ameisberg Bergham Berndorf bei Salzburg Utzweih Plain N Fasanenjäger Sankt Georgen bei Salzburg " Burg Vöcklamarkt 0 Anning Berndorf bei Salzburg ' Slovakia Lamprechtshausen 0 Germ any Reitsberg Pinswag Igelsberg Pöndorf ° Stein an der Traun Stein Schwöll 8 Offling Kirchham 4 Bürmoos Maierhof Tannberg Brunn Untergeisenfelden Eisping Austr ia Irsing Katzwalchen Untermühlham Hungary St. Georgen Weisbrunn Frankenmarkt Mollstätten Untereching Holzleiten Reitsham Schwaigern Haßmoning Oberwalchen Straßwalchen Steinbach Switzerland Obereching Hainbach Groß enegg Traunreut Altsberg Eck Slovenia -

VERKEHRSPROGNOSE ÖSTERREICH 2025+ Endbericht Beschreibung Des Verkehrsmodells (Personenverkehr Und Güterverkehr)
VERKEHRSPROGNOSE ÖSTERREICH 2025+ Endbericht Teil/Kapitel 3 Beschreibung des Verkehrsmodells (Personenverkehr und Güterverkehr) Wien, Juni 2009 Autorenteam VPÖ2025+ TRAFICO - IVWL UNI GRAZ - IVT ETH ZÜRICH - PANMOBILE - JOANNEUM RESEARCH – WIFO Projektleitung: TRAFICO / Verkehrsplanung Käfer GmbH, A-1060 Wien, Fillgradergasse 6/2, T: +43 1 586 41 81, F: +43 1 586 41 81-10, E-Mail: [email protected], www.terminal.co.at Verkehrsprognose Österreich 2025+ Endbericht Auftraggeber: BMVIT, Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie Abt. V / INFRA 5 Internationale Netze und GVP-Ö vertreten durch: Dipl.-Ing. Dr. techn. Thomas Spiegel A-1031 Wien, Radetzkystraße 2 T: +43 1 71162-651104, F: +43 1 71162-1199 M: [email protected] Bearbeiterteam: Käfer A. (Projektleiter) Steininger K. (stellvertretender Projektleiter) Axhausen K. Burian E. Clees L. Fritz O. Fürst B. Gebetsroither B. Grubits C. Huber P. Kurzmann R. Molitor R. Ortis G. Palme G. Peherstorfer H. Pfeiler D. Schönfelder S. Siller K. Streicher G. Thaller O. Wiederin S. Zakarias G. TRAFICO - Verkehrsplanung Käfer GmbH (Konsortialführung) A-1060 Wien, Fillgradergasse 6/2, T: +43 1 586 41 81, F: +43 1 586 41 81-10, M: [email protected] IVWL - Universität Graz, Institut für Volkswirtschaftslehre / Prof. Dr. Karl Steininger A-8010 Graz, Universitätsstraße 15, T: +43 316 380-3451, F: +43 316 380-9520 ETH Zürich - Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme / Prof. K.W. Axhausen CH-8093 Zürich, Hönggerberg, T:+41 1633 3943, F : +41 1633 1057 PANMOBILE - Ingenieurbüro für Verkehrswesen und Infrastrukturplanung A-7000 Eisenstadt, Axerweg 29, T : +43 2682 754 29, F : +43 2682 75 429 JOANNEUM RESEARCH Forschungsges mbH A-8010 Graz, Elisabethstraße 20, T : +43 316 876-1427, F : +43 316 876-1480 WIFO – Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung / Dr. -

Luftschutzstollen 1943-1945 Altstadt Salzburg
Luftschutzstollen 1943-1945 Altstadt Salzburg Dr. Gerhard L. FASCHING (1) Exkursion 11 2012 - 09 - 19 PANGEO AUSTRIA 2012 15. – 20. September Exkursion 11 Inhaltsverzeichnis Organisatorische Hinweise ...................................................................................................................................................... 4 1 Von der Militärgeologie über die Wehrgeologie zur Sicherheitsgeologie .......................................................................... 5 2 Luftschutzwesen 1936-1945 in der Stadt Salzburg .............................................................................................................. 5 3 Luftschutzstollen in den Stadtbergen der Stadt Salzburg ................................................................................................... 6 4 Bombenkrieg 1944/1945 in der Stadt Salzburg..................................................................................................................... 8 5 Besichtigungspunkte ........................................................................................................................................................... 10 Literatur ................................................................................................................................................................................... 15 (1) Staatlich befugter u. beeideter Ziviltechniker - Ingenieurkonsulent für Geographie & Allg. beeideter gerichtl. zertifizierter Sachverständiger A-1190 Wien, Krottenbachstraße 189 Tel/Fax +43 – -
Leben in Ober- Österreich
LAND OBERÖSTERREICH Leben in Ober- österreich Zahlenspiegel Ergebnisse der Volkszählung 2001 in Oberösterreich Eine Publikation der Abteilung Statistik beim Land OÖ. Impressum Medieninhaber und Herausgeber: Land Oberösterreich, Abteilung Statistik, Altstadt 30a, 4021 Linz Tel.: +43 (732) 7720-13283 E-Mail: [email protected] Redaktion: Mag. Michael Schöfecker, RR Irmtraud Steidl, Elke Larndorfer Grafik: Presseabteilung / DTP-Center [2005424] Fotos: BilderBox.com, Landespresse Druck: Friedrich VDV, Linz 1. Auflage 2005 Leben in Ober- österreich Zahlenspiegel Ergebnisse der Volkszählung 2001 in Oberösterreich Eine Publikation der Abteilung Statistik beim Land Oberösterreich Volkszählungsdaten als wichtige Entscheidungsgrundlage Die Ergebnisse von Volkszählungen bilden immer wieder umfassende und unverzichtbare Entscheidungsgrundlagen für die Politik. Die Aufarbeitung der Volkszählung 2001 ist nahezu abgeschlossen. Für alle relevanten Lebens- bereiche wird entsprechendes Datenmaterial angeboten. Die vorliegende Broschüre stellt zunächst wich- tige Ergebnisse zur Struktur unserer Bevölkerung und ihrer räumlichen Verteilung in Oberösterreich dar. Diese haben eine weitrei- chende Bedeutung: Basierend auf diesen Ergebnissen werden die Ertragsanteile im Rahmen des Finanzausgleichs zwi- schen Bund, Ländern und Gemeinden, die Zahl der Mandate für Nationalrat, Bundesrat und Landtag oder die Verteilung der Wohnbauförderungsmittel auf die einzelnen Bundesländer berechnet. Weiters beinhaltet die Broschüre Ergebnisse zum Bildungsstand der Bevölkerung, -

Wien, Am 18.09.2013 Ausschreibungsunterlage Im
Telekom-Control-Kommission Mariahilfer Straße 77-79 1060 Wien F 1/13 Wien, am 18.09.2013 Ausschreibungsunterlage im Verfahren betreffend einer regionalen Frequenzzuteilung im Frequenzbereich 3,4 - 3,6 GHz F1/13 Ausschreibungsunterlage regionale Frequenzvergabe 3,4-3,6 GHz 1 Inhaltsverzeichnis 1. Rechtliche Rahmenbedingungen .................................................................................... 4 1.1. Innerstaatliche Rahmenbedingungen ........................................................................... 4 1.2. Frequenzzuteilungsverfahren ....................................................................................... 4 1.3. Kollusion ...................................................................................................................... 4 1.4. Aufhebung der Ausschreibung, Einstellung des Verfahrens ......................................... 5 1.5. Frequenzzuteilung ........................................................................................................ 5 1.6. Überlassung von Frequenzen ...................................................................................... 5 1.7. Mitbenutzung nach TKG 2003 ...................................................................................... 5 2. Auktionsgegenstand ....................................................................................................... 6 2.1. Verfügbares Spektrum ................................................................................................. 6 2.2. Nutzungsbeginn und Nutzungsdauer ..........................................................................