Adventivflora Einer Mitteleuropäischen Stadt Am Beispiel Von
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bürgerhaus Müllner Hauptstraße 28 Pdf, 519 KB
BÜRGERHÄUSER IN SALZBURG Editorial Geschichten hinter der Geschichte Die Auszeichnung „Weltkulturerbe“ wurde der Altstadt von Salzburg im Jahr 1996 von der UNESCO verliehen. Kirchliche und weltliche Bauten aus vielen Jahrhunderten, an beiden Ufern der Salzach gelegen und von den Stadtbergen umrahmt, bilden das einzigartige Salzburger Welterbe-Ensemble; fast tausend Gebäude mit ihrer Historie vom Mittelalter bis Heute gehören dazu. Hinter den Fassaden dieser Häuser stecken oft erstaunliche Geschichten, die beweisen, dass Tradition höchst lebendig ist - und immer schon in Bewegung war: Das kulturelle Erbe ist zugleich Teil unserer Gegenwart, und der sorgsame Umgang damit prägt unser Selbstverständnis als Stadt. Ich lade Sie herzlich ein, das Salzburger Weltkulturerbe im Heute zu erleben und auf den folgenden Seiten die „Geschichten hinter der Geschichte“ zu entdecken! The Old Town of Salzburg was granted the distinction “World Cultural Heritage” in 1996 by the UNESCO. Religious and secular buildings from various centuries on both sides of the Salzach, framed by the cities mountains constitute the unique World Heritage ensemble, amongst them up to thousand buildings with their history from the medieval times to this day. Surprising stories hide behind their facade, which show tradition is alive and has always been in motion. Our cultural heritage is also part of our present and treating it with care is important to us. I invite you cordially to experience the Salzburg World Heritage today and discover the “stories behind the story”. Heinz Schaden, Bürgermeister der Stadt Salzburg/Mayor of City Salzburg Ein Haus in Mülln In der Vorstadt am Wasser Das Haus Müllner Hauptstraße 28/Bärengässchen 14 steht im Herzen von Mülln – in jenem nördlich an das historische Zentrum Salzburgs anschließenden Stadtteil. -

The German Rome
n Roman City n Capital and Residence testant citizens from the city. It was also during his reign that Salzburg was transformed from a Medieval to an Early Baroque The oldest traces of human habitation of what is now the City Following the separation from its motherland, Bavaria, in the city. Private homes were razed to make room for prestigious ar- of Salzburg date from the Middle Paleolithic period. By 15 B.C., 14th century, Salzburg was the capital of an archbishopric, a chitecture and spacious squares meant to display the archbishop’s the Celtic settlements atop the city’s hills were deserted and de- small state within the Holy Roman Empire, and residence of the wealth and status. Wolf Dietrich and his successors hired Italian tailed plans were being drawn up for construction of an exten- archbishop who was simultaneously the head of government of artists to realize these projects. An artistic reorientation took sive Roman community: Iuvavum. At around 45 A.D., Iuvavum this city. Citizen autonomy was limited. The court was the most place at the turn of the 18th century under Johann Ernst von was a largely self-governing municipality; the outlying territory important employer. Merchants who grew wealthy doing busi- Thun, who brought the great Austrian architect Fischer von Er- under its jurisdiction far exceeded the contemporary Province ness with Venice became benefactors who subsidized various lach to Salzburg. The edifices, domes and spires he built in of Salzburg. After Rome pulled out in 488, most of the remai- social welfare facilities and also demanded a say in how the city Austrian Baroque style are still the highlights of the city’s skyline. -
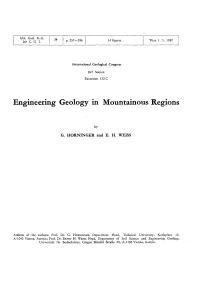
Engineering Geology in Mountainous Regions
Abh. Geol. B.-A. 34 26e C. G. I. p. 257—286 14 figures Wien 1. 5. 1980 International Geological Congress 26th Session Excursion 132 C Engineering Geology in Mountainous Regions by G. HORNINGER and E. H. WEISS Address of the authors: Prof. Dr. G. HORNINGER, Department Head, Technical University, Karlsplatz 13, A-1040 Vienna, Austria; Prof. Dr. ERNST H. WEISS, Head, Department of Soil Science and Engineering Geology, Universität für Bodenkultur, Gregor Mendel Straße 33, A-1180 Vienna, Austria. Introduction window" to the east of the valley, and the overriding western complex of the austro-alpine ötztal gneiss- The basic idea to this excursion is to take the partici mass. The rocks bordering the said overthrust plane are pants to structures that offered special problems, either heavily solicitated, partly down to loamlike ultramylo- to the design or, as in most cases, to construction, last nites (see stop 1.2, Stefansbrücke, pit for brickloam and but not least even to the state of exploitation on grounds gravel pit). Additional solicitations derived from se of long-term security measures and permanent moni condary displacements along parts of the overthrust, toring. i. e. "Silltal fault", dipping under medium angles to the Because of the necessity to fix the final schedule to SW to W. Just in the site area this fault runs exactly this excursion quite early the itinerary in the first line along the morphological valley axis but it is locally had to provide for already completed structures. How covered by recent alluvial deposits of the Sill river. ever, it is expected as well to visit several sites still The fault was not hit by excavation works for the under construction. -

Luftschutzstollen 1943-1945 Altstadt Salzburg
Luftschutzstollen 1943-1945 Altstadt Salzburg Dr. Gerhard L. FASCHING (1) Exkursion 11 2012 - 09 - 19 PANGEO AUSTRIA 2012 15. – 20. September Exkursion 11 Inhaltsverzeichnis Organisatorische Hinweise ...................................................................................................................................................... 4 1 Von der Militärgeologie über die Wehrgeologie zur Sicherheitsgeologie .......................................................................... 5 2 Luftschutzwesen 1936-1945 in der Stadt Salzburg .............................................................................................................. 5 3 Luftschutzstollen in den Stadtbergen der Stadt Salzburg ................................................................................................... 6 4 Bombenkrieg 1944/1945 in der Stadt Salzburg..................................................................................................................... 8 5 Besichtigungspunkte ........................................................................................................................................................... 10 Literatur ................................................................................................................................................................................... 15 (1) Staatlich befugter u. beeideter Ziviltechniker - Ingenieurkonsulent für Geographie & Allg. beeideter gerichtl. zertifizierter Sachverständiger A-1190 Wien, Krottenbachstraße 189 Tel/Fax +43 – -

Entwicklung Der Stadt Salzburg
Amt für Stadtplanung und Verkehr Die zukünftige Entwicklung der Stadt Salzburg Räumliches Entwicklungskonzept der Stadt Salzburg REK 2007 Ziele und Maßnahmen | Strukturuntersuchung und Problemanalyse Beschluss des Gemeinderates vom 17.12.2008 Schriftenreihe zur Salzburger Stadtplanung Heft 35 | Textteile Herausgeber Amt für Stadtplanung und Verkehr, Magistrat Stadt Salzburg. Schriftenreihe zur Salzburger Stadtplanung Heft 35 (Textteile) Erscheinungsjahr 2009, 1. Auflage www.stadt-salzburg.at/rek2007 Layout und Grafik Info-Z Druck Laber Druck, 5110 Oberndorf, www.laberdruck.at Räumliches Entwicklungskonzept der Stadt Salzburg REK 2007 Ziele und Maßnahmen Strukturuntersuchung und Problemanalyse Erläuterungen zu den Zielen und Maßnahmen Textteile Beschluss des Gemeinderates vom 17.12.2008 Bürgermeister Heinz Schaden Planungsstadtrat Johann Padutsch Mitglieder des Planungsaus- schusses unter Vorsitz von Michael Wanner Projektteam der Magistratsabteilung 5 Raumplanung und Baubehörde Abteilungsvorstand Herbert Lechner Jurist Gerhard Hemetsberger Projektleiter Andreas Schmidbaur Projektkoordination Brigitte Neubauer Allgemeines Funktionskonzept Helene Bernroitner, Brigitte Neubauer Freiraumkonzept Sabine Pinterits Siedlungs- u. Ortsbildkonzept Stephan Kunze Verkehrskonzept Heinz Kloss, Sebastian Tschinder Technisches und soziales Infrastrukturkonzept Josef Reithofer Mit Beiträgen von Michael Buttler Martin Eckschlager Ludwig Graupner Veronika Hirner Hermann Jell Franz Lungelhofer Robert Magoy Reinhard Medicus Manfred Peterbauer Andrea Wirrer Pläne und Statistik Thomas Krechler Hannes Lammerhuber Gerhard Matschl Unter Mitarbeit von Renate Berger Patricia Eigl Evelyn Kastner Brigitte Lindenthaler Andrea Pederiva Martin Philipp Laura Soreanu Georg Sulzberger Renate Wallner-Modesto REK 2007 | Seite 1 Inhalt I Die Grundlagen des REK 2007 . 11 I.A. Das REK als Basis der Gemeindeentwicklung . 11 I.B. Mehr Konsequenz notwendig . 11 I.C. Gesetzliche Verpflichtung, neue Rahmenbedingungen . 13 I.D. Salzburg ist keine Raumordnungs-Insel . 13 I.E. -

180215 LD PAP Salzburg Finalxx
LOS_DAMA! WP T1 Pilot Action Plan Framework PILOT ACTION PLAN | SALZBURG Pilot area: Salzburg City and surrounding communities LOS_DAMA! Landscape and Open Space Development in Alpine Metropolitan Areas Priority 3 – Liveable Alpine Space Project duration: 01.11.2016 – 31.10.2019 PILOT ACTION PLAN | Salzburg |1 LOS_DAMA! WP T1 Pilot Action Plan Framework Version Date Author Organisation 2.0 07.07.2017 Guillaume Tournaire GAM 2.1 14.07.2017 Martina van Lierop TUM 2.1.1 14.07.2017 Corinna Jenal EKUT 2.1.2. 14.07.2017 Aurore Meyfroidt UGA 2.2 21.07.2017 Martina van Lierop TUM 2.2.1. 21.07.2017 Aurore Meyfroidt UGA 2.3 26.07.2017 Martina van Lierop TUM 2.3.1 31.07.2017 Christina Stockinger Vienna 4.1 22.11.2017 Guillaume Tournaire GAM 4.2 26.11.2017 Martina van Lierop TUM 5.1 13.12.2017 Guillaume Tournaire GAM 3.1 06.12.2017 Philipp Vesely SIR 5.2 15.02.2018 Philipp Vesely SIR Bernhard Gugg SIR PILOT ACTION PLAN | Salzburg |2 LOS_DAMA! WP T1 Pilot Action Plan Framework Contents Guidelines for the PAP ......................................................................................................................................... 5 1.1 Short description of the overall territory and of local pilot(s) ............................................................ 7 1.2 Challenges in regard to landscape issue and green infrastructure planning and implementation .... 7 1.3 General objectives in LOS_DAMA! at the scale of the local territory ................................................. 7 1.4 Stakeholder process in the project ...................................................................................................... 8 1.5 Strategy and methods to work at local level ....................................................................................... 8 1.6 Main actions with timeline .................................................................................................................. 9 1.7 Milestones of the project(s) ............................................................................................................... -

Diplomarbeit
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Ökosystemare Struktur- und Stoffflussanalyse des Salzburger Mönchsbergs angestrebter akademischer Grad Magistra der Naturwissenschaften (Mag. rer.nat.) Verfasserin: Doris Dicklberger Matrikel-Nummer: 9806116 Studienrichtung (lt. A 444 Ökologie Studienblatt): Betreuerin / Betreuer: Ao. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Maier Wien, am 06.11. 2008 DANKSAGUNG Besonders bedanken möchte ich mich bei Ass.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang Punz für die gute Betreuung und Unterstützung meiner Arbeit. Ebenso gilt mein Dank Univ.-Prof. Dr. Rudolf Maier und dem Department für Ökophysiologie und Funktionelle Anatomie der Pflanzen. Weiters danke ich folgenden Personen für die Bereitstellung von Daten: • Dr. Reinhard Medicus, Naturschutzfachlicher Sachverständiger, Magistrat der Stadt Salzburg • Josef Brawisch, Forst und Jagd Sachbearbeiteter, Magistrat der Stadt Salzburg • Dr. Andreas Falkensteiner, Amt der Salzburger Landesregierung • Univ.-Prof. Mag. Dr. Paul Heiselmayer, Universität Salzburg Meiner gesamten Familie danke ich für ihre Geduld und speziell meinen Eltern gebührt großer Dank für die jahrelange finanzielle Unterstützung, die es mir erst ermöglicht hat dieses Studium erfolgreich abzuschließen. INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG ................................................................................................................................. 7 1.1 FRAGESTELLUNG ...................................................................................................................7 1.2 NATURRAUM MÖNCHSBERG .................................................................................................8 -

Jahrbuch Jahrbuch
JAHRBUCH 20120184 BANDBAND 151584/1– /1–4 4 Geologische Bundesanstalt www.geologie.ac.at Die Geologische Bundesanstalt ist eine Forschungseinrichtung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Topografie: © BEV 2019, vervielfältigt mit Genehmigung des BEV – Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen in Wien, N2019/56883. Alle Rechte für In- und Ausland vorbehalten. Medieninhaber,Medieninhaber, Herausgeber Herausgeber und und Verleger: Verleger: Geologische Geologische Bundesanstalt, Bundesanstalt, Neulinggasse Neulinggasse 38, 38, A 1030 1030 Wien. Wien. Redaktion: Christoph Janda Lektorat: Christian Cermak Verlagsort: Wien Herstellungsort: Wien Ziel des „Jahrbuches der Geologischen Bundesanstalt“ ist die Dokumentation und Verbreitung erdwissenschaftlicher Forschungsergebnisse. Satz,Satz, Gestaltung Gestaltung und und Druckvorbereitung: Druckvorbereitung: Peter Jarmila Ableidinger Böhm im im Auftrag Auftrag der der Geologischen Geologischen Bundesanstalt. Bundesanstalt. Druck:Druck: Holzhausen Paul Gerin Druck GmbH GmbH, & Co WolkersdorfKG, A 2120 Wolkersdorf. im Weinviertel JAHRBUCH DER GEOLOGISCHEN BUNDESANSTALT Jb. Geol. B.-A. ISSN 0016–7800 Band 158 Heft 1–4 S. 1–208 Wien, Dezember 2018 Inhalt Contents SCHRAMM, J.-M.: Ass.-Prof. i.R. Dr. phil. Wolfgang Vetters, SCHRAMM, J.-M.: Ass.-Prof. i.R. Dr. phil. Wolfgang Vetters, Begründer der Kulturgeologie und Geologe aus Leidenschaft Begründer der Kulturgeologie und Geologe aus Leidenschaft (25. Jänner 1944 – 31. Dezember 2017) ................................. 5 (25. Jänner 1944 – 31. Dezember 2017) ................................. 5 SCHÖNLAUB, H.P., HUBMANN, B. & OPPL, K.H.: Neue Fossilfunde SCHÖNLAUB, H.P., HUBMANN, B. & OPPL, K.H.: New fossil discov- im Gailtalkristallin (Kärnten, Österreich) .................................. 23 eries in the Gailtal Cristalline (Carinthia, Austria) .................... 23 SCHÖNLAUB, H.P.: Eine Übersicht über die Devon/Karbon-Gren- SCHÖNLAUB, H.P.: Review of the Devonian/Carboniferous ze in den Karnischen Alpen (Österreich/Italien) ..................... -

What to Do with Your Free Time in Austria
What To Do With Your Free Time in Austria Become one with nature in the beautiful scenery of the Austrian Alps, then stroll through the city streets in Salzburg. There are countless ways to spend your free time in Austria, here are a few of our favorites! Destination Our Suggestion Important Info AUSTRIAN Get active! FREE – $ ALPS Try your hand at hiking, biking and mountain biking through Hours: Dawn to dusk the alps! Obtain hiking maps from the hotel concierge and Location: The breath-taking scenery inquire about cost of bike rentals. begins right outside your hotel! SALZBURG Mirabell Palace and Gardens FREE Now housing the city administration offices, this once Hours: The palace is open 8:00am – elaborate architectural feat still retains its original marble 6:00pm; the gardens are open staircase. The staircase banisters were carved by Raphael 6:00am – dusk Donner and feature hundreds of cherubs that lead to the Location: A short walk from the Marmorsaal. The Marmorsaal, a gold and marble great hall, is historical center, on the eastern used for weddings and special musical events. The palace banks of the Salzach River. The grounds feature the most scenic gardens, fountains, reflecting entrance is next to Landestheater pools and spectacular views of the city. (Schwarzsteinstraße 22). Mozart’s Birthplace $ Home to the child musical prodigy, this historical building is Hours: 9:00am – 5:00pm daily; where Wolfgang Mozart spent his early years. On display are 8:30am – 7:00pm in July and Aug. his violin, a spinet and sheet music from his childhood. Also on Location: No. -

Press Release
PRESS RELEASE Grandiose excursion experience: Hohensalzburg Fortress From the Archbishop's symbol of power to the city's landmarks More than a million people visited the Hohensalzburg Fortress in 2016: This makes it one of the most visited tourist attractions in Austria. In addition to interesting insights into the architectural history of the medieval fortification, including the modern day fortress, offers a wonderful 360-degree panorama of the new "DomQuartier" in the heart of the old town and in the surrounding mountains. Since 2016, the landmark of Salzburg also has a new attraction: The new Magic Theater takes visitors on a journey through the history of the fortress. Also new: an online ticket that saves cash for visitors to the fortress. A journey through the centuries: The Magic Theater In 2016, the fortress has been enriched with a new highlight: In the lovingly designed Magic Theater, visitors to the state rooms go on a fascinating journey through the history of the building. The elaborately designed Magic Theater with its music, light effects and video installations is a multi-sensory experience that draws children and adults alike into its spell. The History of Fortress Hohensalzburg Construction of the fortress on the Festungsberg in Salzburg began in 1077 under Archbishop Gebhard von Helfenstein. The fortification was built to protect the principality and archbishops from assault; however, the fortress never had to put its de- fensive function to the test. It served to demonstrate the power of the archbishops and was rarely used as a place of refuge The history of the fortification from the Roman castle to its modern-day appearance is described in detail in the new, 100- page Fortress Guide. -
ECSG 2019 Bulletin I Ok.Pdf
BULLETIN 1 22nd EUROPEAN COMPANY SPORT GAMES 26. - 30. JUNI/JUNE/JUIN 2019 D FESTIVAL DES SPORTS EN SPORT FESTIVAL FR FESTIVAL DU SPORT Seite / Page INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS / CONTENU 5 Grußworte Foreword / Préface 9 22. Europäische Betriebssportspiele 2019 22nd European Company Sport Games 2019 in Salzburg / 22ème Jeux Européens du Sport d’Entreprise 2019 à Salzbourg 12 Moderne Sportstätten im engen Umkreis Modern sport venues in the immediate vicinity / Installations sportives modernes rapidement accessibles 15 Disziplinen Disciplines / Disciplines 20 Große Auswahl an Hotelbetrieben Large selection of hotels / Grand choix d’établissements hôteliers 22 Salzburg – eine Stadt von Weltformat Salzburg – a world-class city / Salzbourg – une ville de renom international 26 Wo Sport zum genussvollen Vergnügen wird Where sport becomes pure joy / Voilà où le sport devient un vrai plaisir 29 Teilnahmebeitrag Participation fee / Frais de participation 30 Der Weg bis ECSG Salzburg 2019 Getting to ECSG Salzburg 2019 / Préparation aux Jeux de Salzbourg 2019 31 Zentrale Lage – einfache Anreise Central location – easy to reach / Situation centrale – accès facile 2 3 22nd EUROPEAN COMPANY SPORT GAMES 26. - 30. JUNI/JUNE/JUIN 2019 D „Das SalzburgerLand ist ein guter Boden für erfolgreiche Sportler, wie zahlreiche Olympiasieger und Weltmeister beweisen. Das Angebot an Sportstätten ist entsprechend groß und Salzburg damit prädestiniert als Gastgeber für die ECSG Salzburg 2019.“ EN “The Federal State of Salzburg is fertile soil for successful athletes, as our many Olympic medallists and world champions show. There is an accordingly large number of sport venues, making Salzburg the perfect host for the ECSG Salzburg 2019.” FR « Le Land de Salzbourg est un bon terreau pour produire des sportifs qui gagnent, comme le prouvent les nombreux champions olympiques et champions du monde. -

The Leiobunum Rupestre Species Group: Resolving the Taxonomy of Four Widespread European Taxa (Opiliones: Sclerosomatidae)
European Journal of Taxonomy 216: 1–35 ISSN 2118-9773 http://dx.doi.org/10.5852/ejt.2016.216 www.europeanjournaloftaxonomy.eu 2016 · Martens J. & Schönhofer A.L. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License. Research article urn:lsid:zoobank.org:pub:2F526459-E23A-458B-9829-31F4C1BC6C46 The Leiobunum rupestre species group: resolving the taxonomy of four widespread European taxa (Opiliones: Sclerosomatidae) Jochen MARTENS 1,* & Axel L. SCHÖNHOFER 2 1,2 Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Institut für Zoologie, 55099 Mainz, Germany * Corresponding author: [email protected] 2 Email: [email protected] 1 urn:lsid:zoobank.org:author:F01C78F1-5EBF-48E8-B37E-634DF00E0237 2 urn:lsid:zoobank.org:author:91B2971C-D8CE-4F98-903F-C963E83E8C7C Abstract. Within the central European opilionid fauna the widely used species names Leiobunum rupestre Herbst, 1799 and Leiobunum tisciae Avram, 1968 pose taxonomic and distributional problems. In addition, Nelima apenninica Martens, 1969 is close to L. tisciae in terms of external and genital morphology, but is specifi cally distinct. While coxal denticulation is largely lacking in N. apenninica, the validity of the genus Nelima Roewer, 1910 is questioned again. In addition, Leiobunum subalpinum Komposch, 1998, a recently described novelty from the eastern Alps, is closely related to L. rupestre. The four species are combined as the morphologically defi ned Leiobunum rupestre species group. Except for L. subalpinum, they were found to be allopatrically distributed from the Carpathians across central and Northwest Europe to the south-western Alps. The latter species is locally sympatric and partly elevationally parapatric to L. rupestre.