7 Umwandlung Der Justiz in Den Anfangsjahren
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Schauprozesse Genossen Vor Gericht
Zeitzeugen TV und die Bundesstiftung zu Aufarbeitung der SED-Diktatur laden Sie herzlich ein zur Voraufführung: Schauprozesse Genossen vor Gericht Film von Thomas Grimm Eine Koproduktion von Zeitzeugen TV und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg, gefördert von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED Diktatur am Freitag, den 28.11.14, um 20.00 Uhr, in der Akademie der Künste am Pariser Platz. Im Anschluß an den Film findet eine Podiumsdiskussion statt mit dem Regisseur Thomas Grimm, dem Zeitzeugen Juri Elperin, dem Historiker Fabian Thunemann und dem Journalisten Uwe-Karsten Heye. Wir freuen uns auf Ihre Zusage bis zum 24. November 2014 unter [email protected] oder per Fax unter 030 / 449 5956. Schauprozesse – Genossen vor Gericht Unter Stalins Regie findet in den Jahren 1936 bis 1938 die berüchtigten Moskauer Schauprozes- se statt. Stalin nutzt sie für seinen Machterhalt und die Ausschaltung seiner Rivalen. Das Muster der Prozesse ist immer gleich: Die Angeklagten werden unter Folter zu absurden Geständnissen und Reue gezwungen. Originales Archivmaterial der Moskauer Prozesse zeigt die beklemmende Atmosphäre jener Zeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg werden die stalinschen Schauprozesse in die osteuropäischen Staaten exportiert. Die neuen Satellitenstaaten und ihre kommunistischen Parteien sollen auf Moskauer Kurs gebracht werden. So werden 1949 in Budapest mit Laszlo Rajk und 1952 in Prag mit Rudolf Slansky führende Genossen in öffentlichen Prozessen verurteilt und hingerichtet. Auch in der DDR soll ein solcher Schauprozess gegen Paul Merker und andere stattfinden. Doch Stalins Tod und der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 verhindern den Prozess. Auf dem XX. Par- teitag der KPdSU 1956 rechnet der Parteichef Chruschtschow mit Stalins Verbrechen ab; in den Ostblockländern beginnt das sogenannte Tauwetter. -

"... Wir Müssen Alles in Der Hand Haben."
MINISTERIUM UND GESCHICHTE „ ... wir mssen alles in der Hand haben.“ Justizpolitik in der SBZ und der DDR 1945–1954 „ ... wir müssen alles in der Hand haben.“ * Justizpolitik in der SBZ und der DDR 1945–1954 * Ulbricht, Walter (1945) zitiert nach Leonhard, Wolfgang: Die Revolution entläßt ihre Kinder, Köln 1955, S. 440. 5 Vorwort Zentralverwaltung der Justiz (DJV) in den Einsatz von Volksrichtern ebenso der SBZ und das Ministerium der wie die Verflechtungen zwischen Justiz Justiz (MdJ) der DDR allerdings ihr und SED. Weiterhin verdeutlicht die Justiz- und Justizverwaltungspersonal Broschüre, wie sehr die unterschied- gewannen, war nicht Gegenstand des lichen Vorstellungen der Alliierten den „Rosenburg-Projekts“. Diese Lücke Aufbau und die Ausrichtung der Justiz schließt die vorliegende Broschüre. und der Justizverwaltung in den beiden Teilen Deutschlands geprägt haben. Das Wissen um die unterschiedlichen Justizsysteme in beiden deutschen Die Veröffentlichung ist ein wichtiger Staaten und um den unterschiedlichen Beitrag zur historischen und politischen Umgang dieser Systeme mit der ge- Bildung. Ihrem Autor, Herrn Professor meinsamen NS-Vergangenheit ist vor Hubert Rottleuthner, spreche ich allem für Juristinnen und Juristen meinen Dank aus. Ich freue mich, wertvoll. Die politische Einflussnahme dass die Broschüre die von meinem auf das Justizsystem müssen gerade sie Ministerium herausgegebene mit klarem, historisch informiertem Broschürenreihe zur Geschichte des Blick zu beurteilen wissen. Unser Justizressorts um einen wertvollen Rechtsstaat braucht zudem die Unter- Beitrag zur Justizgeschichte ergänzt. Sie halten eine Veröffentlichung über die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit stützung aufgeklärter und aufmerk- die Justizpolitik in der DDR und der in den Justizministerien geben kann. samer Bürgerinnen und Bürger. Das SBZ in den Jahren 1945 - 1954 in den Wissen um die Fehler und Versäumnisse Händen. -
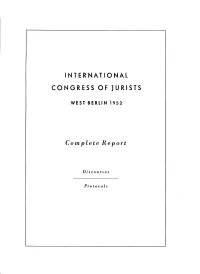
Complete Report
INTERNATIONAL CO N G RESS OF JURISTS WEST BERLIN 1952 Complete Report Discourses Pro tocols Printed by Rudolf Ofto, 63, Lutzowsfrcsse, Berlin W 35, Germony « The first greatINTERNATIONAL CONGRESS OF JURISTSfor the protection of Right against Systematic Injustice was recently held in West Berlin with the cooperation of Delegates from 43 countries, amongst whom were 31 Ministers and Statesmen, 32 Professors, 35 Presidents, Judges and Counsel in High Courts of Justice. The names of these Delegates warrant that the resolutions were passed by the Congress unprejudiced by political questions of the day and after scrupulous examination of the documentary material and the hearing of witnesses. The publication of this report is being done not for propaganda purposes, but with the object of spreading the truth in order to maintain and defend Law against an im minent danger not yet sufficiently understood by the Free World. Published by the International Commission- of Jurists 47, Buitenhof, The Hague, Netherlands Berlin■ Offices: 5, Lindenthaler Allee, Berlin-Zehlendorf-West, Germany i 1/0t f a k e tin likexhp to inform you that the Collection of Documents often referred to in this report as hearing the title “Injustice as a System” is in the original entitled “Injustice the Regime C ontents Page Page Part One: The Development of Public Law in Latvia, by M. C a k ste............................................................ 26 Preparation Legal Development in Estonia, , and Plenary Meetings of Congress by H. Mark ............................! ...................... ................ 27 FOURTH D A Y ................................................................... 30 IDEA AND PREPARATION ....................................... 1 Discussion and adoption of the Resolution of the Committee FIRST PLENARY MEETING...................................... -

Injustice the Regime
INJUSTICE THE REGIME Documentary Evidence of the Systematic Violation of Legal Rights in the Soviet Zone of Germany 1954 — 1958 Verlag fur Internationalen Kulturaustausch Berlin - Zehlendorf - West INJUSTICE THE REGIME Documentary Evidence of the Systematic Violation of Legal Rights in the Soviet Zone of Germany 1954 — 1958 The documents contained herein were selected and compiled under the cooperation of: Constitutional and Administrative Law: Friedrich Heller Dr. Hans-Joachim Maurer BernhardOhlsen Horst Weis Court Constitution and Bar: Walther Rosenthal Criminal Law: Horst Hildebrand, Solicitor The present English edition of “Injustice The Regime”, is an extract of the document collection “Unrecht als System", III. Part, which contains 408 documents. The document numbers used in the German edition have been added (in brackets) to each document in order to facilitate reference to further relevant documents in the German edition. “Unrecht als System", Teil III, will be supplied on substan tiated request for scientific and official use, by Biiro Bonner Berichte, Bonn, Joachimstrasse 10 Druck: Rudolf Otto, Berlin W 35 The first two volumes of the Document Collection “Injustice The Regime”, compiled by the Investigating Committee of Free Jurists in West Berlin and published by the German Federal Ministry for All-German Problems in the years 1952 and 1954, are now followed by the third collection of documents which the Investigating Committee of Free Jurists submits to the public, and especially to the jurists in the whole world, in order to call their attention again to the abuse of law and violations of fun damental rights perpretrated by administrative and judicial authorities of the Soviet Zone of Germany under directives of those possessing the political power in Middle Germany. -

Aufbruch Nach Amerika 1709 – 2009 300 Jahre Massenauswanderung Aus Rheinland-Pfalz Aufbruch Nach Amerika Aufbruch Nach
Aufbruch nach Amerika 1709 – 2009 300 Jahre Massenauswanderung aus Rheinland-Pfalz Aufbruch nach Amerika Aufbruch nach Ausstellung im Theodor-Zink-Museum Kaiserslautern ISBN 978-3-936036-25-1 Schriften des Theodor-Zink-Museums 30. April bis 2. August 2009 Herausgegeben vom Referat Kultur 17 der Stadt Kaiserslautern Aufbruch nach Amerika 1709 – 2009 300 Jahre Massenauswanderung aus Rheinland-Pfalz Ausstellung im Theodor-Zink-Museum Kaiserslautern 30. April bis 2. August 2009 im Museum Alzey 24. August bis 11. Oktober 2009 1 Inhalt Grußwort Ministerpräsident Kurt Beck 5 Zu Ausstellung und Begleitband Marlene Jochem, Eva Heller-Karneth, Rainer Karneth 7 Die deutsche und rheinland-pfälzische Nordamerikaauswanderung im 18. und 19. Jahrhundert Ein Überblick Helmut Schmahl 9 „...in der edlen Illusion, doch noch eine feste Schanze der Freiheit gerettet zu haben!“ Politisch motivierte Auswanderung aus Deutschland und dem heutigen Rheinland-Pfalz im 19. Jahrhundert Steffen Wiegmann 37 Vom Westerwald nach Milwaukee Die Auswanderung Heinrich Georgs im Jahr 1852 Cornelius Neutsch 42 Auswanderungsagenten Barbara Schuttpelz 49 Die jüdische Emigration in die USA nach 1933 am Beispiel der Pfalz Roland Paul 55 „Die Ersten litten große Not, die meisten Zweiten holte ein früher Tod und erst die Dritten fanden Brot“ Das Bild des pfälzischen Auswanderers in der landeskundlichen Literatur von 1850 bis heute Sarah A. Sternal 63 Narrhalla-Marsch in der Neuen Welt Matthias Dietz-Lenssen 73 Die Auswanderung aus Nachkriegsdeutschland Alexander Freund 81 Zur Geschichte -

Deutschland Archivzeitschrift
Deutschland Archiv Zeitschrift für das vereinigte Deutschland 41. Jahrgang 2008 ISSN 0012-1428 62539 W. Bertelsmann Verlag Bielefeld DA_2008_Index.indd 1 16.01.2009 9:39:54 Uhr 2 Jahresinhaltsverzeichnis 2008 Inhaltsübersicht nach Rubriken Innerhalb der Rubriken sind die Beiträge chronologisch geordnet, die Rezensionen alphabetisch nach Verfasser. Die erste Zahl nach dem Titel bezeichnet die Heftnummer, die zweite die Seitenzahl. Kommentare Ralf Altenhof: Ist der Osten noch zu retten? 1/5 Jörg-Dieter Gauger/Günther Rüther: Ein Blick zurück: 2007 – das Jahr der Geisteswissenschaft 1/7 Steffen Reichert: Stacheldraht, Splitterminen, SM-70. Warum die Auseinandersetzung mit der innerdeutschen Grenze notwendiger denn je ist 1/11 Florian Hartleb: Neue Unübersichtlichkeit. Zu den Wahlen in Hessen, Niedersachsen und Hamburg 2/197 Manfred Jäger: Nur der »Roman einer Jugend«. Zum Tode von Dieter Noll (1927 – 2008) 2/202 Karl-Heinz Baum: Stasi in die Produktion? 3/389 Eckhard Jesse: NPD-Verbot ist kein Gebot. Die endlose Diskussion um einen Verbotsantrag gegen die NPD 3/392 Ilse Spittmann-Rühle: Peter Bender zum 85. Geburtstag 3/396 Volker Strebel: Von Rapallo nach Berlin und Moskau. Zum Tode von Nikolaj S. Portugalow (1928 – 2008) 3/399 Eberhard Görner: Mehr als nur ein Schauspieler. Zum Tode von Erwin Geschonneck (1906 – 2008) 3/400 (vgl. 6/968) Winfried Sträter: Bestandsaufnahme und Neujustierung. Anmerkungen zur Fortschreibung der Gedenkstättenkonzeption des Bundes 4/581 Gideon Botsch/Christoph Kopke: Verliert das Flaggschiff an Fahrt? Zum derzeitigen Zustand der NPD 4/586 Heinrich Bortfeldt: »Wir haben den Wind der Geschichte in unseren Segeln«. 1. Parteitag der »Linken« in Cottbus am 24. und 25. -

Hilde Benjamin – Eine Biographie*
UTOPIE kreativ, H. 85/86 (November/Dezember) 1997, S. 114-122 114 VOLKMAR SCHÖNEBURG Hilde Benjamin – Eine Biographie* Die Diskussion um die Rechts- und Justizgeschichte ist heute vielfach von Schnellschüssen, von skandalisierenden, moralisie- renden, die historischen Ursprünge der DDR ausblendenden Be- trachtungen geprägt.1 Es wäre nicht verwunderlich, wenn man ge- rade bei der Abfassung einer Biographie Hilde Benjamins (1902- 1989) jenem »Zeitgeist« juristischer Zeitgeschichtsschreibung un- terliegen würde. Steht doch die frühere Vizepräsidentin des Ober- sten Gerichts (OG) der DDR (1949-1953) und spätere Justizmini- sterin (1953-1967) mit ihrem Namen heute oft für alle negativen Seiten der Justiz der DDR und muß als Beleg für eine angeblich kontinuierliche 56jährige Diktatur im östlichen Teil dieser neuen Republik herhalten.2 Um es gleich vorwegzunehmen: Die Autorin erlag nicht der Versuchung einer solchen historischen Planierung. Volkmar Schöneburg – Vielmehr versucht sie fernab eines moralisierenden Stils, sich auf Jg. 1958, Studium der Tatsachen und historische Zusammenhänge zu beschränken. Rechtswissenschaft an der In den ersten drei Abschnitten des Buches werden die Jugend Humboldt-Universität zu Berlin, 1987 Promotion. und das juristische Studium Hilde Benjamins, ihre Arbeit als An- Wissenschaftlicher Mitarbeiter wältin sowie ihr Leben unter der nazifaschistischen Herrschaft am Institut für Kriminalwis- beschrieben. Die in Bernburg/Saale geborene Hilde Benjamin war senschaften der Juristischen das erste von drei Kindern einer -

Four Conceits
NOT FOR PUBLICATION INSTITUTE OF CURRENT WORLD AFFAIRS DB 30 Plockstrasse 8 Four Gonoe ts Gd'es sen, Germany 'ay I0, 1958 Mr. Walter S. Rogers: Institute of Current World Affairs Fi fth Avene ew York 36, New York Dear Mr. Rogers: What is it that makes the German different than the Frenchman or the Italian or the American? Some will cite the all too renowned theory of the national inferiority complex. Others will finger the tense span between roveling obedience and blatant vainglory. What- ever the formula, most observers of the German scene are sooner or later tempted to generalize about German character. Rather then give in to the enticement, I propose to discuss a type of behavior which may be exceptional among Germans, but perhaps exceptonally German at the same time. This characteristic may be called conceit. Yet it also contains eIements of neurotic vanity, of unconscious arrogance, yes, even a touch of hallucination. One might almost say purblindness in the dlctonary sense of "spiritual obtuseness". Tolstoy offers a deflnlton of it in War and Peace. The Frenchman, he said, is conceited because he imagines himself fascinating to men and women, the Englishman because he always knows the correct thing to do, the Italian because he gets excited and forgets himself, the Russian because he is ignorant... And the German? Tolstoy writes: "A conceited German s the worst of them all, and the most hardened of them all, and the most repulsive of all; for he magines that he ossesses the truth in a science of his own nventlon, which to him i s absolute truth." Yet the type of concelt I wish to dlscuss Is more pitlable than repulsive. -

3. Woche Samstag, 13
3. Woche Samstag, 13. Januar 2018 06.00 Uhr 4:3/ 28' 4 gegen Z Der gestohlene Mond Abenteuerserie Deutschland 2004 - 2007 Staffel 1, Folge 3/39 Personen und Darsteller: Karo (Jessica Rusch), Leonie (Carolyn McGregor), Otti (Jonas Nay), Pinkas (Kevin Stefan), Zanrelot (Udo Kier) Regie: Klaus Wirbitzky [kurz] Alle Schüler des Gymnasiums haben sich auf dem Schulhof versammelt, um die bevorstehende Sonnenfinsternis zu beobachten. Plötzlich geschieht das Unfassbare: Der Mond bleibt vor der Sonne stehen und taucht die Stadt in eine anhaltende Dämmerung. Matreus tritt aus der Sternwarte und lacht sich ins Fäustchen. er hat den Plan Zanrelots ausgeführt und den Mond im Planetenmodell ausgetauscht. [lang] Alle Schüler des Gymnasiums haben sich auf dem Schulhof versammelt, um die bevorstehende Sonnenfinsternis zu beobachten. Plötzlich geschieht das Unfassbare: Der Mond bleibt vor der Sonne stehen und taucht die Stadt in eine anhaltende Dämmerung. Matreus tritt aus der Sternwarte und lacht sich ins Fäustchen. er hat den Plan Zanrelots ausgeführt und den Mond im Planetenmodell ausgetauscht. Jetzt ist es dunkel, die Vögel haben aufgehört zu singen. Alarmiert verschwinden die „Wächter“ aus dem Unterricht, um Jona vor der Sternwarte zu treffen. Aber was sie vorfinden, ist eine silberne Statur. Matreus hat Jona verzaubert. Während Karo und Leonie versuchen, mit einem Gegenzauber Jona zum Leben zu erwecken, finden Otti und Pinkas heraus, dass im Planetenmodell der Sternwarte in falscher Mond steckt. Als es gelingt, Jona wieder zum Reden zu bringen, hält er den richtigen Mond in der Faust. gelingt es den Kindern, durch den gefährlichen Rücktausch des Mondes Zanrelots finsternen Plan zu verhindern? (Erstsendung: 25.02.06/ARD 1.) 06.30 Uhr 4:3/ 28' 4 gegen Z Gefährliches Spiel Abenteuerserie Deutschland 2004 - 2007 Staffel 1, Folge 4/39 Personen und Darsteller: Karo (Jessica Rusch), Leoniie (Carolyn McGregor), Otti (Jonas Nay), Pinkas (Kevin Stevan), Zanrelot (Udo Kier) Regie: Klaus Wirbitzky [kurz] Pinkas und sein Freund Tim testen ein neues Computerspiel. -

Aufsätze Hans Nathan
E 10934 Zeitschrift für Rechtsetzung und Rechtsanwendung Aus dem Inhalt: 1200 Rechtsextremistische Gewalt: Herausforderung für Staat, Gesellschaft und den Einzelnen 54. Jahrgang Ostdeutsche Genossenschaften: woher – wohin? Hans Nathan – Ein Jurist von Geltung Das Grundstücksrechtsänderungsgesetz Historische Ursachen der Fremdenfeindlichkeit in den neuen Bundesländern Aus dem Rechtsprechungsteil: – BVerfG: Anwendung des BAT-O im Land Berlin noch verfassungsgemäß – BGH: Vorrang des Zivilrechts vor Vermögensrecht bei Enteignungen gem. BaulandG/DDR nach dem 18.10.1989 – OLG Dresden: Sittenwidrige Abfindungsregelung einer durch Umwandlung einer PGH entstandenen GmbH – BGH: Ruhen der Strafverfolgungsverjährung bei Aussageerpressung in der DDR – BVerwG: Redlichkeitsanforderungen beim Grund- stückserwerb – LSG Erfurt: Rückwirkende Änderung einer fehlerhaften Rentenberechnung zugunsten des Versicherten NJ Seiten 617-672 NOMOS Berlin In diesem Heft … Herausgeber: AUFSÄTZE S.S. 506 617 Prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht Universität Frankfurt a.M. Rechtsextremistische Gewalt: Herausforderung für Staat, Prof. Dr. Marianne Andrae Gesellschaft und den Einzelnen Universität Potsdam Rainer Faupel . 617 Dr. Bernhard Dombek Ostdeutsche Genossenschaften: woher – wohin? Rechtsanwalt und Notar, Berlin Rolf Steding . 623 Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer Hans Nathan – Ein Jurist von Geltung Dr. Uwe Ewald Marcus Mollnau . 626 Humboldt-Universität zu Berlin Dr. Rainer Faupel Staatssekretär a.D., Potsdam/Berlin NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN S. 630 Georg Herbert Richter -

The Administration of Justice and the Concept of Legality in East Germany*
THE ADMINISTRATION OF JUSTICE AND THE CONCEPT OF LEGALITY IN EAST GERMANY* OTTO KIRCHHEIMERt WITHIN the Soviet orbit of Eastern European states, the East German Democratic Republic (Deutsche Demokratische Republik or DDR) occupies a rather atypical place.' The policy of its administration serves a dual pur- pose. First, it aims at speedy integration with the other Communist-directed countries and furthers as much social change as that process requires. In addition, it is expected to pave the way for the eventual absorption of all Germany into the Eastern world. Hence, the pace of integration into the Eastern bloc is not simply conditioned by the prevailing economic and social situation, but is also subject to counterchecks in that a kind of ideological competition with Western Germany's Federal Republic somehow remains 2 on the agenda. *This article will constitute a chapter in a forthcoming book, Politics and the Adminis- tration of Justice. The support of the Rockefeller Foundation for this study is gratefully acknowledged. A. R. Gurland rendered invaluable assistance in the preparation of the section on Doctrinal Gyrations by undertaking to select the original Russian texts other- wise accessible to the author only in so far as they have been translated. tProfessor of Political Science, Graduate Faculty of Political and Social Science, The New School for Social Research. 1. For a recent study of the legal system of Soviet Russia itself, see Berman, Soviet Law Reform-Datelte Moscow 1957, 66 YALE L.J. 1191 (1957). This article, especially valuable for its searching exploitation of colloquial statements by Soviet legal authorities, rests on the implied thesis that Soviet juridical performance somehow may be traced to a dichotomy between legality and force, and that their respective provinces are dependent on the pressures and circumstances of the moment. -

Ganzumschlag 10Mm Rücken Langfassung Ifz.Indd
Forum Recht Karlsruhe Recht Forum Konzept für Forum Recht, Karlsruhe Konzept für Forum Recht, Karlsruhe Anlage II Inhaltskonzept des Instituts für Zeitgeschichte IfZ, München – Berlin Autoren: Axel Drecoll, Frieder Günther, Johannes Hürter, Michael Schwartz, Martina Steber Andreas Wirsching, Magnus Brechtken Anlage II – Inhaltskonzept II – Inhaltskonzept Anlage Gesamtschau der Themen Meilensteine des Bundesdeutschen Rechtsstaats I. Alles, was Recht ist. Grundbegriffe und Grundprobleme V. Kulturen des Rechts. Symbole, Medien, Orte 20.09.1945 Kontrollratsgesetz Nr. 1 zur Aufhebung von NS-Recht: Gesetze dürfen nicht mehr angewandt werden, die jemanden „aufgrund seiner Rasse, 17. Justitia, Waage und Richterrobe Staatsangehörigkeit, seines Glaubens oder seiner Opposition zur NSDAP oder ihrer Lehren“ benachteiligen könnten II. Recht in Deutschland. Eine lange Geschichte 18. Gesetzbuch und Kommentar, Akte und Paragraf 20.11.1945 Beginn des Nürnberger Prozesses gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärtribunal der Alliierten 1. Der Weg zum modernen Rechtsstaat 19. Vertrag und Unterschrift 24.05.1949 Inkrafttreten des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland 2. Streben nach Freiheit. Bürgerliche Grundrechte 20. Ampel und Strafzettel 01.10.1950 Gründung des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe als oberste Instanz für Zivil- und Strafsachen 3. Die Gesellschaft ordnen. Arbeits- und Sozialrecht 21. Theater und Spielfilm 28.09.1951 Gründung des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe 4. Pervertierung des Rechts. Das NS-Regime 22. Gerichtsreportagen und Gerichtssendungen 23.09.1952 Gründung des Bundesverwaltungsgerichts in Berlin als zentrale Instanz zur bundesweiten Vereinheitlichen der Verwaltungsrechtsprechung 5. Recht in der SED-Diktatur. Die DDR 23. Universität 03.09.1953 Inkrafttreten der Europäischen Menschenrechtskonvention, Gründung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte am 20.04.1959 24. Gerichtssaal III. Rechtsstaat Bundesrepublik.