Der Student Im Garten*
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Jewish Encyclopedia
Jewish Encyclopedia The History, Religion, Literature, And Customs Of The Jewish People From The Earliest Times To The Present Day Volume XII TALMUD – ZWEIFEL New York and London FUNK AND WAGNALLS COMPANY MDCCCCVI ZIONISM: Movement looking toward the segregation of the Jewish people upon a national basis and in a particular home of its own: specifically, the modern form of the movement that seeks for the Jews “a publicly and legally assured home in Palestine,” as initiated by Theodor Herzl in 1896, and since then dominating Jewish history. It seems that the designation, to distinguish the movement from the activity of the Chovevei Zion, was first used by Matthias Acher (Birnbaum) in his paper “Selbstemancipation,” 1886 (see “Ost und West,” 1902, p. 576: Ahad ha – ‘Am, “Al Parashat Derakim,” p. 93, Berlin, 1903). Biblical Basis The idea of a return of the Jews to Palestine has its roots in many passages of Holy Writ. It is an integral part of the doctrine that deals with the Messianic time, as is seen in the constantly recurring expression, “shub shebut” or heshib shebut,” used both of Israel and of Judah (Jer. xxx, 7,1; Ezek. Xxxix. 24; Lam. Ii. 14; Hos. Vi. 11; Joel iv. 1 et al.). The Dispersion was deemed merely temporal: ‘The days come … that … I will bring again the captivity of my people of Israel, and they shall build the waste cities and inhabit them; and they shall plant vineyards, and drink the wine thereof … and I will plant them upon their land, and they shall no more be pulled up out of their land” (Amos ix. -

Die Deutsche Nationalhymne
Wartburgfest 1817 III. Die deutsche Nationalhymne 1. Nationen und ihre Hymnen Seit den frühesten Zeiten haben Stämme, Völker und Kampfeinheiten sich durch einen gemeinsamen Gesang Mut zugesungen und zugleich versucht, den Gegner zu schrecken. Der altgriechische Päan ist vielleicht das bekannteste Beispiel. Parallel zum Aufkommen des Nationalismus entwickelten die Staaten nationale, identitätsstiftende Lieder. Die nieder- ländische Hymne stammt aus dem 16 Jahrhundert und gilt als die älteste. Wilhelmus von Nassawe bin ich von teutschem blut, dem vaterland getrawe bleib ich bis in den todt; 30 ein printze von Uranien bin ich frey unverfehrt, den könig von Hispanien hab ich allzeit geehrt. Die aus dem Jahre 1740 stammen Rule Britannia ist etwas jünger, und schon erheblich nationalistischer. When Britain first, at Heaven‘s command Arose from out the azure main; This was the charter of the land, And guardian angels sang this strain: „Rule, Britannia! rule the waves: „Britons never will be slaves.“ usw. Verbreitet waren Preisgesänge auf den Herrscher: Gott erhalte Franz, den Kaiser sang man in Österreich, God save the king in England, Boshe chrani zarja, was dasselbe bedeutet, in Rußland. Hierher gehören die dänische Hymne Kong Christian stod ved højen mast i røg og damp u. a. Die französische Revolution entwickelte eine Reihe von Revolutionsge- sängen, die durchweg recht brutal daherkommen, wie zum Beispiel das damals berühmte Ah! ça ira, ça ira, ça ira, Les aristocrates à la lanterne! Ah! ça ira, ça ira, ça ira, Les aristocrates on les pendra! also frei übersetzt: Schaut mal her, kommt zuhauf, wir hängen alle Fürsten auf! Auch die blutrünstige französische Nationalhymne, die Mar- seillaise, stammt aus dieser Zeit: Allons enfants de la patrie. -

Oscar Straus Beiträge Zur Annäherung an Einen Zu Unrecht Vergessenen
Fedora Wesseler, Stefan Schmidl (Hg.), Oscar Straus Beiträge zur Annäherung an einen zu Unrecht Vergessenen Amsterdam 2017 © 2017 die Autorinnen und Autoren Diese Publikation ist unter der DOI-Nummer 10.13140/RG.2.2.29695.00168 verzeichnet Inhalt Vorwort Fedora Wesseler (Paris), Stefan Schmidl (Wien) ......................................................................5 Avant-propos Fedora Wesseler (Paris), Stefan Schmidl (Wien) ......................................................................7 Wien-Berlin-Paris-Hollywood-Bad Ischl Urbane Kontexte 1900-1950 Susana Zapke (Wien) ................................................................................................................ 9 Von den Nibelungen bis zu Cleopatra Oscar Straus – ein deutscher Offenbach? Peter P. Pachl (Berlin) ............................................................................................................. 13 Oscar Straus, das „Überbrettl“ und Arnold Schönberg Margareta Saary (Wien) .......................................................................................................... 27 Burlesk, ideologiekritisch, destruktiv Die lustigen Nibelungen von Oscar Straus und Fritz Oliven (Rideamus) Erich Wolfgang Partsch† (Wien) ............................................................................................ 48 Oscar Straus – Walzerträume Fritz Schweiger (Salzburg) ..................................................................................................... 54 „Vm. bei Oscar Straus. Er spielte mir den tapferen Cassian vor; -

Verbindungen in Königsberg Liste
Verbindungen in Königsberg a) Albertus-Universität Königsberg (Albertina) 1. Allgemeinheiten 1.1. Königsberger Burschenschaft I (1817-1819) 1.2. Allgemeine Burschenschaft (1819-1833) 1.3. Königsberger Burschenschaft II (1833) 1.4. Albertina, Allgemeine Burschenverbindung (1838-1845) 1.5. Allgemeinheit (kein eigentlicher Name) (1845-1846) 1.6. Allgemeine Studentenschaft (1848-1851/52) 1.7. Königsberger Studentenschaft (1884-1888) 2. Korporationen 2.1. Adalberta, Verein Katholischer Deutscher Studentinnen im VKDSt (1916-1933?) 2.2. Agronomia, Corps im RSC, Bauernschaft im NTh (1879-1935/36) 2.3. Akademische Freischar (Hochschulgilde) in der DG (1926-1934) Akademische Gesellschaft für allgemeine Wissenschaften ® Akad. Verbindung Albertia 2.4. Akademische Muße, Kränzchen in der Königsberger Burschenschaft (1818-1819) 2.5. Akademischer Fechtclub (1859-1860) Akademischer Gesangverein ® Sängerverbindung Askania Akademischer Pharmazeutenverein ® Freischlagende Verbindung Marcomannia 2.6. Akademischer Richard Wagner-Verein I (um 1885) 2.7. Akademischer Richard Wagner-Verein II (1908-1914) Akademischer Ruderverein ® Akad. Ruderverbindung Alania Akademischer Sportclub ® Akad. Sportverbindung Curonia Akademischer Turnverein ® Burschenschaft Teutonia Akademischer Verein für neuere Philologie ® Turnerschaft Markomannia Akademische Turnriege ® Akad. Turnverbindung Ostmark 2.8. Akademisch-Historischer Verein (1881-vor 1885) Akademisch-Landwirtschaftlicher Verein ® Corps Agronomia 2.9. Akademisch-Mathematischer Verein (1878/79-1889) Akademisch-Medizinischer -

Europäische Nationalhymnen Als Ausdruck Nationaler Identitäten Unter Besonderer Berücksichtigung Der Länder Mittel-, Ost- Und Südosteuropas
Christiane Rothenpieler, Bakk. Phil. Europäische Nationalhymnen als Ausdruck nationaler Identitäten unter besonderer Berücksichtigung der Länder Mittel-, Ost- und Südosteuropas MASTERARBEIT Zur Erlangung des akademischen Grades Magistra der Philosophie Studium: Angewandte Kulturwissenschaft Alpen-Adria-Universität Klagenfurt Fakultät für Kulturwissenschaften Begutacher: Dr. habil. Wolfgang Geier Institut für Kultur-, Literatur- und Musikwissenschaft April 2012 II Ehrenwörtliche Erklärung Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende wissenschaftliche Arbeit selbständig angefertigt und die mit ihr unmittelbar verbundenen Tätigkeiten selbst erbracht habe. Ich erkläre weiters, dass ich keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Alle aus gedruckten, ungedruckten oder im Internet im Wortlaut oder im wesentlichen Inhalt übernommenen Formulierungen und Konzepte sind gemäß den Regeln für wissenschaftliche Arbeiten zitiert und durch Fußnoten bzw. durch andere genaue Quellenangaben gekennzeichnet. Die während des Arbeitsvorganges gewährte Unterstützung einschließlich signifikanter Betreuungshinweise ist vollständig angegeben. Die wissenschaftliche Arbeit ist noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt worden. Diese Arbeit wurde in gedruckter und elektronischer Form abgegeben. Ich bestätige, dass der Inhalt der digitalen Version vollständig mit dem der gedruckten Version übereinstimmt. Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben wird. Christiane Rothenpieler Klagenfurt, 26.04.2012 III Inhaltsverzeichnis -

Teil 2: Dresdner Verbindungen
‚Lebenslange Gemeinschaft statt anonyme Massen- universität‘ – mit solchen Worten werben studenti- sche Verbindungen (auch Korporationen genannt) unter den Erstsemestern um Neumitglieder. Was nach Ersatzfamilie klingt, wird vor allem mit Traditionen und angeblich „zeitlosen Werten“ begründet. Zu diesen gehören bunte Mützen und Bänder, Degen und Wappen, rituelle Abendveranstaltungen und jahrhun- dertealte Lieder sowie eine Sprache, die für Außen- stehende kaum zu enträtseln ist. Die meisten dieser Verbindungen sind reine Männerbünde. Kritiker:innen werfen ihnen häufig eine elitäre und frauenfeindliche Haltung, nicht selten sogar explizit extrem rechte Einstellungen vor. Der StuRa der TU Dresden hat sich der Aufgabe gewidmet, Fakten von Klischees zu tren- nen und das deutsche Verbindungswesen allgemein wie auch vor Ort genauer unter die Lupe genommen. Band 2 schaut sich die Dresdner Situation an: Welche Verbindungen gibt es hier, wie sind sie untereinander vernetzt und wie positionieren sie sich öffentlich? Vor allem das Netzwerk rund um die Dresdner Burschen- schaften, die wiederum eng mit Pegida, Identitärer Bewegung und AfD verbunden sind, verdient besonde- re Beachtung, denn Dresden ist für die Neue Rechte in Deutschland längst zu einem Ausnahmeort geworden. Teil 2: Dresdner Verbindungen stura.link/refpob WHAT.StuRa.TUD StuRaTUD WHAT_StuRa_TUD StuRaTUD IMPRESSUM AUSGEFUXT – Kritik an studentischen Verbindungen Teil 2: Dresdener Verbindungen Auch als pdf verfügbar unter: stura.tu-dresden.de/ausgefuxt 1. Auflage - Dezember 2017 – überarbeitet 01. März 2018 Redaktionsschluss: Oktober 2017 Herausgegeben durch die Referate WHAT, Politische Bildung, Hochschulpolitik und Öffentlichkeitsarbeit des Studentenrates (StuRa) der Technischen Universität Dresden Postanschrift: StuRa der TU Dresden Helmholtzstr. 10 01069 Dresden stura.tu-dresden.de Besucheradresse: Haus der Jugend George-Bähr-Str. -

Download File
In the Shadow of the Family Tree: Narrating Family History in Väterliteratur and the Generationenromane Jennifer S. Cameron Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2012 2012 Jennifer S. Cameron All rights reserved ABSTRACT In the Shadow of the Family Tree: Narrating Family History in Väterliteratur and the Generationenromane Jennifer S. Cameron While debates over the memory and representation of the National Socialist past have dominated public discourse in Germany over the last forty years, the literary scene has been the site of experimentation with the genre of the autobiography, as authors developed new strategies for exploring their own relationship to the past through narrative. Since the late 1970s, this experimentation has yielded a series of autobiographical novels which focus not only on the authors’ own lives, but on the lives and experiences of their family members, particularly those who lived during the NS era. In this dissertation, I examine the relationship between two waves of this autobiographical writing, the Väterliteratur novels of the late 1970s and 1980s in the BRD, and the current trend of multi-generational family narratives which began in the late 1990s. In a prelude and three chapters, this dissertation traces the trajectory from Väterliteratur to the Generationenromane through readings of Bernward Vesper’s Die Reise (1977), Christoph Meckel’s Suchbild. Über meinen Vater (1980), Ruth Rehmann’s Der Mann auf der Kanzel (1979), Uwe Timm’s Am Beispiel meines Bruders (2003), Stephan Wackwitz’s Ein unsichtbares Land (2003), Monika Maron’s Pawels Briefe (1999), and Barbara Honigmann’s Ein Kapitel aus meinem Leben (2004). -

RESEARCH in the HISTORY of ECONOMIC THOUGHT and METHODOLOGY RESEARCH in the HISTORY of ECONOMIC THOUGHT and METHODOLOGY Founding Editor: Warren J
RESEARCH IN THE HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT AND METHODOLOGY RESEARCH IN THE HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT AND METHODOLOGY Founding Editor: Warren J. Samuels (1933–2011) Series Editors: Luca Fiorito, Scott Scheall, and Carlos Eduardo Suprinyak Recent Volumes: Volume 35A: Research in the History of Economic Thought and Methodology: Including a Symposium on the Historical Epistemology of Economics; 2017 Volume 35B: Research in the History of Economic Thought and Methodology: Including a Symposium on New Directions in Sraffa Scholarship; 2017 Volume 36A: Research in the History of Economic Thought and Methodology: Including a Symposium on Bruce Caldwell’s Beyond Positivism after 35 Years; 2018 Volume 36B: Research in the History of Economic Thought and Methodology: Including a Symposium on the Work of Mary Morgan: Curiosity, Imagination, and Surprise; 2018 Volume 36C: Research in the History of Economic Thought and Methodology: Including a Symposium on Latin American Monetary Thought: Two Centuries in Search of Originality; 2018 Volume 37A: Research in the History of Economic Thought and Methodology: Including a Symposium on 50 Years of the Union for Radical Political Economics; 2019 Volume 37B: Research in the History of Economic Thought and Methodology: Including a Symposium on Ludwig Lachmann; 2019 Volume 37C: Research in the History of Economic Thought and Methodology: Including a Symposium on Robert Heilbroner at 100; 2019 Volume 38A: Research in the History of Economic Thought and Methodology: Including a Symposium on Public Finance in the History of Economic Thought; 2020 EDITORIAL BOARD Michele Alacevich Nicola Giocoli University of Bologna, Italy University of Pisa, Italy Rebeca Gomez Betancourt Harald Hagemann University of Lumière Lyon 2, France University of Hohenheim, Germany John Davis Tiago Mata Marquette University, USA; University University College, London, of Amsterdam, The Netherlands UK Till Düppe Steven Medema Université du Québec à Montréal, University of Colorado Denver, Canada USA Ross Emmett Gary Mongiovi Arizona State University, USA St. -

Robert Blum Und Die Burschenschaft
Robert Blum und die Burschenschaft von Harald Lönnecker Koblenz 2006 Dateiabruf unter: www.burschenschaft.de Dateiabruf unter: www.burschenschaft.de Robert Blum und die Burschenschaft* von Harald Lönnecker In der Einleitung zur Verfassungsurkunde der Jenaischen Burschenschaft vom Juni 1815 heißt es: „Nur solche Verbindungen, die auf den Geist gegründet sind, auf welchen überhaupt nur Verbindungen gegründet sein sollten, auf den Geist, der uns das sichern kann, was uns nächst Gott das Heiligste und Höchste sein soll, nämlich Freiheit und Selbständigkeit des Vaterlands, nur solche Verbindungen benennen wir mit dem Namen einer Burschenschaft.“1 Die Burschenschaft war die Avantgarde der deutschen Nationalbewegung. Sie wurzelte in den Freiheitskriegen, stand unter dem Einfluß von Friedrich Ludwig Jahn, Ernst Moritz Arndt und Johann Gottlieb Fichte, war geprägt durch eine idealistische Volkstumslehre, christliche Erweckung und patriotische Freiheitsliebe. Diese antinapoleonische Nationalbewegung deutscher Studenten war politische Jugendbewegung und die erste gesamtnationale Organisation des deutschen Bürgertums überhaupt, die 1817 mit dem Wartburgfest die erste gesamtdeutsche Feier ausrichtete und mit rund 3.000 Mitgliedern 1818/19 etwa ein Drittel der Studentenschaft des Deutschen Bundes umfaßte.2 Die zur nationalen Militanz neigende Burschenschaft, zu einem Gutteil hervorgegangen aus dem Lützowschen Freikorps, setzte ihr nationales Engagement in neue soziale Lebensformen um, die das Studentenleben von Grund auf reformierten. Aber nicht nur das: Die Studenten begriffen die Freiheitskriege gegen Napoleon als einen Zusammenhang von innerer Reform, innenpolitischem Freiheitsprogramm und * Zuerst in: Bundesarchiv (Hg.), Martina Jesse, Wolfgang Michalka (Bearb.), „Für Freiheit und Fortschritt gab ich alles hin.“ Robert Blum (1807-1848). Visonär – Demokrat – Revolutionär, Berlin 2006, S. 113-121. 1Paul Wentzcke, Geschichte der Deutschen Burschenschaft, Bd. -
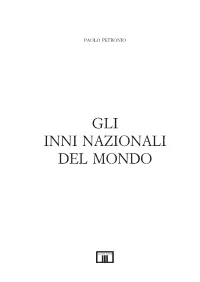
Frontespizio Colophon 1..1
PAOLO PETRONIO GLI INNI NAZIONALI DEL MONDO Indice sommario Introduzione dell’Autore ................................................................... 1 Gli inni nazionali ........................................................................... 5 Nota ......................................................................................... 27 Europa ....................................................................................... 29 Austria - Republik O¨ sterreich ......................................................... 30 Germania - Bundesrepublik Deutschland............................................ 32 Belgio - Royaume de Belgique / Koninkrijk Belgie¨ ................................. 38 Olanda o Paesi Bassi - Koninkrijk der Nederlanden ............................... 39 Lussemburgo - Groussherzogtom Le¨tzebuerg / Gran-Duche´deLuxem- bourg ................................................................................. 42 Danimarca - Kongeriget Danmark .................................................... 43 Norvegia - Kongeriket Norge ......................................................... 46 Svezia - Konungartket Sverige......................................................... 48 Finlandia - Suomen Tasavalta (Republiken Finland) ............................... 49 Estonia - Eesti Vabartik ................................................................ 52 Lettonia - Latvijas Republika .......................................................... 54 Lituania - Lietuvos Respublika ....................................................... -

Die EU-Mitgliedstaaten Und Ihre Nationalhymnen
Geschichte – Kultur – Politik und 28 Länderporträts Die EU-Mitgliedstaaten und ihre Nationalhymnen plus Audio-CD mit allen Hymnen Geschichte – Kultur – Politik und 28 Länderporträts Die EU-Mitgliedstaaten und ihre Nationalhymnen ZUM AUTOR Harry D. Schurdel Geboren 1946 im nordfriesischen Husum, arbeitet als freier Journalist und Publizist vornehmlich für Tages- und Wochenzeitungen sowie für populär wissen- schaftliche Magazine mit Schwerpunkt auf politischen, historischen und landes- kundlichen Themen. Sein besonderes Interesse gilt der Staatssymbolik, wozu er zahlreiche Arbeiten veröffentlicht hat. — Impressum — Zeichenerklärung — Herausgeberin: Bundeszentrale für politische Bildung / bpb, 1985 = fett gedruckte Zahl: Adenauerallee 86, 53113 Bonn, www.bpb.de Jahr der amtlichen Einführung Redaktion: Iris Möckel, bpb (verantwortlich), Simone Albrecht, bpb M = Musik Redaktionelle Mitarbeit: Dr. Gernot Dallinger, Köln T = Text Autor Teil 1: Harry D. Schurdel, Glücksburg (Ostsee) ( ) = in Klammern stehen die Lebens- Zusammenstellung der Daten für Teil 2: Simone Albrecht, bpb daten des jeweiligen Dichters# oder Komponisten#. — Gestaltung: Leitwerk. Büro für Kommunikation, # = steht für die weibliche Form Köln, www.leitwerk.com des vorangegangenen Begriffs Illustrationen: Anika Takagi, Jana-Lina Berkenbusch, Anke Brodersen, Stefanie Großerichter, Ann-Kathrin Hochmuth, Cornelia Pistorius, Katharina Plass (alle Leitwerk) — Druck: Werbedruck GmbH Horst Schreckhase, Spangenberg — Audio-CD: Musik: Stabsmusikkorps der Bundeswehr unter der Leitung von Oberstleutnant Walter Ratzek Aufnahmeleiter: Georges Moreau, Zutendaal / Belgien Toningenieur: Roland Stuppin, wind records, Cloppenburg Vervielfältigung: interdisc media, Alsdorf 1. Auflage April 2014 ISBN: 978-3-8389-7105-6 Bestell-Nr. 1.943 — Bestellung und weitere Infos unter: www.bpb.de/falter 4 VORWORT Die Europäische Staatengemeinschaft wuchs, baute die Schlagbäume zwischen ihren Mitgliedern ab, schuf eine übernationale Währung, und im Zuge der Osterweiterungen ab 2004 traten ihr elf ost- europäische Länder bei. -
1848 Revolution Academy Concerts, See Vienna Philharmonic
Cambridge University Press 978-1-107-02268-3 - The Legacy of Johann Strauss: Political Influence and Twentieth-Century Identity Zoë Alexis Lang Index More information Index 1848 Revolution, see Austria: 1848 Bach, David Josef, 41 Revolution Bach, Johann Sebastian, 91 , 95 , 176 Concerto for Two Violins, 91 , 176 Academy concerts, see Vienna Philharmonic: Bad Ischl, 151 Academy concerts Barcelona, 133 , 134 Adolf Luser Verlag, 102 Bauer, Julius, 169 Agee, James, 149 Bavaria, 5 , 93 , 96 “alte Steffl ,” 34 Becker, Alfred Julius, 90 Amon, Franz, 20 Beethoven, Ludwig van, 3 , 42 , 88 , 91 , 92 , An der schönen blauen Donau , see Strauss, 133 , 134 , 177 , 189 Johann, Jr.: Blue Danube, The Serenade in D major (op. 25), 134 An der schönen blauen Donau (fi lm), 63 Symphony no. 7, 189 Anderson, Benedict, 39 Triple Concerto, 91 , 177 Anzengruber, Ludwig, 56 Beller, Steven, 109 Apollosaal, 16 Bellini, Vincenzo, 99 Arbeiter-Sinfonie-Konzert, see Workers’ Berg, Alban, 111 , 134 , 136 , 139 Symphony Concert Association Bergland Verlag, 105 Arbeiter-Zeitung , 126 , 127 Berlin, 3 , 36 , 66 , 90 , 121 , 126 , 127 , 132 , Athenaion Verlag, 98 1 3 9 , 1 4 9 Austria, 70 Berliner Tagblatt , 121 1848 Revolution, 26 , 28 , 30–32 , 47 , 53 Berlioz, Hector, 18 , 20 Anschluss, 3 , 72 , 75 , 122 , 123 , 127 , Bernhard, Thomas, 164 131 , 147 Bertolucci, Bernardo, 130 , 131 Austrofascism, 73 , 140–141 Bienenfeld, Elsa, 169 , 171 Catholicism, 3 , 5 , 38 , 112 , 139 , 141 Bilse, Benjamin, 12 Christian Social Party, 5 , 38 , 138 Bismarck, Otto von, 3 civil war (1934), 73 , 141 Bizet, Georges, 89 , 91 , 176 dialect, 3 , 56 L’Arlésienne (Suite No.