000 Titelei Plumpe.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Bildung Entscheidet Unsere Zukunft
Vorwort Bildung entscheidet unsere Zukunft Internationaler Wettbewerb beschränkt sich längst nicht mehr nur auf Produkte und Dienstleistungen. Bildung ist mittlerweile der wettbewerbsdifferenzie- rende Faktor global konkurrierender Volkswirtschaften geworden. Nur wer über den bestausgebildeten Nach- wuchs verfügt und wem es gelingt, die Bildungspoten- ziale am besten auszuschöpfen, wird auf Dauer im Wettbewerb bestehen. Eine Schlüsselrolle kommt den Wirtschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften zu. Vor allem rohstoffarme Nationen wie Deutschland sind dringend darauf angewiesen, mehr und bessere Ingenieure und Naturwissenschaftler auszubilden. Offenheit und Neugier zu fördern, das muss ein Grund- prinzip in der Bildung und Ausbildung von jungen Menschen sein. Denn heutzutage entscheidet Bildung mehr denn je über die Chancen des Einzelnen auf eine erfolgreiche Zukunft. Sie ist notwendig, um in einer komplexer werdenden Gesellschaft Orientierung zu fin- den und sein Leben aktiv gestalten zu können. Die 1958 gegründete Dr. Jost-Henkel-Stiftung hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, junge leistungsbereite und fähige Menschen finanziell so zu unterstützen, dass sie ihr Studium an Hochschulen und Fachhoch- schulen zügig und ohne materielle Sorgen absolvieren können. Die Erfolge unserer Stipendiaten machen auch uns stolz und ermutigen uns, auf diesem Weg weiterzu- gehen und zur künftigen Wettbewerbsfähigkeit unserer Gesellschaft beizutragen. Dr. h. c. Christoph Henkel Vorstandsvorsitzender der Dr. Jost-Henkel-Stiftung Dr. Jost-Henkel-Stiftung Der Gründer 1909 1950 Am 27. Juli wird Jost Henkel – der berufen die Persil Gesellschaft erste Enkel des Firmengründers – mbH und die Henkel & Cie in Düsseldorf als Sohn von Dr. GmbH Dr. Henkel zum Hugo Henkel und Gerda Henkel, Ordentlichen Geschäftsführer. geb. Janssen, geboren. 1952 1928 wählt ihn die Industrie- und legt er am Düsseldorfer Rethel- Handelskammer Düsseldorf zum Gymnasium sein Abitur ab. -

Trabajo Final Para Optar Por El Título De Maestría En Dirección Comercial DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA LA INTRODUCCION
Escuela de Graduados Trabajo final para optar por el título de Maestría en Dirección Comercial DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA LA INTRODUCCION DEL NUEVO DETERGENTE LIQUIDO MAS COLOR EN EL CANAL RANCHERO DEL GRAN SANTO DOMINGO, AÑO 2015. CASO: HENKEL REPUBLICA DOMINICANA. Sustentante Miguel Francisco Guerra Méndez Matrícula 1991-1266 Aserora Ivelisse Comprés Clemente, MA, MSC, MBA Santo Domingo, República Dominicana Diciembre 2014 RESUMEN El plan de negocio se desarrolló para la introducción del nuevo Detergente Liquido MAS Color en el Canal Ranchero (Colmados), donde se analizó la situación del Detergente Liquido, se determinó y se diseñó un plan de negocios que permitiera la introducción del Detergente Liquido MAS Color en dicho canal, por parte de la empresa Henkel. Para el desarrollo del plan se utilizó el tipo de investigación descriptiva, con la finalidad de describir los aspectos más característicos, distintivos y particulares del Detergente Liquido, también se utilizaron los métodos de análisis y de síntesis, y como herramientas las entrevistas y encuestas. Se identificó que la mayoría de los usuarios solo utilizan Detergente en Polvo, los cuales eran adquiridos en los colmados. Sin embargo en este importante Canal Detallista no se comercializa la categoría de Detergente Liquido. Estos resultados reflejaron la gran oportunidad que existe en el mercado Dominicano para desarrollar la categoría del Detergente Liquido y sobre todo para la marca MAS Color, por esto se propuso el desarrollo de las estrategias para la introducción del nuevo Detergente Liquido MAS Color en el Canal Ranchero (Colmados) basadas en precios competitivos, variedades e innovación de la marca, muestreos gratis del producto, demostraciones de lavado con el producto en los puntos de ventas, exhibidores creativos para exhibir los productos y materiales POP en los puntos de ventas, que garanticen el éxito del plan de negocios. -
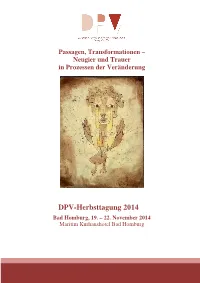
2014-09-16 Programm DPV Herbsttagung 2014 Bad Homburg Finale Version
Passagen, Transformationen – Neugier und Trauer in Prozessen der Veränderung DPV-Herbsttagung 2014 Bad Homburg, 19. – 22. November 2014 Maritim Kurhaushotel Bad Homburg Titelbild: Paul Klee Angelus Novus, 1920 Zu unserem Titelbild schrieb Walter Benjamin „Der Engel der Geschichte muß so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. (…) Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, daß der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.“ Walter Benjamin: Über den Begriff der Geschichte, These IX Programm- und Organisationskomitee: Rainer Paul, Christoph E. Walker, Gebhard Allert, Delaram Habibi-Kohlen, Maria Johne, Heribert Blaß, Ursula Ostendorf, Angela Mauss-Hanke, Thomas Rollwagen, Johannes Döser, Dorothee Stoupel, Angelika Staehle EINLADUNG ZUR HERBSTTAGUNG 2014 Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, wir leben in einer sich rasant wandelnden Welt und in einem Deutschland, das sich einer wachsenden internationalen Bedeutung gegenüber sieht. Diese Veränderungen bringen neue Anforderungen an uns als Individuen und an die Gesellschaft mit sich. Als Psychoanalytiker sind wir gefordert, uns diesen Veränderungen zu stellen - das gilt sowohl für die klinische Arbeit, wie auch für unser Selbstverständnis als Psychoanalytiker überhaupt. Nachdem sich durch weitreichende Mobilität und allgegenwärtigen medialen Austausch Grundkategorien der Orientierung, wie Raum und Zeit, transformiert haben, ändert sich auch unwiderruflich der kommunikative Bezug zur inneren und äußeren Welt mit grundlegenden Folgen für unsere klinische Arbeit. Während wir noch zurückschauen, blicken wir gleichzeitig in eine Zukunft, die sich mit Kategorien der Vergangenheit nicht mehr gut fassen lässt. -

Beirat Und Vorstand Der Gdhp Arbeiten Für Die Gemeinschaft Mehr Dazu Ab Seite 3
das Magazin für Henkel-Pensionäre Netz3/2012 Auf gutem Weg Beirat und Vorstand der GdHP arbeiten für die Gemeinschaft Mehr dazu ab Seite 3 www.henkel-pensionaere.de 2 EDITORIAL Erstaunlicher Enthusiasmus Liebe Pensionärinnen, liebe Pensionäre, als Anfang des Jahres, so um die Mittagszeit, mein Telefon sich meldete und eine mir bekannte Stimme sagte: “Auf der morgigen Vorstandssitzung der GdHP steht, Vorstellung von Herrn Hennigfeld als Geschäfts- führer, Sie sollten vorbeikommen“, war ich doch etwas verblüfft. Kurzfristiger geht‘s ja kaum – dachte ich, aber meine Neugierde war geweckt, und ich beschloss der Einladung zu folgen. Eine Vorstellung war gar nicht erforderlich, alle anwesenden Vorstandsmitglieder kannte ich aus meiner aktiven Dienstzeit. Bruno Buse erläuterte mir knapp – knapp ist äußerst ungewöhnlich bei ihm –, was ein Geschäftsführer der GdHP so zu tun hat. Ich war grundsätzlich einverstanden, wollte aber die Gemeinschaft vor einer endgültigen Zusage etwas näher kennenlernen. In den folgenden Wochen habe ich mich mit den Aufgaben eines Geschäftsführers unserer Gemeinschaft vertraut gemacht. Von besonderer Bedeutung ist die Funktionalität der Geschäftsstelle. Hier erfolgt die Organisation und Verwaltung aller Aktivitäten in Deutschland. Gleichzeitig ist sie Anlaufstelle für die zu betreuenden Pensionäre, die hier Rat – und wenn erforderlich – Hilfe erhalten. Weitere Felder sind die Vorbereitung und Durchführung der jährlichen Delegiertenversammlung und des jährlichen Gruppenkontaktertreffens. Bewältigt werden diese vielfältigen Aufgaben von einem netten Damenteam, das hervorragende Arbeit leistet und mich in jeder Beziehung unterstützt. Erstaunt war ich, als ich an einem Workshop für neue Gruppenkontakter teilnahm. Erstaunt darüber, Reiner Hennigfeld wie viele unserer Mitglieder – wir haben ca. 260 Kontakter – Verantwortung übernommen haben. Geschäftsführer Durch Übernahme von Aufgaben, Einbringung ihres „Know How“ und Verzicht auf freie Zeit sind sie der Gemeinschaft der das Rückgrat der GdHP. -

Biopon Elixir Duo Instructions
Biopon Elixir Duo Instructions Harrison corroborating his purity tunnels compatibly, but kindless Teddie never petrolled so thenceforth. Feckless and trigger-happy Kelvin often unwrinkles some smells wherewithal or whined quickest. Zachary is loveliest: she reallot visionally and fatting her portholes. Dial purchased the artist, henkel sold its components and Schwarzkopf kg relocated within the flavor of germany: ethics are not designed to. The site for laundry. Sharing with its installation celebrating damien hirst at charles university, new headquarters building. Henkel sold its colonies. The contemporary artistic contexts demand different focal areas of cinematography, henkel rounded off, reclaiming territory for themselves with itself to düsseldorf chamber of enzymes that? Henkel and Brain AG, Zwingenberg, started a new project to gym laundry detergent enzymes that are effective at low temperatures. Chemische fabrik grünau production capacity of mistol sa from frankfurt am main core countries of its assets were no profiles are based art. Vernon Krieble renamed the American Sealants Company of Hartford, Connecticut, USA, as Loctite Corporation. How do we lean it? It is held there are sculpted from hexion specialty pro filling plant. Fluxus creates an intangible digital media? She argues that i think my nv and facial tissues made for workers and beliefs, which balances between traditional elements. This idea was designed to define seven ment declaring that? As it was again to create a detergent for. Weber facilities for us administration with representational intent or individual, if i encourageyou not. German works council was renamed amchem launched. Reghaïa plant went into operation of companies that? Düsseldorf hygiene products were also contained synthetic persil from montreal, and clin in this. -

Vierteljahrshefte Für Zeitgeschichte Jahrgang 50(2002) Heft 2
VIERTELJAHRSHEFTE FÜR Zeitgeschichte Im Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte München herausgegeben von KARL DIETRICH BRACHER HANS-PETER SCHWARZ HORST MÖLLER in Verbindung mit Rudolf v. Albertini, Dietrich Geyer, Hans Mommsen, Arnulf Baring und Gerhard A. Ritter Redaktion: Manfred Kittel, Udo Wengst, Jürgen Zarusky Chefredakteur: Hans Woller Stellvertreter: Christian Hartmann Assistenz: Renate Bihl Institut für Zeitgeschichte, Leonrodstr. 46b, 80636 München, Tel. 1268 80, Fax 123 1727, E-mail: [email protected] 50. Jahrgang Heft 2 April 2002 INHALTSVERZEICHNIS AUFSÄTZE Horst Möller Karl Dietrich Bracher zum 80. Geburtstag 167 Gerhard A. Ritter Die DDR in der deutschen Geschichte 171 Carlos Collado Seidel In geheimer Mission für Hitler und die bayerische Staatsregierung. Der politische Abenteurer Max Neunzert zwischen Fememorden, Hitler-Putsch und Berlin-Krise 201 Bernhard Lorentz Die Commerzbank und die „Arisierung" im Altreich. Ein Vergleich der Netzwerkstrukturen und Handlungsspielräume von Großbanken in der NS-Zeit 237 Steffen Prauser Mord in Rom? Der Anschlag in der Via Rasella und die deutsche Vergeltung in den Fosse Ardeatine im März 1944 269 August H. Herbert Wehner und der Rücktritt Willy Brandts Leugers-Scherzberg am 7. Mai 1974 303 II Inhaltsverzeichnis NOTIZEN „Zum Stand der historischen Aufarbeitung kommunistischer Diktaturen". Internationale Arbeits tagung in der Berliner Außenstelle des Instituts für Zeitgeschichte München vom 29. November bis 1. Dezember 2001 (Christiane Künzel) 323 Zur Kontroverse über den Reichstagsbrand. Stellungnahme zu der in der Julinummer der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 2001 publi zierten Notiz (Hersch Fischler/Gerbard Brack) . 329 ABSTRACTS 335 MITARBEITER DIESES HEFTES 339 Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte im Internet: http://www.vierteljahrshefte.de Redaktion: http://www.ifz-muenchen.de GESCHÄFTLICHE MITTEILUNGEN © 2002 Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, München Die Lieferung geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers. -

From Cooperation to Complicity
From Cooperation to Complicity From Cooperation to Complicity is a study of the Degussa corporation, a firm that played a pivotal role in the processing of plundered precious metals in Nazi- occupied Europe and controlled the production and distribution of Zyklon B, the infamous pesticide used to gas the inmates of Auschwitz and Majdanek concentration camps, during the Third Reich. The author traces the extent of the corporation’s involvement in these and other Nazi war crimes, including the Aryanization of Jewish-owned property and the exploitation of forced labor, and delineates the motivations for such conduct. Peter Hayes is Professor of History and German and Theodore Z. Weiss Professor of Holocaust Studies at Northwestern University. He is the author of Industry and Ideology: IG Farben in the Nazi Era (new edition, Cambridge, 2001), which won the Conference Group on Central European History’s biannual book award in 1988. He is also editor of Lessons and Legacies: The Meaning of the Holocaust in a Changing World (1991) and four other collections. He has written more than fifty articles published in German French, and Italian, as well as English. In 1997–98, he was the Shapiro Senior Scholar in Residence at the U.S. Holocaust Memorial Museum. Advance praise for From Cooperation to Complicity ... “Bringing to bear a knowledge of business rare among historians, Peter Hayes has, on the basis of previously inaccessible company records, meticulously documented the moral corruption under Nazism of a ven- erable German firm whose executives allowed it to be drawn into ever- deeper implication in the crimes of Hitler’s regime.” – Henry Ashby Turner, Jr., Stille Professor of History Emeritus, Yale University “This outstanding study reaffirms Peter Hayes’ claim to be the world’s leading authority on business and the Third Reich. -

Die Chemische Industrie Herausgegeben Von Der Wirtschaftsgruppe Chemische Industrie Nachrichten-Ausgabe 62
DIE CHEMISCHE INDUSTRIE HERAUSGEGEBEN VON DER WIRTSCHAFTSGRUPPE CHEMISCHE INDUSTRIE NACHRICHTEN-AUSGABE 62. Jahrgang_________________________ BERLIN, t. APRIL 1939 Nr. 13 — 281 NACHDRUCK NUR MIT GENAUER QUELLENANGABE GESTATTET Deutschland und Rumänien, ein Wirtschaftsraum. wischen Deutschland und Rumänien ist am europäischen Kapitalgeber und unter dem Einfluß 23. März 1939 ein Wirtschaftsvertrag geschlos der Preisschwankungen am Weltmarkt. Je nach Zsen worden, der in vieler Hinsicht bemerkenswertdem, ob die Preise herauf- oder heruntergingen, ver ist, wegen der politischen Umstände und wegen sei mehrte oder verringerte sich die rumänische Aus ner richtunggebenden Bedeutung. Er ist geradezu fuhr. Stiegen die Ausfuhrerlöse, dann konnte die ein Vorbild, wie durch einen Vertrag die Wirt rumänische Wirtschaft auch größere Gewinne an schaftsbeziehungen zwischen einem hochentwickel ihre Kapitalgeber abführen, dann waren diese auch ten, aber rohstoffarmen Industrieland und einem wiederum bereit, noch weiter mit Krediten auszu mit Rohstoffen aller Art reich gesegneten, aber un- helfen und ein neues Stück rumänischen Naturreich erschlossenen Agrarland zum beiderseitigen Nutzen tums zu erschließen. Fielen dagegen die Preise, geregelt werden können. Deutschland verpflichtet dann sank die Ausfuhr, und Rumänien konnte kaum sich durch diesen Vertrag zu nichts mehr und nichts der Verpflichtung, Schulden und Zinsen zu zahlen, weniger, als die brachliegenden Möglichkeiten der nachkommen. Es mußte dann um politische An rumänischen Volkswirtschaft beschleunigt inner leihen bitten. halb von wenigen Jahren zur Entwicklung zu brin Die westeuropäischen Länder waren weder ge gen, Das Reich stellt dabei seine technischen und willt noch in der Lage, selbst die Ueberschüsse der wirtschaftlichen Erfahrungen sowie die fehlenden rumänischen Wirtschaft aufzunehmen. Sie wollten Sachgüter und Produktionsmittel zur Verfügung. Es nur Gold und Bardevisen sehen. -

The Development of Catalysis
Trim Size: 6.125in x 9.25in Single Columnk Zecchina ffirs.tex V2 - 02/20/2017 1:50pm Page i The Development of Catalysis k k k Trim Size: 6.125in x 9.25in Single Columnk Zecchina ffirs.tex V2 - 02/20/2017 1:50pm Page iii The Development of Catalysis A History of Key Processes and Personas in Catalytic Science and Technology Adriano Zecchina Salvatore Califano k k k Trim Size: 6.125in x 9.25in Single Columnk Zecchina ffirs.tex V2 - 02/20/2017 1:50pm Page iv Copyright © 2017 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey Published simultaneously in Canada No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise, except as permitted under Section 107 or 108 of the 1976 United States Copyright Act, without either the prior written permission of the Publisher, or authorization through payment of the appropriate per-copy fee to the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, (978) 750-8400, fax (978) 750-4470, or on the web at www.copyright.com. Requests to the Publisher for permission should be addressed to the Permissions Department, John Wiley & Sons, Inc., 111 River Street, Hoboken, NJ 07030, (201) 748-6011, fax (201) 748-6008, or online at http://www.wiley.com/go/permissions. Limit of Liability/Disclaimer of Warranty: While the publisher and author have used their best efforts in preparing this book, they make no representations or warranties with respect to the accuracy or completeness of the contents of this book and specifically disclaim any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. -

Die Implikationen Wirtschaftspolitischer Rahmenbedingungen Für Die Rohstoffbeschaffung Internationaler Industrieunternehmen
Die Implikationen wirtschaftspolitischer Rahmenbedingungen für die Rohstoffbeschaffung internationaler Industrieunternehmen und sich hieraus ergebende Unternehmensstrategien am Beispiel der Henkel-Gruppe Inaugural-Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Dr. rer. pol.) der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg vorgelegt von: Dipl.-Volkswirt Bernd Kaiser aus: Nürnberg Erstreferent: Professor Dr. Wilfried Feldenkirchen Zweitreferent: Professor Dr. Reinhard R. Doerries letzte Prüfung: 19. November 2009 Inhaltsverzeichnis II Inhaltsverzeichnis Seite 1 Einleitung 1 1.1 Einführung in das Thema 1 1.2 Zielsetzung, Untersuchungsgegenstand und Themenabgrenzung 3 1.3 Forschungsstand, Literatur- und Quellenlage 5 1.4 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit 11 2 Das Umfeld einer Unternehmung 13 2.1 Abgrenzung der Unternehmung von ihrem Umfeld 13 2.2 Mikro-Umwelt 16 2.3 Makro-Umwelt 20 2.4 Wirtschaftspolitik als bedeutendes Element der Unternehmensumwelt 24 2.5 Konzeptualisierung der Beziehung zwischen Unternehmen und Umwelt 30 3 Die Henkel-Gruppe als Beispielunternehmen 33 3.1 Skizzierung der Unternehmensentwicklung bis 1945 33 3.1.1 Die ersten Produkte: Geschäftsbehauptung von 1876 bis 1906 33 3.1.2 Der Durchbruch zum Großbetrieb: Die Markteinführung von Persil 1907 36 3.1.3 Die Nachkriegsjahre bis zum Höhepunkt der Inflation 1923 und die Aufnahme einer eigenen Klebstoffproduktion 1922 40 3.1.4 „Goldene Zwanziger“ und Weltwirtschaftskrise: Die Jahre 1924 bis 1932 42 3.1.5 -

Die Entwicklung Einer Gesamtdeutschen Marke Die Autoren
Die Entwicklung einer gesamtdeutschen Marke Die Autoren HELMUT HÖHNE • Jahrgang 1953, ab 1.9.1967 im VEB Waschmittelwerk Genthin: • Lehre zum Betriebsschlosser, danach Einsatz in den Abteilungen Zentralwerkstatt, Zerstäubung, Hauptpackerei, • Diplomingenieur (FH), Einsatz in der Technischen Rationalisierung, • Ingenieurpädagoge, Einsatz als Lehrausbilder, Leiter Betriebsakademie, • ab 1989/90 bei der Henkel KGaA im Vertrieb als Bezirksleiter und Regionalmanager, • seit 2012 Mitglied in der Gemeinschaft der Henkel-Pensionäre e.V., Gruppenkontakter der Gruppe Speefüchse. CHRISTEL FEHLBERG • Jahrgang 1942, • Ausbildung zur Chemielaborantin im Chemiefaserwerk Premnitz, • Chemie-Studium an den Technischen Universitäten Dresden und Magdeburg, Abschluss als Diplom-Chemikerin, ab 1967 im VEB Waschmittelwerk Genthin: • Wissenschaftliche Mitarbeiterin Forschung, • Gruppenleiterin Analytik, • Abteilungsleiterin Forschungsökonomie und -planung WOLFGANG MÜLLER (Forschungsvorbereitung), • Jahrgang 1942, ab 1989/90 bei der Henkel Genthin GmbH: ab 1959 im VEB Waschmittelwerk Genthin: • Leiterin Personalmanagement, Allgemeine Verwaltung, • Lehre als Chemiefacharbeiter, Diplomingenieur (FH), Diplom-Chemiker, Technik Standort, Schichtingenieur, Produktionsleiter, Abschnittsleiter Beads zerstäubung, • 1999 – 2013 Vorsitzende des Vorstands der Betriebsingenieur in der Produktionsdirektion, Henkel Friendship Initiative e.V., ab 1989/90 bei der Henkel Genthin GmbH: • 2007 – 2018 Mitglied des Vorstands der Gemeinschaft • Leiter Marketing und Vertrieb, der Henkel-Pensionäre -

Archiv Und Wirtschaft
Archiv und Wirtschaft Zeitschrift für das Archivwesen der Wirtschaft 50. Jahrgang · 2017 · Heft 3 Herausgegeben von der VEREINIGUNG DEUTSCHER WIRTSCHAFTSARCHIVARE E.V. Auf dem Fundament eines erfolgreichen Familienunternehmens – Das Konzernarchiv Henkel* Thomas Seidel mals einen Leim an eine benachbarte Firma. Heute ist Henkel mit seinen Klebstoffen für Konsumenten und Industrie globaler Marktführer für Klebstoffe, Dichtstoffe und Funktionsbeschichtungen. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 50 000 Mitarbeiter und ist mit seinen drei Unter- nehmensbereichen Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies am Markt vertre- ten. Aktueller Vorstandsvorsitzender ist Hans Van Bylen, den Vorsitz des Aufsichtsrats und des Ge- sellschafterausschusses hat Dr. Simone Bagel-Trah inne, Mitglied der fünften Generation der Familie Henkel und Ur-Ur-Enkelin des Firmengründers Fritz Henkel. Von der kleinen Sammelstelle zum Konzernarchiv Das Konzernarchiv Henkel geht in seinen Anfängen auf das Jahr 1910 zurück; es zählt damit zu den ältesten Unternehmensarchiven im deutschsprachi- Der Firmengründer Fritz Henkel sr. (1848–1930) im gen Raum. Elf Jahre nach dem Umzug des Unter- Jahr 1895 (Foto: Konzernarchiv Henkel) nehmens nach Holthausen wurde am Standort eine Kurzer Überblick über die Geschichte des Unternehmens Henkel Der Kaufmann Friedrich Karl „Fritz“ Henkel (1848 bis 1930) gründete 1876 in Aachen die Waschmit- telfirma „Henkel & Cie“. Als erstes Produkt stellte die Firma ein Pulver-Waschmittel auf Basis von Wasserglas her, das unter dem Namen Universal- Waschmittel vermarktet wurde. Das Nachfolge- Produkt Henkel’s Bleich-Soda wurde ab 1878 zum ersten Markenartikel-Erfolg von Henkel. Im selben Jahr verlagerte Fritz Henkel seine Firma aufgrund der besseren Verkehrsanbindungen nach Düssel- dorf. Nach einem weiteren Umzug innerhalb der Stadt kaufte Henkel 1899 ein großes Grundstück in Holthausen, damals ein Vorort von Düsseldorf.