GWZ Berlin · Das Forschungsjahr 2008
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Prayer Cards | Joshua Project
Pray for the Nations Pray for the Nations Agavotaguerra in Brazil Aikana, Tubarao in Brazil Population: 100 Population: 300 World Popl: 100 World Popl: 300 Total Countries: 1 Total Countries: 1 People Cluster: Amazon People Cluster: South American Indigenous Main Language: Portuguese Main Language: Aikana Main Religion: Ethnic Religions Main Religion: Ethnic Religions Status: Minimally Reached Status: Significantly reached Evangelicals: 1.00% Evangelicals: 25.0% Chr Adherents: 35.00% Chr Adherents: 50.0% Scripture: Complete Bible Scripture: Portions www.joshuaproject.net www.joshuaproject.net Source: Anonymous "Declare his glory among the nations." Psalm 96:3 "Declare his glory among the nations." Psalm 96:3 Pray for the Nations Pray for the Nations Ajuru in Brazil Akuntsu in Brazil Population: 300 Population: Unknown World Popl: 300 World Popl: Unknown Total Countries: 1 Total Countries: 1 People Cluster: South American Indigenous People Cluster: Amazon Main Language: Portuguese Main Language: Language unknown Main Religion: Ethnic Religions Main Religion: Ethnic Religions Status: Unreached Status: Minimally Reached Evangelicals: 0.00% Evangelicals: 0.10% Chr Adherents: 5.00% Chr Adherents: 20.00% Scripture: Complete Bible Scripture: Unspecified www.joshuaproject.net www.joshuaproject.net "Declare his glory among the nations." Psalm 96:3 "Declare his glory among the nations." Psalm 96:3 Pray for the Nations Pray for the Nations Amanaye in Brazil Amawaka in Brazil Population: 100 Population: 200 World Popl: 100 World Popl: 600 Total Countries: -

Th E a G a K H a N P R O G R a M Fo R Is La M Ic a R C H It
TH E AGA KHAN PROGRAM FOR ISLAMIC ARCHITECTURE & 1issue AKPIA AKDN Based at Harvard University and the The Aga Khan Trust for Culture (AKTC) is Massachusetts Institute of Technology, an agency of the Aga Khan Development The Aga Khan Program for Islamic Network (AKDN), a group of agencies Architecture (AKPIA) is dedicated to the founded by His Highness the Aga Khan akpia study of Islamic art and architecture, that work in the poorest parts of Asia and urbanism, landscape design, and conser- Africa.The Aga Khan Foundation focuses october 2004 a k t c vation - and the application of that on rural development, health, education knowledge to contemporary design proj- and the enhancement of non-governmen- TH features: ects. The goals of the program are to tal organizations. Its programmes includes E AGA KHAN TRUST FOR CULTURE improve the teaching of Islamic art and the Aga Khan Rural Support Programmes architecture - to promote excellence in and the Mountain Societies Development Lecture Series p.2 advanced research - to enhance the Support Programme. Aga Khan Health Aga Khan Program MIT p.3 understanding of Islamic architecture, Services is one of the largest private urbanism, and visual culture in light of health networks in the world. Aga Khan Aga Khan Program Harvard p.11 contemporary theoretical, historical, crit- Education Services operates more than Aga Khan Program GSD p.17 ical, and developmental issues - and to 300 schools and advanced educational Aga Khan Trust for Culture p.18 increase the visibility of Islamic cultural programmes at the pre-school, primary, heritage in the modern Muslim world. -
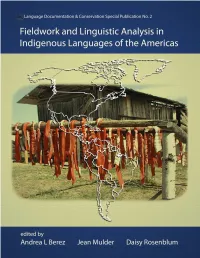
Fieldwork and Linguistic Analysis in Indigenous Languages of the Americas
Fieldwork and Linguistic Analysis in Indigenous Languages of the Americas edited by Andrea L. Berez, Jean Mulder, and Daisy Rosenblum Language Documentation & Conservation Special Publication No. 2 Published as a sPecial Publication of language documentation & conservation language documentation & conservation Department of Linguistics, UHM Moore Hall 569 1890 East-West Road Honolulu, Hawai‘i 96822 USA http://nflrc.hawaii.edu/ldc university of hawai‘i Press 2840 Kolowalu Street Honolulu, Hawai‘i 96822-1888 USA © All texts and images are copyright to the respective authors. 2010 All chapters are licensed under Creative Commons Licenses Cover design by Cameron Chrichton Cover photograph of salmon drying racks near Lime Village, Alaska, by Andrea L. Berez Library of Congress Cataloging in Publication data ISBN 978-0-8248-3530-9 http://hdl.handle.net/10125/4463 Contents Foreword iii Marianne Mithun Contributors v Acknowledgments viii 1. Introduction: The Boasian tradition and contemporary practice 1 in linguistic fieldwork in the Americas Daisy Rosenblum and Andrea L. Berez 2. Sociopragmatic influences on the development and use of the 9 discourse marker vet in Ixil Maya Jule Gómez de García, Melissa Axelrod, and María Luz García 3. Classifying clitics in Sm’algyax: 33 Approaching theory from the field Jean Mulder and Holly Sellers 4. Noun class and number in Kiowa-Tanoan: Comparative-historical 57 research and respecting speakers’ rights in fieldwork Logan Sutton 5. The story of *o in the Cariban family 91 Spike Gildea, B.J. Hoff, and Sérgio Meira 6. Multiple functions, multiple techniques: 125 The role of methodology in a study of Zapotec determiners Donna Fenton 7. -

Newsletterakp04-05.Pdf
TH E AGA KHAN PROGRAM FOR ISLAMIC KHAN PROGRAM ARCHITECTURE E AGA & 1issue AKPIA AKDN Based at Harvard University and the The Aga Khan Trust for Culture (AKTC) is Massachusetts Institute of Technology, an agency of the Aga Khan Development The Aga Khan Program for Islamic Network (AKDN), a group of agencies Architecture (AKPIA) is dedicated to the founded by His Highness the Aga Khan akpia study of Islamic art and architecture, that work in the poorest parts of Asia and aktc urbanism, landscape design, and conser- Africa. The Aga Khan Foundation focuses october 2004 vation - and the application of that on rural development, health, education knowledge to contemporary design proj- and the enhancement of non-governmen- TH features: ects. The goals of the program are to tal organizations. Its programmes includes E AGA KHAN TRUST FOR CULTURE TRUST KHAN E AGA improve the teaching of Islamic art and the Aga Khan Rural Support Programmes architecture - to promote excellence in and the Mountain Societies Development Lecture Series p.2 advanced research - to enhance the Support Programme. Aga Khan Health Aga Khan Program MIT p.3 understanding of Islamic architecture, Services is one of the largest private urbanism, and visual culture in light of health networks in the world. Aga Khan Aga Khan Program Harvard p.11 contemporary theoretical, historical, crit- Education Services operates more than Aga Khan Program GSD p.17 ical, and developmental issues - and to 300 schools and advanced educational Aga Khan Trust for Culture p.18 increase the visibility of Islamic cultural programmes at the pre-school, primary, heritage in the modern Muslim world. -

Análise Do Sistema De Marcação De Caso Nas Orações Independentes Da Língua Ikpeng
CILENE CAMPETELA Análise do Sistema de Marcação de Caso nas Orações Independentes da Língua Ikpeng Campinas UNICAMP 1997 CILENE CAMPETELA Análise do Sistema de Marcação de Caso nas Orações Independentes da Língua Ikpeng Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Lingüística do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Lingüística. Orientadora: Prof' Dra. Lucy Seki Campinas UNICAMP 1997 FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA IEL UNICAMP I :=a•npe tela, C 11 ene j,. 1 ~.::a l~~~~ ~ná!1se ~c ststema de marcaç~o de ca3c n.:3s or·açÕes Independentes ~a l ;n;;:;<.i1 li<p-::13 li Cka~1bl I ~t!ene Campetela -- Camptnas, li ii SP [s n J, 1'197 L'I Q,-tentador Luc; Sek1 I! D1ssertaç~o (mestrado. - Ur:Jers1dad? ii tadual de Camp1nas, Inst1tuto de Estudos d.> ii Lln:Jua:;:em H !I I.'I !I 1 ·~Jua~ 1ndigenas- ;ramát1ca 2 Lin- :i !i 3uas 1ndigeras- morfologia Seki, Lucy · \li Il Un1~ers1jade Estadual de Campinas ;ns- il , t1tutc de E~tudos da Ltnguagem III Tit~!G 11 ii "!I !i li d ií ~ i ~i'==============================================~d BANCA EXAMINADORA ~ t/-c-!6' Dra. Lucy S~entadora) .ff; 0-.;J __ I 9_}- . --1'e~>iêo Jec __ 4ec7 ~L·-·-·········-··-·· Data de aprovação: __/ __/_ Dedico este trabalho A MINHA FAMÍLIA, À COMUNIDADE IKPENG e a todos aqueles que de alguma forma contribuíram para a realização desta dissertação. Meus sinceros agradecimentos àLUCYSEKI ao FRANTOMÉ BEZERRA PACHECO (FRAN) ao CACIQUE MELOBO e ao OPORIKE, ao KOROTOwl, IOKORÉ, NAPIKI, MAIUÁ e a todos os meus "professores" Ikpeng SUMÁRIO L INTRODUÇÃO ............................................................................. -

Aspectos Prosódicos Da Língua Ikpeng
1 " CILENE CAMEETELA ASPECTOS PROSÓDICOS DA LÍNGUA IKPENG Tese apresentada ao Programa de Pós• Graduação em Lingüística, do Instituto de Estudos da Linguagem, da Universidade Estadual de Campinas, como requisito parcial para obtenção do título de Doutora em Lingüística. Orientadora: Prof' Dra. Lucy Seki Co-orientador: Prof. Dr. Luiz Carlos Cagjiari Campinas UNICAMP 2002 Cl""'\00172188-5 FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA IEL - UNICAMP Campetela, Cilene Cl54a Aspectos prosódicos da língua Ikpeng I Cilene Campetela. - - Campinas, SP: [s.n.], 2002. Orientador: Lucy Seki Co-orientador: Luiz Carlos Cagliari Tese (doutorado)- l)niversidade Estadual de Campinas, Instituto de Estudos da Linguagem. l. Língua indígena - Ikpeng - Karib. 2. Fonética. 3. Lingüística - Prosódica. I. Seki, Lucy. TI. Cagliari, Luiz Carlos. ill. Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Estudos da Linguagem. IV. Título. ~1~~ ::::;;;.,.a. ~--~ UNICAMP AUTORIZAÇAO PARA QUE A UHICAHP POSSA FORNECER, A P \ ÇO DE CUSTO, COPIAS DA TESE A INTERESSADOS tlome do Aluno: Ciler,e- COii'Y\peJciCil Registro Academfco: qL(5f!LJ6 . " curso: ~i Y'ICjLi,ís-kvCíl (Do u+omdo) , Ho me do _o r f e n ta do r: Lucy ScJ:j ® /L; C~ C:(Â/;L --=---- T1tulo da Dissertaçio ou Tese: '1 1\.sred-os. ?íQsÓdlC:os d-a Língwa IKpen3'' ( O Aluno deveri assina~ um dos .3 f tens abaixo } 1} Autorizo a Unf vcrs idad'!! Estadual de Ca111pf nu, a pa1 desta data, a fornecer a preço de custo, cõpias de minha Olsse1 çio ou Tese a interessados. l3 1 0.2.. t2CO.Z ~docw4:--t~ .> ass f na tu r a doAluno ............................ ' ..................................... " ......... ?l Autorizo a Universidade Estadual de Campinas, & for cer, a partir de dois anos apos esta data, a preço de custo, cõ as de minha Dlsjertaç4o ou Tese a interessados. -

Downloads/2003 Essay.Pdf, Accessed November 2012
UCLA UCLA Electronic Theses and Dissertations Title Nation Building in Kuwait 1961–1991 Permalink https://escholarship.org/uc/item/91b0909n Author Alomaim, Anas Publication Date 2016 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles Nation Building in Kuwait 1961–1991 A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Architecture by Anas Alomaim 2016 © Copyright by Anas Alomaim 2016 ABSTRACT OF THE DISSERTATION Nation Building in Kuwait 1961–1991 by Anas Alomaim Doctor of Philosophy in Architecture University of California, Los Angeles, 2016 Professor Sylvia Lavin, Chair Kuwait started the process of its nation building just few years prior to signing the independence agreement from the British mandate in 1961. Establishing Kuwait’s as modern, democratic, and independent nation, paradoxically, depended on a network of international organizations, foreign consultants, and world-renowned architects to build a series of architectural projects with a hybrid of local and foreign forms and functions to produce a convincing image of Kuwait national autonomy. Kuwait nationalism relied on architecture’s ability, as an art medium, to produce a seamless image of Kuwait as a modern country and led to citing it as one of the most democratic states in the Middle East. The construction of all major projects of Kuwait’s nation building followed a similar path; for example, all mashare’e kubra [major projects] of the state that started early 1960s included particular geometries, monumental forms, and symbolic elements inspired by the vernacular life of Kuwait to establish its legitimacy. -

As Divergências Em Análises Fonológicas Para O Ikpeng (Karib) Divergences in Phonological Analysis for Ikpeng (Karib)
DOI: 10.18468/rbli.2018v1n2.p19-35 19 As divergências em análises fonológicas para o Ikpeng (Karib) Divergences in phonological analysis for Ikpeng (Karib) Amanda Dias do Nascimento Universidade Federal do Amapá1 Angela Fabiola Alves Chagas Universide Federal do Pará2 Eduardo Alves Vasconcelos Universiadade Federal do Amapá3 Resumo. Esse estudo tem por objetivo apontar as divergências encontradas nas análises fonológicas para a Língua Ikpeng (Família Karib, ramo pekodiano), que é falada por aproximadamente 500 pessoas que vivem em quatro aldeias no Parque Indígena do Xingu (PIX), Mato Grosso. A fonologia da língua Ikpeng foi discutida por Emmerich (1972), Campetela (1997) e Pachêco (2001). Entre essas análises, há diferenças tanto do número de fonemas como na distribuição de alofones. Em síntese, essas análises divergem quanto: ao status fonológico da consoante [b] e da distribuição dos alofones bilabiais entre /p/ e /w/; o status fonológico dos glides /w/ e /j/; a proposição de um fonema africado /ʧ/; e, por fim, o status da oposição entre as velares /k/ e /g/. Para realizar essa análise, foram utilizados os dados disponíveis nos textos desses pesquisadores, acrescentando exemplos extraídos de dez narrativas tradicionais gravadas por Chagas entre 2009-2015 e transcritas por professores e outros membros da comunidade Ikpeng. Palavras-chave: Língua Ikpeng; Família Karib; Fonologia. Abstract. This study aims to show the differences observed in the phonological analysis for the Ikpeng Language (Karíb Family, Pekodian branch), which is spoken by approximately 500 people who lives in four villages in the Parque Indígena do Xingu (PIX), Mato Grosso. The phonology of the Ikpeng language was discussed by Emmerich (1972), Campetela (1997) and Pachêco (2001). -

Aspectos Prosódicos Da Língua Ikpeng
1 " CILENE CAMEETELA ASPECTOS PROSÓDICOS DA LÍNGUA IKPENG Tese apresentada ao Programa de Pós• Graduação em Lingüística, do Instituto de Estudos da Linguagem, da Universidade Estadual de Campinas, como requisito parcial para obtenção do título de Doutora em Lingüística. Orientadora: Prof' Dra. Lucy Seki Co-orientador: Prof. Dr. Luiz Carlos Cagjiari Campinas UNICAMP 2002 Cl""'\00172188-5 FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA IEL - UNICAMP Campetela, Cilene Cl54a Aspectos prosódicos da língua Ikpeng I Cilene Campetela. - - Campinas, SP: [s.n.], 2002. Orientador: Lucy Seki Co-orientador: Luiz Carlos Cagliari Tese (doutorado)- l)niversidade Estadual de Campinas, Instituto de Estudos da Linguagem. l. Língua indígena - Ikpeng - Karib. 2. Fonética. 3. Lingüística - Prosódica. I. Seki, Lucy. TI. Cagliari, Luiz Carlos. ill. Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Estudos da Linguagem. IV. Título. ~1~~ ::::;;;.,.a. ~--~ UNICAMP AUTORIZAÇAO PARA QUE A UHICAHP POSSA FORNECER, A P \ ÇO DE CUSTO, COPIAS DA TESE A INTERESSADOS tlome do Aluno: Ciler,e- COii'Y\peJciCil Registro Academfco: qL(5f!LJ6 . " curso: ~i Y'ICjLi,ís-kvCíl (Do u+omdo) , Ho me do _o r f e n ta do r: Lucy ScJ:j ® /L; C~ C:(Â/;L --=---- T1tulo da Dissertaçio ou Tese: '1 1\.sred-os. ?íQsÓdlC:os d-a Língwa IKpen3'' ( O Aluno deveri assina~ um dos .3 f tens abaixo } 1} Autorizo a Unf vcrs idad'!! Estadual de Ca111pf nu, a pa1 desta data, a fornecer a preço de custo, cõpias de minha Olsse1 çio ou Tese a interessados. l3 1 0.2.. t2CO.Z ~docw4:--t~ .> ass f na tu r a doAluno ............................ ' ..................................... " ......... ?l Autorizo a Universidade Estadual de Campinas, & for cer, a partir de dois anos apos esta data, a preço de custo, cõ as de minha Dlsjertaç4o ou Tese a interessados. -

FY96 NCAR ASR Highlights
FY96 NCAR ASR Highlights 1996 ASR Highlights Highlights of NCAR's FY96 Achievements These are the most significant highlights from each NCAR division and program. Atmospheric Chemistry Division Highlights data missing Atmospheric Technology Division Highlights AVAPS/GPS Dropsonde System The development of the advanced Airborne Vertical Atmospheric Profiling System (AVAPS)/GPS Dropsonde System was close to completion at the end of FY 96. This work has been supported by NOAA and the Deutsche Forschungsanstalt fuer Luft- und Raumfahrt (DLR, Germany). AVAPS has now progressed to the point where all the NOAA data systems (two four-channel systems plus spares for the NOAA G-IV aircraft and two four-channel systems plus spares for the NOAA P-3 aircraft) have been delivered, and the initial flight testing has been completed. Both high-level (45,000-foot-altitude) and low-level (22,000-foot-altitude) drop tests have been completed, including intercomparison tests in which sondes were dropped from both the G-IV and the P-3s. Data taken by the AVAPS system on the G-IV and by a second system installed in a leased Lear 36 aircraft are expected to play a key role in the Fronts and Atlantic Storm Tracks Experiment (FASTEX), scheduled for early 1997. The DLR four-channel AVAPS system is currently being built and will be installed on the DLR Falcon aircraft in March 1997. NCAR has transferred the technology to the public sector by licensing a commercial firm (Vaisala, Inc.) to build future GPS sondes and data systems. This effort is led by Hal Cole and Terry Hock. -

Translation of Modjtaba's Article 2012-2020
Weekendavisen #38 21. september 2012 Everyday Life. Is it really the case, that shame praised Copenhagen is a closed city, while troubled Teheran is open? ”Copenhagen is naked, but wears sunglasses” BY PERNILLE STEENSGAARD Philosopher and urban researcher Modjtaba Sadria has come directly from Tehran, capital city of Iran, to Copenhagen. From one of the top ten worst cities in the world to one of the best. According to some sources “the best”. From a mega city with suffocating pollution, murderous traffic and a dense population of 8-10 million with record high stress levels to a small clean city of bicyclers inhabited with the “world’s happiest people”. Still, Dr.phil. Modjtaba Sadria, born 1949, is hardly overcome with admiration. He knows Copenhagen and has been here on several occasions. Furthermore, he is educated in Germany and France. He has taught at universities in Canada, Japan and Australia. In the last three years, Dr. Sadria has lived and worked in Teheran, his native country. His interests concentrate around what it takes to create good cities to live in. “Copenhagen is proud of being full of relaxed and informal overlapping relationships, but moving across these highly structured groups is not easy, and demands knowledge of some local “oldboy-clubs”. You have given the world the illusion that the Scandinavians are an open society. And this illusion works even for the people themselves. As guest speaker in the mobile network of the Nomad Academy, whose goal is to exchange knowledge and ideas on art, design and architecture across borders, Dr. Sadria maintains a critical view of the networks that split modern man into atoms. -

Downloaded on 2 February 2009 From
Homogenisation of Representations Edited by Modjtaba Sadria Aga Khan Award for Architecture Acknowledgements Contents The second of two Knowledge Construction workshops organised by the Aga Khan Award Acknowledgements 2 for Architecture was held in Vancouver on the 26–28 February 2009. The workshop, on the topic of ‘Homogenisation of Representations’ was conceptualised and implemented Preface 5 on behalf of the Award by Professor Modjtaba Sadria, member of the 2007 Award Steering Farrokh Derakhshani Committee. List of Contributors 7 The Award would like to thank Professor Sadria and the participants of the workshop Introduction 11 for their thoughtful and engaging presentations and the stimulating discussions around the Modjtaba Sadria topic, all of which are reproduced in this publication. Section One: Foundations Special thanks are due to Rebecca Williamson of the Institute for the Study of Muslim Globalisation and Homogenisation: The State of Play 17 Civilisations in London (AKU-ISMC) for her assistance with the organisation of the Anthony King workshop and subsequently with the preparation of this book for publication. The Anxiety Concerning Cultural Homogenisation 35 Ian Angus The Homogenisation of Urban Space 51 Modjtaba Sadria Section Two: Building Blocks Conscious and Unconscious Aspects of Homogenisation Processes in Architectural Representation 69 George Baird Note: All images, unless otherwise noted, are courtesy of the author. Neither Homogeneity Nor Heterogeneity: Modernism’s Struggles Published by the Aga Khan Award for Architecture