Ein „Weiber-Freund"?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Reclams Buch Der Deutschen Gedichte
1 Reclams Buch der deutschen Gedichte Vom Mittelalter bis ins 21. Jahrhundert Ausgewählt und herausgegeben von Heinrich Detering Reclam 2 3 Reclams Buch der deutschen Gedichte Band i 4 4., durchgesehene und erweiterte Auflage Alle Rechte vorbehalten © 2007, 2017 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart Gestaltung bis S. 851: Friedrich Forssman, Kassel Gestaltung des Schubers: Rosa Loy, Leipzig Satz: Reclam, Ditzingen Druck und buchbinderische Verarbeitung: GGP Media GmbH, Pößneck Printed in Germany 2017 reclam ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart isbn 978-3-15-011090-4 www.reclam.de Inhalt 5 Vorwort 9 [Merseburger Zaubersprüche] 19 • [Lorscher Bienensegen] 19 • Notker iii. von St. Gallen 20 • Der von Kürenberg 20 • Albrecht von Johansdorf 21 • Dietmar von Aist 23 • Friedrich von Hausen 24 • Heinrich von Morungen 25 • Heinrich von Veldeke 28 • [Du bist mîn, ich bin dîn] 29 • Hartmann von Aue 30 • Reinmar 30 • Walther von der Vogelweide 34 • Wolfram von Eschenbach 46 • Der Tannhäuser 48 • Neidhart 52 • Ulrich von Lichtenstein 55 • Mechthild von Magdeburg 57 • Konrad von Würzburg 59 • Frauenlob 61 • Johannes Hadloub 62 • Mönch von Salzburg 63 • Oswald von Wolkenstein 65 • Hans Rosenplüt 71 • Martin Luther 71 • Ulrich von Hutten 74 • Hans Sachs 77 • Philipp Nicolai 79 • Georg Rodolf Weckherlin 81 • Martin Opitz 83 • Simon Dach 85 • Johann Rist 91 • Friedrich Spee von Lan- genfeld 93 • Paul Gerhardt 96 • Paul Fleming 104 • Johann Klaj 110 • Andreas Gryphius 111 • Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau -
![[' 2. 0 0 7-] Poetics and Rhetorics in Early Modern Germany](https://docslib.b-cdn.net/cover/6851/2-0-0-7-poetics-and-rhetorics-in-early-modern-germany-1126851.webp)
[' 2. 0 0 7-] Poetics and Rhetorics in Early Modern Germany
Early Modern German Literature 1350-1700 Edited by Max Reinhart Rochester, New York u.a. CAMDEN HOUSE [' 2. 0 0 7-] Poetics and Rhetorics in Early Modern Germany Joachim Knape ROM ANTIQUIIT ON, REFLECTION ON MEANS of communication - an texts Fin general and poetic texts in particular- brought about two distinct gen res of theoretical texts: rhetorics and poetics. Theoretical knowledge was sys tematized in these two genres for instructional purposes, and its practical applications were debated down to the eighteenth century. At the center of this discussion stood the communicator (or, text producer), armed with pro cedural options and obligations and with the text as his primary instrument of communication. Thus, poeto-rhetorical theory always derived its rules from and reflected the prevailing practice.1 This development began in the fourth century B.C. with Aristotle's Rhetoric and Poetics, which he based an the public communicative practices of the Greek polis in politics, theater, and poetic performance. In the Roman tra dition, rhetorics2 reflectcd the practice of law in thc forum (genus iudiciale), political counsel (genus deliberativum), and communal decisions regarding issues of praise and blame (genus demonstrativum). These comprise the three main speech situations, or cases (genera causarum). The most important the oreticians of rhetoric were Cicero and Quintilian, along with the now unknown author (presumed in the Middle Ages to have been Cicero) of the rhetorics addressed to Herennium. As for poetics, aside from the monumental Ars poet ica ofHorace, Roman literature did not have a particularly rich theoretical tra dition. The Hellenistic poetics On the Sublime by Pseudo-Longinus (first century A.D.) was rediscovered only in the seventeenth century in France and England; it became a key work for modern aesthetics. -

Bach Chor Berlin
BACH-CHOR AN DER KAISER-WILHELM-GEDÄCHTNIS-KIRCHE JOHANN SEBASTIAN BACH Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem BWV 159 Sonnabend, 2. März 2019, 18 Uhr Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche Berlin Mitwirkende Kantategottesdienst Alt Susanne Langner Tenor Volker Arndt JOHANN PACHELBEL Ciacona f-Moll 1653-1706 Bass Philipp Kaven Orgelpositiv Peter Uehling Orgel Jonas Sandmeier Bach-Chor Liturgin Eingangsvotum Bach-Collegium Leitung Achim Zimmermann Gebet Liturgin Pfarrerin Kathrin Oxen Schriftlesung: 1. Korinther 13,1-13 Am Ausgang erbitten wir sehr herzlich eine Spende zur Durchführung unserer Kantategottesdienste. 2 1 Gemeinde Wir glauben all an einen Gott [EG 183] Liturgin Schriftlesung: Lukas 18,31-43 Ansprache Gemeinde Lasset uns mit Jesus ziehen [EG 384] . : . 2. Lasset uns mit Jesus leiden, / seinem Vorbild werden gleich; / nach dem Leide folgen Freuden, / Armut hier macht dorten reich, / Tränensaat, die erntet Lachen; / Hoffnung tröste die Geduld: / Es kann leichtlich Gottes Huld / aus dem Regen Sonne machen. / Jesu, hier leid ich mit dir, / dort teil deine Freud mit mir! 4. Lasset uns mit Jesus leben. / Weil er auferstanden ist, / muss das Grab uns wiedergeben. / Jesu, unser Haupt du bist, / wir sind deines Leibes Glieder, / wo du lebst, da leben wir; / ach erkenn uns für und für, / trauter Freund, als deine Brüder! / Jesu, dir ich lebe hier, / dorten ewig auch bei dir. Text: Sigmund von Birken 1653 Melodie: Sollt ich meinem Gott nicht singen (Nr. 325) Liturgin Biblisches Votum 2 3 J. S. BACH Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem Recitativo -

Yale Collection of German Baroque Literature Author Index 1
Yale Collection of German Baroque Literature Author Index Abel, Caspar. Abele, Matthias, d.1677. Diarium Belli Hispanici, oder Vollstindiges Tag-Register Vivat oder so genandte künstliche Unordnung. des jetzigen Spanischen Krieges wie er Von 1701. Nürnberg, Bey Michael und Johann Friederich Endtern. 1670 zur Recommendation Eines Auff den blank Januarii. 1707 Item No. 659a; [I.-V. und letzter Theil] Worinnen 40.[i.e. 160] Item No. 1698b; bis 1707. ... geführet worden samt... dem was wunderseltzame Geschichte...meist aus eigener Erfahrung, sich mit den Ungern und Sevennesern zugetragen...; zusammen geschrieben...durch Matthiam Abele, von und zu angestellten Actus Oratorii, ... heraus gegeben Von Casp. Lilienberg...; [75]; 4v. in 2. fronts. (v.1,2) 13-14 cm.; Title and Abeln ... Halberstadt Gedruckt bey Joh. Erasmus Hynitzsch imprint of 3,5 vary; Vol.1 has title: Künstliche Unordnung; Königl. Preuß. Hof-Buchdr; [12]p., 34 cm. Signatures: [A] - das ist, Wunder-seltsame, niemals in offentlichen Druck C2. gekommene...Begebenheiten...Zum andernmal aufgelegt. Reel: 603 [n.p.]. Reel: 160 Abel, Caspar, 1676-1763. Caspar Abels auserlesene Satirische Gedichte, worinnen Abraham à Sancta Clara, 1644?-1709. viele jetzo im Schwange gehende Laster, auf eine zwar freye, Abrahamische Lauber-Hütt. und schertzhaffte doch vernünfftige Art gestrafet werden; und Wien und Mürnberg, Verlegts J.P. Krauss. 1723-38 Theils ihrer Vortrefligkeit halber aus dem berühmten Boileau Item No. 1131; Ein Tisch mit Speisen in der Mitt...Denen und Horatio übersetzet Theils auch nach deren Vorbilde Juden zum Trutz, denen Christen zum Nutz an- und verfertiget sind. aufgerichtet, wie auch mit mit vielen auserlesenen so wohl Quedlinburg und Aschersleben, verlegts Gottlob Ernst biblischen als andern sinnreichen Concepten, Geschichten und Struntze. -

University of Birmingham Rethinking Agency and Creativity
University of Birmingham Rethinking agency and creativity Brown, Hilary DOI: 10.1080/14781700.2017.1300103 License: None: All rights reserved Document Version Peer reviewed version Citation for published version (Harvard): Brown, H 2017, 'Rethinking agency and creativity: translation, collaboration and gender in early modern Germany', Translation Studies, vol. 11, no. 1, pp. 84-102. https://doi.org/10.1080/14781700.2017.1300103 Link to publication on Research at Birmingham portal Publisher Rights Statement: This is an Accepted Manuscript of an article published by Taylor & Francis in Translation Studies on 18th April 2017, available online: http://www.tandfonline.com/10.1080/14781700.2017.1300103. General rights Unless a licence is specified above, all rights (including copyright and moral rights) in this document are retained by the authors and/or the copyright holders. The express permission of the copyright holder must be obtained for any use of this material other than for purposes permitted by law. •Users may freely distribute the URL that is used to identify this publication. •Users may download and/or print one copy of the publication from the University of Birmingham research portal for the purpose of private study or non-commercial research. •User may use extracts from the document in line with the concept of ‘fair dealing’ under the Copyright, Designs and Patents Act 1988 (?) •Users may not further distribute the material nor use it for the purposes of commercial gain. Where a licence is displayed above, please note the terms and conditions of the licence govern your use of this document. When citing, please reference the published version. -

Johann Sebastian Bach Himmelskönig Sei Willkommen, Kantate BWV 182 Antonio Vivaldi Kyrie, RV 587 Beatus Vir, RV 598 Blockflöten-Konzert, RV 435
KONZERT ZUM FRÜHLINGSANFANG PROGRAMMHEFT Sonntag, 11. März 2018 Heiliggeistkirche Bern Kirche Steffisburg Johann Sebastian Bach Himmelskönig sei willkommen, Kantate BWV 182 Antonio Vivaldi Kyrie, RV 587 Beatus vir, RV 598 Blockflöten-Konzert, RV 435 Jeannine Camencind, Sopran Astrid Pfarrer, Alt Nino Aurelio Gmünder, Tenor Stefan Vock, Bass Giorgio Schneeberger, Blockflöte Bach-Collegium Bern (Nevena Tochev, Konzertmeisterin) Marc Fitze, Orgel Josef Zaugg, Leitung gewünschte Kollekte für Morgenmusik und Konzert Fr. 30.– kantatenchor-bern.ch Text: Theo Schaad Layout: Josef Zaugg Antonio Vivaldi, 1678-1741 Antonio Vivaldi verbrachte die meiste Zeit seines Lebens in Venedig. Er war Violinist und hatte soweit Theologie studiert, dass er zum Priester geweiht wurde. Wegen sei- nes Asthmas war er nicht in der Lage, die Messe zu lesen. Im Laufe der Zeit wurde er mehr und mehr verantwortlich für das Musikleben am Hospitale della Pietà, einem Waisenhaus für Mädchen. Das zugehörige Orchester genoss einen exzellenten Ruf. Es entstanden im Laufe der Zeit mehrere hundert Concerti, aber auch kirchliche Chor- werke, darunter das weit verbreitete Gloria. Kyrie RV 587 für 8 Stimmen in zwei Chören und Instrumente Das doppelchörige Kyrie umfasst den ersten Teil des Messe-Ordinariums. Das Instru- mentalstück zum Eingang ist zweigeteilt. Es beginnt mit ganzen Noten und geht dann in schnelle Achtel über. So beginnen auch die Chöre gemeinsam die ersten zwölf Takte und teilen sich dann in einem bewegten zweiten Abschnitt. Das Christe eleison wird, begleitet von kräftigen Streicherklängen, von den Frauenstimmen der beiden Chöre gesungen (den Part von Chor I übernehmen in dieser Aufführung die Solistinnen). Das zweite Kyrie beginnt wieder in einem breiten Adagio, das dann in ein rasches Ricer- care übergeht. -

500 Jahre „Weißenburger Ratsbibliothek“ 1517 - 2017
500 Jahre „Weißenburger Ratsbibliothek“ 1517 - 2017 Den Grundstein der Weißenburger Stadtbibliothek, die meist als „Ratsbibliothek“ be - zeichnet wird, weil der Rat der Stadt als oberste Verwaltungsbehörde agierte und wohl auch hauptsächlicher Nutzer war, legte im Jahr 1517 Andreas Wurm, Doktor beider Rechte, Kanonikus, Dechant des Kollegiatstifts St. Germanus und Mauritius in Speyer und Pfarrer in Gunzenhausen. Er vermachte seine überwiegend aus juristischen Werken bestehende Bibliothek seiner Heimatstadt. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts ging die Betreuung der Bibliothek von den Kirchen- auf die Schuldiener über. Bei der engen Verflechtung von Kirche und Schule seit dem späten Mittelalter und bei der zunehmenden Bedeutung auch der Weißenburger Lateinschule im 16. Jahrhundert, ist dies aber nicht weiter verwunderlich. Die Oberauf - sicht über die Bibliothek behielt das mit Ratsherrn besetzte Pflegamt, das sämtliche Kir - chen, Stiftungen und Schulen der Stadt gemeinsam verwaltete. Um die Wende zum 19. Jahrhundert begann die Stadt damit, zur Schuldentilgung einen Teil ihrer Liegenschaften an die Bürger zu veräußern und man machte auch vor der altehrwürdigen Ratsbibliothek nicht halt. Im Sommer 1802 verkaufte man acht In - kunabeln an einen britischen Diplomaten am Reichstag in Regensburg. Der Rest blieb vor Ort, bis auf einige ausgesuchte Werke, die 1807 nach Ansbach abgegeben werden mussten. Über diesen Bestand fertigte der örtliche Schulleiter Johann Melchior Günther im Jahr 1829 ein Verzeichnis, das für die nächsten gut hundert Jahre als Bestandskatalog benutzt und fortgeführt wurde. Als Findmittel allerdings war Günthers Katalog ungeeig - net, weil er bei Sammelwerken stets nur das erste erfasst hat. Erst mit dem 1949 von Dr. Friedrich Blendinger erstellten umfangreichen Verfasserkatalog ist der Bestand er - schlossen. -

Simplicissimus : the German Adventurer / by Hans Jacob Christoffel Von Grimmelshausen ; Translated by John C
by Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen Simplicissimus,The German Adventurer Translated by JOHN C. OSBORNE With a Foreword by LYNNE TATLOCK Simplicissimus, The German Adventurer by Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen Translated by JOHN C. OSBORNE The GermanWith a Foreword Adventurer by Simplicissimus,LYNNE TATLOCK The German Simplicißimus That is: The Description of the Life of a Peculiar Wanderer Named Melchior Sternfels von Fuchshaim, Including Where and in What Manner He Came into This World, What He Saw, Learned, Experienced and Put Up With Therein; Also Why He Voluntarily Left It. Exceedingly Amusing and in Many Ways Useful to Read. Brought to Light by German Schleifheim of Sulsfort Monpelgart Printed in the Shop of Johann Fillion In the Year 1669. Newfound Press THE UNIVERSITY OF TENNESSEE LIBRARIES, KNOXVILLE Simplicissimus, The German Adventurer © 2008 by Martha Lee Osborne All rights reserved. Newfound Press is a digital imprint of the University of Tennessee Libraries. Its publications are available for non-commercial and educational uses, such as research, teaching and private study. The author encourages the “fair use” of these materials as defined in current U.S. Copyright Law. You may reproduce Newfound Press materials by printing, downloading, or making copies without prior permission as long as the original work is credited. For all other uses, contact: Newfound Press University of Tennessee Libraries 1015 Volunteer Boulevard Knoxville, TN 37996-1000 www.newfoundpress.utk.edu Cover illustration is frontispiece from the 1669 edition, courtesy of the Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University. ISBN-13: 978-0-9797292-2-5 ISBN-10: 0-9797292-2-x Grimmelshausen, Hans Jakob Christoph von, 1625-1676. -

Seniorthesis2012freesenauma
THE HYMN OF THE DAY: ITS DEVELOPMENT AND USE BY DANIEL T. NAUMANN PATRICK S. FREESE A THESIS SUBMITTED TO THE FACULTY IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF DIVINITY PROF. JAMES P. TIEFEL, ADVISOR WISCONSIN LUTHERAN SEMINARY MEQUON, WISCONSIN MARCH 2012 ABSTRACT This thesis depicts the development of the Hymn of the Day as it was born out of Luther’s Graduallied and how the concept of the Hymn of the Day was born out of the Lutheran Reformation. The Graduallied was a hymn Luther added after the Epistle was read which focused on the season of the Church Year. As new hymns were created the Lutherans replaced the Graduallied with the Hauptlied, or the Hymn of the Day. The Hymn of the Day was a hymn that fit the theme of the assigned Gospel for a Sunday or festival service. As this thesis examines the rise of the Hymn of the Day, it also examines its fall into disuse by many parts of the Lutheran Church and how the liturgical reawakening within Lutheranism has brought the Hymn of the Day back into use within much of the Lutheran Church. While this thesis discusses the development of the Hymn of the Day within Lutheranism in general, it focuses attention in detail upon the Hymn of the Day and its use within the Wisconsin Evangelical Lutheran Synod. This thesis also notes some of the tensions Lutherans have had related to the Hymn of the Day. i TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION 1 PART I. DEVELOPMENT OF THE HYMN OF THE DAY 2 Chapter 1. -

JOHN ROGER PAAS William H. Laird Professor of German and the Liberal Arts, Emeritus Carleton College 1 Barren Down House Leg
JOHN ROGER PAAS William H. Laird Professor of German and the Liberal Arts, Emeritus Carleton College 1 Barren Down House Leg Square Shepton Mallet Somerset BA4 5LL UK 01749 - 939431 [email protected] EDUCATION: Bryn Mawr College 9/67-5/73 Ph. D. Hamilton College 9/63-6/67 B. A. (summa cum laude; Phi Beta Kappa) DISSERTATION “The Seventeenth-century Verse Broadsheet: A Study of Its Character and TITLE: Literary-Historical Significance” MILITARY SERVICE: 9/69-8/71 EMPLOYMENT: Carleton College 1974-2015 Professor Northfield, MN Chair: 1985-88, 1999-2000, 2007-11 Bryn Mawr College 9/73-5/74 Part-time Assistant Bryn Mawr, PA Professor POSTGRADUATE National Endowment for the 1/04-9/04 GRANTS: Humanities, Fellowship Alexander von Humboldt 12/00-7/01 Senior Research Fellowship National Endowment for the 9/92-6/93 Humanities, Texts/Editions Visiting Fellowship 11/91-12/91 Beinecke Library, Yale Univ. NEH Travel to Collections 7/90 Fulbright Senior Research 9/88-7/89 Fellowship Carleton College Faculty 1/85-4/85 Development Grant Bush Foundation Faculty 9/78-12/78 Development Grant IREX Fellowship 3/78-6/78 Andrew W. Mellon 7/76-8/76 Foundation Summer Grant German Academic Exchange 6/75-8/75; 7/78-8/78; 7/83-8/83 Service (DAAD) Summer Grant PROFESSIONAL Gutenberg Society ORGANIZATIONS: Wolfenbütteler Arbeitskreis für Barockforschung Sixteenth Century Society Society of German Renaissance and Baroque Literature (President, 1999) PUBLICATIONS BOOKS: The German Political Broadsheet 1600-1700. 14 vols. Wiesbaden: Harrassowitz, 1985- 2017. ed., America Sings of War: American Sheet Music from World War I. -
Bachwoche Ah C Bachwoche
—15 3 BIS —22 3 — B 2015 BACHWOCHE AH C BACHWOCHE ›AUF DEM WEG‹ PASSION . OSTERN . HIMMELFAHRT INHALT GRUSSWORT 2 TERMINE KONZERTE 4 GOTTESDIENSTE 6 SEMINAR & MUSEUMSFÜHRUNG 6 PODIUMSGESPRÄCHE 7 ÖFFENTLICHE PROBEN 8 BACHBEWEGT! SINGEN! 9 STUDIUM GENERALE 9 CHOR DER BACHWOCHE 9 DIE BACHWOCHE AUF EINEN BLICK 10 ALLE ORTE DER BACHWOCHE 8 ERÖFFNUNGSKONZERT SONATEN UND KANTATEN VON DIETERICH BUXTEHUDE PROGRAMM 12 DATEN & FAKTEN 13 EINFÜHRUNG 15 GESANGSTEXTE 20 WERKSTATTKONZERTE II – IV & ABSCHLUSSKONZERT & PODIUMSGESPRÄCHE PASSION – OSTERN – HIMMELFAHRT DATEN & FAKTEN 24 EINFÜHRUNG 26 BIBEL- & GESANGSTEXTE 33 WERKSTATTKONZERTE I CHORMUSIK AUS ENGLAND UND AMERIKA DATEN & FAKTEN 48 GESANGSTEXTE 52 BACHBEWEGT! SINGEN! 68 JSB ENSEMBLE 70 KURSTEILNEHMER 74 BIOGRAFIEN VON A BIS Z 76 FÖRDERKREIS BACHAKADEMIE 72 DANK 97 BACHWOCHE STUTTGART 2015 15. – 22. MÄRZ ›AUF DEM WEG‹ PASSION – OSTERN – HIMMELFAHRT »Himmelskönig, sei willkommen« Kantate BWV 182 »Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott« Kantate BWV 127 Oster-Oratorium BWV 249 Himmelfahrts-Oratorium BWV 11 . MEISTERKURS JOHANN SEBASTIAN BACH . MEISTERKURSE GESANG . KONZERTE . GOT TESDIENSTE . PODIUMSGESPRÄCHE . WERKSSTATTKONZERTE . SEMINAR & MUSEUMSFÜHRUNG . ÖFFENTLICHE PROBEN . CHOR DER BACHWOCHE . BACHBEWEGT! SINGEN! Mit freundlicher Unterstü;ung von: ® In Zusammenarbeit mit der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stu:gart Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Bachakademie und liebe Bach-Fans, zur Bachwoche im Jahre 2015 Passion, Ostern und Himmelfahrt, diese drei -
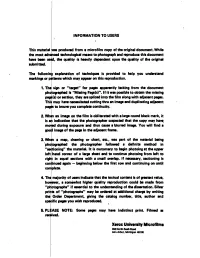
On Xerox University Microfilms
INFORMATION TO USERS This material was produced from a microfilm copy of the original document. While the moat adwancod technological meant to photograph and reproduce thit document have been the quality it heavily dependent upon the quality of the original submitted. The following explanation of techniques it provided to help you underttand merfcingi orputtemswhich may appear on thit reproduction. 1. The tign or "target" for pages apparently lacking from the document photographed it "Mining Pagt(t)". If it wet possible to obtain the mining pagu(i) or taction, they are spliced into the film along with adjacent pages. This may have necessitated cutting thru an image and duplicating adjacent to insure you complete continuity. 2. Whan an image on the film it obliterated with a large round black mark, it It on indication that the photographer suspected that the copy may have m during exposure end thus cause e blurred image. You will find a flood image of the page in the adjacent frame. 3. Whin a map, drawing or chart, etc., was part of the material being phatographed the photographer followed a definite method in "sectioning" the material. It it customary to begin photoing at the upper left hand comer of a large sheet end to continue photoing from left to right in equal sections with e small overlap. If necessary, sectioning is continued again — beginning below the first row and continuing on until complete. 4. Ths majority of users indicate that the textual content is of greatest value, hovwver, a somewhat higher quality reproduction could be made from 'photographs" if essential to the understanding of the dissertation.