1081375049.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
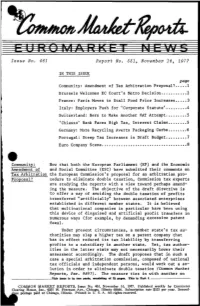
Issue No. 461 Report No. 331, November 16, 19,7
Issue No. 461 Report No. 331, November 16, 19,7 IN THIS ISSUE page CoIIlIIlunity: Amendment of Tax Arbitration Proposal? ••.•• ! Brussels Welcomes EC Court's Metro Decision .••••••.••• 2 France: Paris Moves to Stall Food Price Increases •••.• 3 Italy: Employers Push for 'Corporate Statute' ••••.•..• 4 Switzerland: Bern to Make Another VAT Attempt •.••.•••• 5 'Chiasso' Bank Faces High Tax, Interest Claims •••.•••• 5 Germany: More Recycling Averts Packaging Curbs •.•••••• 6 Portugal: Steep Tax Increases in Draft Budget ••••••••• 7 Euro Company Scene ... ,, ............ ,,,,,,, ... ,,,,.,,,, 8 Community: Now that both the European Parliament (EP) and the Economic •Amendment of and Social Committee (ESC) have submitted their comments on Tax Arbitration the European Commission's proposal for an arbitration pro- Proposal? cedure to eliminate double taxation, Commission tax experts are studying the reports with a view toward perhaps amend ing the measure. The objective of the draft directive is to offer a way of avoiding the double taxation of profits transferred "artificially" between associated enterprises established in different member states. It is believed that multinational companies in particular have been using this device of disguised and artificial profit transfers in numerous ways (for example, by demanding excessive patent fees). Under present circumstances, a member state's tax au thorities may slap a higher tax on a parent company that has in effect reduced its tax liability by transferring profits to a subsidiary in another state. Yet, tax author ities in the latter state may not necessarily lower their assessment accordingly. The draft proposes that in such a case a special arbitration commission, composed of national tax officials and independent persons, would work out a so lution in order to eliminate double taxation (Common Market Reports, Par. -

Bd. 5: Deutsch- 29 Hs
willy brandt Berliner Ausgabe willy brandt Berliner Ausgabe Herausgegeben von helga grebing, gregor schöllgen und heinrich august winkler Im Auftrag der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung band 1: Hitler ist nicht Deutschland. Jugend in Lübeck – Exil in Norwegen 1928 – 1940 band 2: Zwei Vaterländer. Deutsch-Norweger im schwedischen Exil – Rückkehr nach Deutschland 1940 – 1947 band 3: Berlin bleibt frei. Politik in und für Berlin 1947 – 1966 band 4: Auf dem Weg nach vorn. Willy Brandt und die SPD 1947 – 1972 band 5: Die Partei der Freiheit. Willy Brandt und die SPD 1972 – 1992 band 6: Ein Volk der guten Nachbarn. Außen- und Deutschlandpolitik 1966 – 1974 band 7: Mehr Demokratie wagen. Innen- und Gesellschaftspolitik 1966 – 1974 band 8: Über Europa hinaus. Dritte Welt und Sozialistische Internationale band 9: Die Entspannung unzerstörbar machen. Internationale Beziehungen und deutsche Frage 1974 – 1982 band 10: Gemeinsame Sicherheit. Internationale Beziehungen und deutsche Frage 1982 – 1992 willy brandt Berliner Ausgabe band 5 Die Partei der Freiheit Willy Brandt und die SPD 1972 – 1992 Bearbeitet von karsten rudolph Verlag J.H.W. Dietz Nachf. GmbH Die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung bedankt sich für die groß- zügige finanzielle Unterstützung der gesamten Berliner Ausgabe bei: Frau Ursula Katz, Northbrook, Illinois Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, Essen Otto Wolff von Amerongen-Stiftung, Köln Stiftungsfonds Deutsche Bank im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e. V., Essen Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH, Hamburg Bankgesellschaft Berlin AG Herlitz AG, Berlin Metro AG, Köln Schering AG, Berlin Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; dataillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. -

10. Bundesversammlung Bundesrepublik Deutschland
10. BUNDESVERSAMMLUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BERLIN, MONTAG, DEN 23. MAI 1994 10. Bundesversammlung — Berlin, Montag, den 23. Mai 1994 Inhalt Eröffnung durch Präsidentin Dr. Rita Süssmuth 3 A Konstituierung der Bundesversammlung . 5 B Zur Geschäftsordnung Dr. Rolf Schlierer (Republikaner) 5 B Erster Wahlgang 6 C Ergebnis des ersten Wahlgangs 7 A Zweiter Wahlgang 7 C Ergebnis des zweiten Wahlgangs 7 C Dritter Wahlgang 8 A Ergebnis des dritten Wahlgangs 8 B Annahme der Wahl durch Dr. Roman Herzog 8 B Ansprache von Dr. Roman Herzog 8 B Schlußworte der Präsidentin Dr. Rita Süssmuth 9 C Liste der Mitglieder der Bundesversammlung, die an der Wahl teilgenommen haben . 10 A Liste der entschuldigten Mitglieder der Bundesversammlung 16 B 10. Bundesversammlung — Berlin, Montag, den 23. Mai 1994 10. Bundesversammlung der Bundesrepublik Deutschland Berlin, Montag, den 23. Mai 1994 Stenographischer Bericht Von dieser Stelle aus möchte ich unserem Bundes- präsidenten, Richard von Weizsäcker, und seiner Frau Beginn: 11.00 Uhr Marianne von Weizsäcker unsere herzlichsten Grüße in den Berliner Amtssitz übermitteln Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Meine sehr geehr- (Beifall) ten Damen und Herren! Ich eröffne die 10. Bundesver- sammlung zur Wahl des siebten Präsidenten der Bun- und ihnen danken für ihren hohen Einsatz, für die von desrepublik Deutschland und heiße Sie alle herzlich uns allen hochgeachtete Arbeit für unser Land. willkommen. (Beifall) Ich begrüße die Mitglieder der Bundesversamm- Heute sind wir hier zusammengekommen, um zum lung, unter ihnen Bundeskanzler Helmut Kohl, ersten Mal nach der Vereinigung Deutschlands den Bundespräsidenten aller Deutschen zu wählen. Das (Beifall) ist ein Ereignis, das uns besonders bewegt. die Mitglieder der Bundesregierung, die Ministerprä- Pfingsten und Verfassungstag — welch geeignete- sidenten, Minister und Senatoren der Bundesländer. -

Präsident Stücklen � 19 a Dr
Plenarprotokoll 9/4 Deutscher Bundestag Stenographischer Bericht 4. Sitzung Bonn, Donnerstag, den 6. November 1980 Inhalt: Bekanntgabe der Bildung der Bundes Dr. Hauff, Bundesminister BMV 20 C regierung Gscheidle, Bundesminister BMP 20 D Präsident Stücklen 19 A Dr. Haack, Bundesminister BMBau 20 D 20 D Eidesleistung der Bundesminister Franke, Bundesminister BMB 20 D Genscher, Bundesminister AA 20 A Dr. von Bülow, Bundesminister BMFT . 21A Baum, Bundesminister BMI 20A Dr. Schmude, Bundesminister BMBW . 21 A Dr. Vogel, Bundesminister BMJ 20 A Offergeld, Bundesminister BMZ Matthöfer, Bundesminister BMF 20 B Abweichung von den Richtlinien für die Dr. Graf Lambsdorff, Bundesminister Fragestunde 21 C BMWi 20 B Nächste Sitzung 21 C Ertl, Bundesminister BML 20 B Dr. Ehrenberg, Bundesminister BMA . 20B Dr. Apel, Bundesminister BMVg 20 C Anlage Frau Huber, Bundesminister BMJFG . 20C Liste der entschuldigten Abgeordneten . 23* A - Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode — 4. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 6. November 1980 19 4. Sitzung Bonn, den 6. November 1980 Beginn: 10.01 Uhr Präsident Stücklen: Meine Damen und Herren, die Herrn Sitzung ist eröffnet. Dr. Volker Hauff zum Bundesminister für Verkehr Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: Herrn Kurt Gscheidle Bekanntgabe der Bildung der Bundesregie- zum Bundesminister rung für das Post- und Fernmeldewesen Der Herr Bundespräsident hat mir hierzu mit Herrn Schreiben vom 5. November 1980 mitgeteilt: Dr. Dieter Haack Gemäß Artikel 64 Absatz 1 des Grundgesetzes zum Bundesminister für Raumordnung, für die Bundesrepublik Deutschland habe ich Bauwesen und Städtebau heute auf Vorschlag des Herrn Bundeskanzlers Herrn zu Bundesministern ernannt: Egon Franke Herrn zum Bundesminister für innerdeutsche Hans-Dietrich Genscher Beziehungen zum Bundesminister des Auswärtigen Herrn Herrn Dr. -

Uva-DARE (Digital Academic Repository)
UvA-DARE (Digital Academic Repository) Party politics as we knew it? Failure to dominate government, intraparty dynamics and welfare reforms in continental Europe Korthouwer, G.H.P. Publication date 2010 Document Version Final published version Link to publication Citation for published version (APA): Korthouwer, G. H. P. (2010). Party politics as we knew it? Failure to dominate government, intraparty dynamics and welfare reforms in continental Europe. Uitgeverij BOXPress. General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl) Download date:05 Oct 2021 Party Politics as We Knew It? Knew as We Politics Party Party Politics as We Knew It? is an investigation of welfare state reforms in Austria, Germany and the Netherlands from the early 1980s to 2006. -

Dokument 1.Pdf
1 MEHR BETEILIGUNGSKAPITAL – MEHR MARKTWIRTSCHAFT Vermögenspolitik und Beteiligungskapital in der Bürgergesellschaft Otto Graf Lambsdorff November 2006 Position Liberal Positionspapier des Liberalen Instituts der Friedrich-Naumann-Stiftung Beteiligung_80S2_NEU.indd 1 16.11.2006 13:50:35 Uhr 2 Beteiligung_80S2_NEU.indd 2 16.11.2006 13:50:35 Uhr 3 Inhaltsverzeichnis Vorwort: Für eine Renaissance liberaler Vermögenspolitik I. Das Problem 7 1. Ursachen für Forderungen nach breiter Streuung des 8 Produktivvermögens 2. Die besondere Rolle der Mitarbeiterbeteiligung für 11 Eigenkapital des Mittelstands II. Zur Entwicklung und Streuung von Vermögen und 16 Beteiligungskapital 1. Zur Entwicklung der Vermögensbildung und ihrer 17 Streuung 2. Zur Vermögensverteilung 25 3. Zur Entwicklung von Beteiligungskapital und 30 Mitarbeiterbeteiligung 4. Fallbeispiele von Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland 32 5. Motivation, Kreativität, Innovation, Wettbewerbsstärke 39 durch Mitarbeiterbeteiligung? 6. Das wichtige Sonderproblem: Eigenkapital und 42 Mitarbeiterbeteiligung im Mittelstand III. Was politisch getan werden sollte – und was 45 die Politik lassen muss 1. Was die Politik bei Vermögensbildung und 47 Mitarbeiterbeteiligung lassen muss 2. Notwendig: Geldwertstabilität, Wahlfreiheit 49 und Wettbewerb bei den Vermögensanlagen – ohne Diskriminierung, Reform des Arbeitsvertragsrechts IV. Anhänge: Tabellen, Literatur 61 Beteiligung_80S2_NEU.indd 3 16.11.2006 13:50:36 Uhr 4 Beteiligung_80S2_NEU.indd 4 16.11.2006 13:50:36 Uhr 5 Vorwort Für ein Renaissance -
UID 1974 Nr. 20 Beilage: Dokumentation, Union in Deutschland
• UiD-DOKUMENTATION 20/74 Es geht um die Sicherheit unseres Staates Tatsachen zur Spionageaffäre im Bundeskanzleramt Die SPD unternimmt den Versuch, den Rücktritt Bundeskanzler Brandts wegen der Spionageaffäre Guillaume mit einer von der Opposition entfachten „Hetz- und Verleumdungskampagne" zu erklären. Richtig ist dagegen — wie es in der gemeinsamen Erklärung der Parteipräsidien von CDU und CSU heißt —, daß der Spionage- fall Guillaume nicht die entscheidende Ursache, sondern nur noch der letzte Anstoß für den Rücktritt Willy Brandts war. Beweis dafür, wie die Bevölkerung über die Regierung Brandt dachte, ist die rapide abnehmende Zahl derer, die auf die Frage „Sind Sie im großen und ganzen mit der Politik von Bundeskanzler Brandt einverstanden?" mit „einverstanden" aufwarteten: Dezember 1972 = 72 Prozent, Februar 1973 — 53 Prozent, März 1973 = 46 Prozent, Dezember 1973 = 38 Prozent, Januar 1974 = 35 Prozent, März 1974 = 33 Prozent. (Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach) Der Fall Guillaume berührt aber empfindlich die Sicherheitsinteressen unseres Staates, und in diesem Zusammenhang hat die Opposition allerdings die Ver- pflichtung, Aufklärung zu verlangen. Die nachfolgende Dokumentation, die der parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundesfraktion Gerhard Redde- mann zusammengestellt hat, dient dazu, auf Grund der bisher bekannt geworde- nen, ganz gewiß nicht lückenlosen Fakten die zentrale Frage aufzuhellen, inwie- weit durch Leichtfertigkeit, Fahrlässigkeit und Parteibuchwirtschaft die Sicherheil unseres Staates gefährdet wurde. Die Affäre Guillaume Die bisher bekanntgewordenen Fakten über den Fall Guillaume sind in der Tat erschreckend. Günter Guillaume (Jahrgang 1927), Kochlehrling, Aushilfsfotograf, Bauhilfsarbei- ter, Verlagsangestellter, Einzelhandelsverkäufer und schließlich Unterbezirksge- UiD-Dokumentation 20/74 schäftsführer der Frankfurter SPD, wurde 1969 im Gefolge der allgemeinen Auf- blähung des Bundeskanzleramtes durch Genossen der neuen Regierungspartei in das Zentrum der Bundesregierung geschleust. -
Geschichte Der SPD-Bundestagsfraktion
Geschichte der SPD-Bundestagsfraktion .............................................................................................................. .............................................................................................................. ............................................. Eine Übersicht in Stichworten ............................................. www.spdfraktion.de Geschichte der SPD-Bundestagsfraktion .............................................................................................................. .............................................................................................................. ............................................. Eine Übersicht in Stichworten ............................................. Vorwort .................................................................................... .................................................................................... Seit 1949 ist der Bundestag ein zentraler Ort, an dem politische Weichen der Republik gestellt werden. Die SPD-Bundestags- fraktion hatte von Beginn an starken Anteil an diesen Weichenstellungen. Ob als Regierungs- oder Oppositions- fraktion war sie immer ein tragender Pfeiler der wachsen- den Demokratie. Seit ihrem ersten Zusammentreten am 31. August 1949 in Bonn waren Fraktionssitzungen ungezählte Male der Ort, an dem um sozialdemokratische Richtungsentscheidungen gerungen wurde. Von der Westbindung in den fünfziger Jahren über die Ostpolitik Willy Brandts, die in den siebziger Jahren die Chance -

Germany July-December 1978
COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES PRESS RELEASES PRESIDENCY: GERMANY JULY-DECEMBER 1978 Meetings and press releases November 1978 Meeting number Subject Date 543rd Health 16 November 1978 544th Economics/Finance 20 November 1978 545th Foreign Affairs 20-21 November 1978 546th Agriculture 20-21 November 1978 547th Budget 20 November 1978 548th Transport 23 November 1978 549th Fisheries 23-24 November 1978 550th Social Affairs 27 November 1978 551st Budget 5-6 November 1978 COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES GENERAL SECRETARIAT PRESS RELEASE 543rd meeting of the Council - Health- Brussels, 16 November 1978 President: Mrs Antje HUBER Federal Minister for Youth, Family Affairs and Health and Mr Hans-Georg WOLTERS State Secretary, Federal Ministry for Youth, Family Affairs and Health of the Federal Republic of Germany 1291/78 (Presse 146) - 2- 16.XI.78 The Governments of the Member States and the Co~~ssion of the European Comnrunities were represented as follows: ~lt.£~: Mr Luc DHOORE Minister for Health and the . Environment Mr Knud ENGGAARD Minister for the Interior ~!.~~: Mrs Antje HUBER Federal Minister for Youth, Family Affairs and Health Mr Hans-Georg WOLTERS State Secretary, .Federal Ministry of Youth, Family Affairs and Health ---France: :Mrs Simone VEIL Minister for Health and Family Affairs Ireland: Mr Charles HAUGHEY Minister for Health and Social Affairs !!§;~: Mrs Tina ANSELMI Minister for Health 1291 e/78 (Presse 146) ert/SMS/jme 0 ••/. 0. -· 3 - ~embour~: Mr Joseph WEYLAND Deputy Permanent Representative _.....,.....Netherlands: ___ _ Mrs E. VEDER-SMIT State Secretary, Ministry of Health and the Environment gnited Ki~dom: II'Ir Roland MOYLE Minister of State, Department of Health and Social Security .;;...;,.........,;......,.._Conm1ission: Mr Henk VREDELING Vice-President 0 0 0 1291 e/78 {Presse 146) ert/S!IlS/jme .. -

PROFIL 2019 40 JAHRE SALEMER GESPRÄCHE 40 Heimat Ist Mehr Als Ein Ort
PROFIL 2019 40 JAHRE SALEMER GESPRÄCHE 40 Heimat ist mehr als ein Ort. “ Volksbank Heimat ist ein Bad Saulgau Raiffeisenbank Raiffeisenbank Bad Saulgau Aulendorf Gefühl.“ Raiffeisenbank Volksbank Altshausen Reute-Gaisbeuren VR Bank Ravensburg-Weingarten Volksbank Allgäu-Oberschwaben Volksbank Ravensburg Raiffeisenbank Oberteuringen-Meckenbeuren Volksbank Gut beraten. Friedrichshafen-Tettnang Besser beraten. Genossenschaftlich beraten! Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Wir machen den Weg frei. Nur Mittelstand versteht Mittelstand wirklich. Die Volksbanken Raiffeisenbanken fördern den Mittelstand in der Region. Nutzen auch Sie unsere Genossenschaftliche Beratung für Ihre unternehmerischen Pläne und Vorhaben. Sprechen Sie persönlich mit einem Berater in einer der zehn Volksbanken Raiffeisenbanken in der Region Ravensburg-Bodensee-Sigmaringen oder Sie gehen online. www.bzv-bodensee.de Heimat ist mehr als ein Ort. “ Volksbank Heimat ist ein Bad Saulgau Raiffeisenbank Raiffeisenbank Bad Saulgau Aulendorf Gefühl.“ Raiffeisenbank Volksbank Altshausen Reute-Gaisbeuren VR Bank Ravensburg-Weingarten Volksbank Allgäu-Oberschwaben Volksbank Ravensburg Raiffeisenbank Oberteuringen-Meckenbeuren Gut beraten. Volksbank Vorwort Frank Burkert Friedrichshafen-Tettnang Besser beraten. Liebe Leserinnen und Leser, begleitet uns durch alle Gespräche und Veran- Genossenschaftlich liebe Wirtschaftsjunioren, staltungen. beraten! 40 Jahre Salemer Gespräche dürfen wir mit Neben den Vorbereitungen für das Jubiläum Ihnen dieses Jahr feiern und wir danken Ihnen -

9. Bundesversammlung Bundesrepublik Deutschland
9. BUNDESVERSAMMLUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BONN, DIENSTAG, DEN 23. MAI 1989 2 9. Bundesversammlung — Bonn, Dienstag, den 23. Mai 1989 Inhalt Eröffnung durch Präsidentin Dr. Süssmuth 3 A Konstituierung der Bundesversammlung 4 B Wahlgang 5 A Ergebnis der Wahl 5 B Annahme der Wahl durch Bundespräsident Dr. von Weizsäcker 5 B Glückwünsche der Präsidentin Dr. Süss muth 5 C Ansprache des Bundespräsidenten Dr. von Weizsäcker 5 C Schlußworte der Präsidentin Dr. Süssmuth 6 A Liste der Mitglieder der Bundesversamm lung, die an der Wahl teilgenommen haben 7 A Liste der entschuldigten Mitglieder der Bun- desversammlung 12 A - 9. Bundesversammlung — Bonn, Dienstag, den 23. Mai 1989 3 9. Bundesversammlung der Bundesrepublik Deutschland Bonn, Dienstag, den 23. Mai 1989 Stenographischer Bericht noch immer ein geteiltes Land und ein geteiltes Volk sind. Aber wir wissen auch, daß das Freiheitsstreben Beginn: 11.00 Uhr der Menschen nicht zu brechen ist (Beifall) Präsidentin Dr. Süssmuth: Sehr geehrte Damen und Herren! Ich eröffne die 9. Bundesversammlung zur und sich unaufhaltsam seinen Weg bahnen wird, bis Wahl des Bundespräsidenten der Bundesrepublik der Auftrag unseres Grundgesetzes erfüllt ist, „in Deutschland und heiße Sie alle herzlich willkommen. freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Ich begrüße die Mitglieder der Bundesversammlung, Deutschlands zu vollenden" . unter ihnen den Bundeskanzler und die Mitglieder (Lebhafter Beifall) der Bundesregierung, die Ministerpräsidenten, die Minister und Senatoren der Bundesländer. Stellver- Meine Damen und Herren, der Staatsaufbau unse- tretend für alle Bürger und Bürgerinnen unseres Lan- rer Verfassung nimmt seinen Ausgang bei der Gewal- des grüße ich die Mitglieder des Bundestages und die tenteilung, bei der Trennung der staatlichen Gewal- von den Länderparlamenten gewählten Mitglieder ten. -

UID 1973 Nr. 48, Union in Deutschland
Z 8398 C Informationsdienst der Christlich Demokratischen Union Deutschlands Union in Deutschland Bonn, den 13. Dezember 1973 BUNDES- Brandt hat Berlin AUSSCHUSS Der Bundesausschuß hat am wieder vergessen 10. Dezember richtungweisende Aussagen zu akuten Problemen Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl Carstens, gemacht, wie Bundespräsidenten- erklärte zur Unterzeichnung des deutsch-tschechoslowakischen Ab- wahl, Energiekrise, Wettbewerb, kommens mit Zustimmung der Fraktion folgendes: Preise/Löhne, Entspannung, Der Ausgleich mit der Tschechoslowakei ist von jeher ein Neutralismus, Ostblock-Kredite, europäische Gipfelkonferenz Ziel der Außenpolitik der CDU/CSU gewesen und bleibt es weiter. Aber wir müssen feststellen, daß dieser Vertrag an Seite 3, 4 einem schweren Mangel leidet, nämlich daran, daß über seine entscheidende Aussage zum Münchener Abkommen eine Meinungsverschiedenheit besteht, schon jetzt wird diese Ver- • GRUNDGESETZ tragsklausel von beiden Seiten unterschiedlich ausgelegt. Der Prof. H. H. Klein widerlegt die historische Ablauf ist nach unserer Ansicht einseitig darge- gefährliche und als Modellversuch stellt. Es ist wohl von nationalsozialistischer Gewalt, aber nicht zu wertende These Bahrs, das von der Vertreibung der Sudentendeutschen aus ihrer Heimat den Berlin-Verkehr betreffende die Rede. Transit-Abkommen mit der DDR In dem Briefwechsel zu humanitären Fragen verpflichtet sich sei als Bestandteil des Vier- die tschechoslowakische Seite, lediglich Fälle der Ausreise mächte-Abkommens Besatzungs- recht und stehe als solches über wohlwollend zu prüfen. Dies bleibt weit hinter dem zurück, dem Grundgesetz was allgemein erwartet worden war, und läßt wohl die Be- Seite 5, 6 fürchtung aufkommen, daß auch in diesem Zusammenhang finanzielle Forderungen an die Bundesrepublik Deutschland gerichtet werden. BUNDES- Besonders zu bedauern ist, daß sich die Bundesregierung KANZLER mit ihrer Forderung nach voller Einbeziehung Berlins in die Ab- machungen nicht durchgesetzt hat.